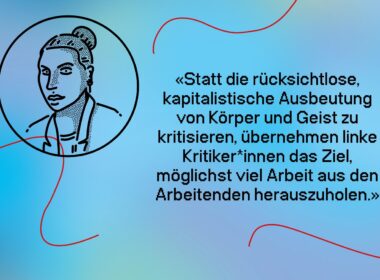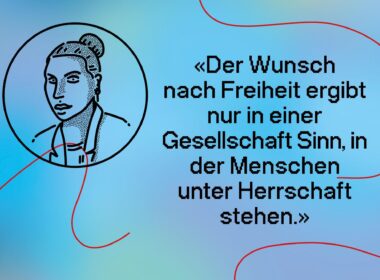Die Theorie der Love Languages kennt fünf Arten, wie Menschen Liebe ausdrücken und empfangen: Worte der Bestätigung, Taten, Geschenke, Quality Time und Berührungen. Doch ich bin überzeugt, dass es noch eine sechste gibt: das Schicken und Empfangen von Memes.
Was gibt es Intimeres als ein perfekt getimtes Meme, das ein komplexes Gefühl, einen flüchtigen Gedanken oder Situation in einem Frame und wenigen Zeilen auf den Punkt bringt?
Ein Meme sagt mehr als tausend Worte und vermittelt neben dem witzigen, tiefgründigen oder bescheuerten Inhalt eine wichtige Meta-Nachricht auf der Beziehungsebene: Ich kenne dich. I see you und die schrulligen Seiten, die genau dieses Meme vermittelt.

Ich erinnere mich an einen Moment vor ein paar Jahren, als ich einem Love Interest ein sehr passendes Spongebob-Meme schickte. Damals lief es zwischen uns etwas komplizierter und die Lösung war simpel. Doch anstatt direkt ein „Räum deinen Scheiss auf” zu formulieren, brachte das Meme mit seiner eleganten Mischung aus Kritik und Galgenhumor die Sache auf den Punkt, ohne vorwurfsvoll zu wirken.
Ich stelle mir Memes gerne als Insider-Witze für das Internet vor.
Es ist wie bei der Redewendung, „etwas durch die Blume zu sagen” – das vorsichtige, freundliche Üben von Kritik, ohne allzu direkt zu sein. Durch Memes hat sie allerdings ein zeitgemässes Update erfahren; „etwas durch ein Meme zu sagen” bedeutet nicht allzu konfrontativ, immer ein wenig selbstironisch und emotional indirekt zu kommunizieren – Digital Natives in a nutshell.

Was ist überhaupt ein Meme?
Der Duden definiert ein Meme als „(interessantes oder witziges) Bild, Video o. Ä., das in sozialen Netzwerken schnell und weit verbreitet wird”.
Ich stelle mir Memes gerne als Insider-Witze für das Internet vor, meist für eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamen Erfahrungen. Wie vielen anderen Autor*innen und Journalist*innen ich bereits das Bild geschickt habe, das die Quintessenz aus Zeitdruck, Prokrastination (und Reue) sowie Pragmatismus zusammenfasst, die viele Schreibende nur zu gut kennen.

Mit der steigenden Bedeutung der Social-Media-Plattformen in den späten 00er-Jahren wurden Memes präsenter in der digitalen Landschaft. LOLcats (Bilder von Katzen mit fehlerhaft unbeholfenen Captions) oder Trollfaces (eine schwarz-weisse Zeichnung eines Trolls mit einem breiten Grinsen im Gesicht) waren der Anfang der digitalen Welle, die in Internetforen oder Plattformen wie Reddit und später dann Instagram und Twitter aufkamen, viral gingen und sich abgewandelt verbreiteten.
Was mich jedoch überraschte, als ich anfing, mehr über Memes zu lesen, war die Tatsache, dass ihre Geschichte nicht erst mit dem Internet beginnt. Der Begriff wurde erstmals 1976 von dem britischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins in seinem Buch „The Selfish Gene” geprägt. Dawkins beschrieb damit die Idee, dass kulturelle Informationen ähnlich wie Gene weitergegeben werden. Memes sind dabei eigenständige kulturelle Einheiten, die durch Nachahmung, Replikation und Veränderung weitervermittelt werden. Dabei kann es sich um Ideen, Bräuche oder Verhaltensweisen handeln, wie zum Beispiel eine bestimmte Art des Kopfnickens, die sich – ähnlich der genetischen Vererbung – in verschiedenen Gesellschaften verbreiten und im kollektiven Bewusstsein oder Verhalten verankern.
Längst sind die Zeiten vorbei, in denen das Wissen der Welt zwischen zwei Buchdeckel passen musste. Gut so, denn statt in verstaubten Enzyklopädien im untersten Regalfach kann Wissen in ganz unterschiedlichen Formen kommen.
Doch was zählt überhaupt als Wissen? Wer bestimmt darüber und wer hat Zugang dazu? In der Annzyklopädie widmet sich Ann Mbuti den Wissensformen unserer Zeit. Mit kritischem Blick und einer gesunden Skepsis nimmt sie unsere individuellen Perspektiven und Erfahrungen unter die Lupe, die die Art und Weise prägen, wie Wissen gesammelt und interpretiert wird.

Ann Mbuti ist unabhängige Autorin mit Schwerpunkt auf zeitgenössischer Kunst und Popkultur. Ihre Arbeit konzentriert sich auf künstlerische Projekte, die das Potenzial für soziale, politische oder ökologische Veränderungen haben. Derzeit beschäftigt sie sich mit Mythologien, mündlicher Geschichte, Science Fiction und der Verschmelzung von Fakten und Fiktion. Seit 2024 ist sie Professorin für Prozessgestaltung am HyperWerk der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel.
In diesem Sinne konnte man bis zum Aufkommen des Internets auch Sprichwörter, Weisheiten, Aphorismen oder Fabeln als Memes – also als Träger kultureller Identität und Inhalte – bezeichnen. Doch was früher durch mündliche Überlieferung oder dem Festschreiben von Geschichten passierte, geschieht im Internet durch Likes, Retweets und Shares in einem viel schnelleren Tempo. Digitale Memes verbreiten sich mit einer Geschwindigkeit, die sich Dawkins wohl nie hätte träumen lassen. Und sie verändern sich dabei ständig, denn jedes neue Meme bringt Tausende von Variationen mit sich – beispielsweise bei Klassikern wie dem „Woman yelling at Cat” oder dem zeitlosen „Distracted Boyfriend”.
Memes sind ein effektives Mittel zur Meinungsverbreitung, da sie gezielt Emotionen ansprechen.
Memes wie diese sind tausendfach auf die verschiedensten Situationen angewendet worden und weit mehr als nur flüchtige Internettrends, denn digitale Medien haben nicht nur unsere Art zu kommunizieren verändert, sondern auch die Art, wie wir Wissen und Kultur weitergeben. Was einst als ein einfaches Bild begann, wird durch Remix-Kultur und kollektive Kreativität zu einem popkulturellen Phänomen. Früher waren Bücher, Zeitungen oder mündliche Überlieferungen die Hauptquellen des kollektiven Wissens. Heute ergänzen Memes und virale Videos sie als digitale Pendants.

Die dunkle Seite der Memes
Doch ganz ohne Nebenwirkungen ist die Meme-Kultur nicht. Eine Untersuchung der University of Toronto fand heraus, dass Memes ein effektives Mittel zur Meinungsverbreitung sind, da sie gezielt Emotionen ansprechen und oft in sozialen Netzwerken ungefiltert verbreitet werden. Kritische Reflexion geht da oft unter. Klingt harmlos?
Im Wahlkampf der Präsidentschaftswahl 2016 in den USA wurden Memes bewusst eingesetzt, um polaristische Meinungen zu verstärken. Memes sind nicht zwangsläufig böse, doch die Untersuchung zeigt, dass ihr schneller, zugänglicher Charakter es begünstigt, dass sich Desinformation oder verzerrte Darstellungen schnell und effektiv verbreiten.
Hier knüpft Legacy Russell in ihrem Buch „Black Meme” an, das im Mai 2024 herauskam. Es analysiert die Bedeutung und Folgen von Memes für marginalisierte Gruppen. Die Meme-Kultur ist nicht nur ein modernes Kommunikationsmittel, sondern auch ein Werkzeug zur Reproduktion rassistischer Stereotype, heisst es darin. Sie argumentiert, dass insbesondere Schwarze Körper und Schwarze Kultur überproportional oft in Memes dargestellt werden – und dabei meist in einer Weise, die bestehende Machtstrukturen festigt, anstatt sie zu hinterfragen. Die Folge: Das koloniale Erbe wird digital weitergeführt.
Für mich bleibt das Senden von Memes trotzdem eine Love Language. Doch wie bei jeder Form der Kommunikation verbirgt sich hinter dem Ausdruck digitaler Zuneigung immer auch eine tiefere gesellschaftliche und politische Ebene. Und manchmal auch eine Botschaft, die unsere Vorstellungen von Identität, Macht und Wahrheit prägt.
Memes beeinflussen unser kollektives Wissen und die Art, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, schon jetzt. Unsere digitale Kompetenz muss mit den Entwicklungen noch Schritt halten lernen, so viel Beziehungsarbeit sind wir uns alle schuldig.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 18 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1196 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 630 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 306 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?