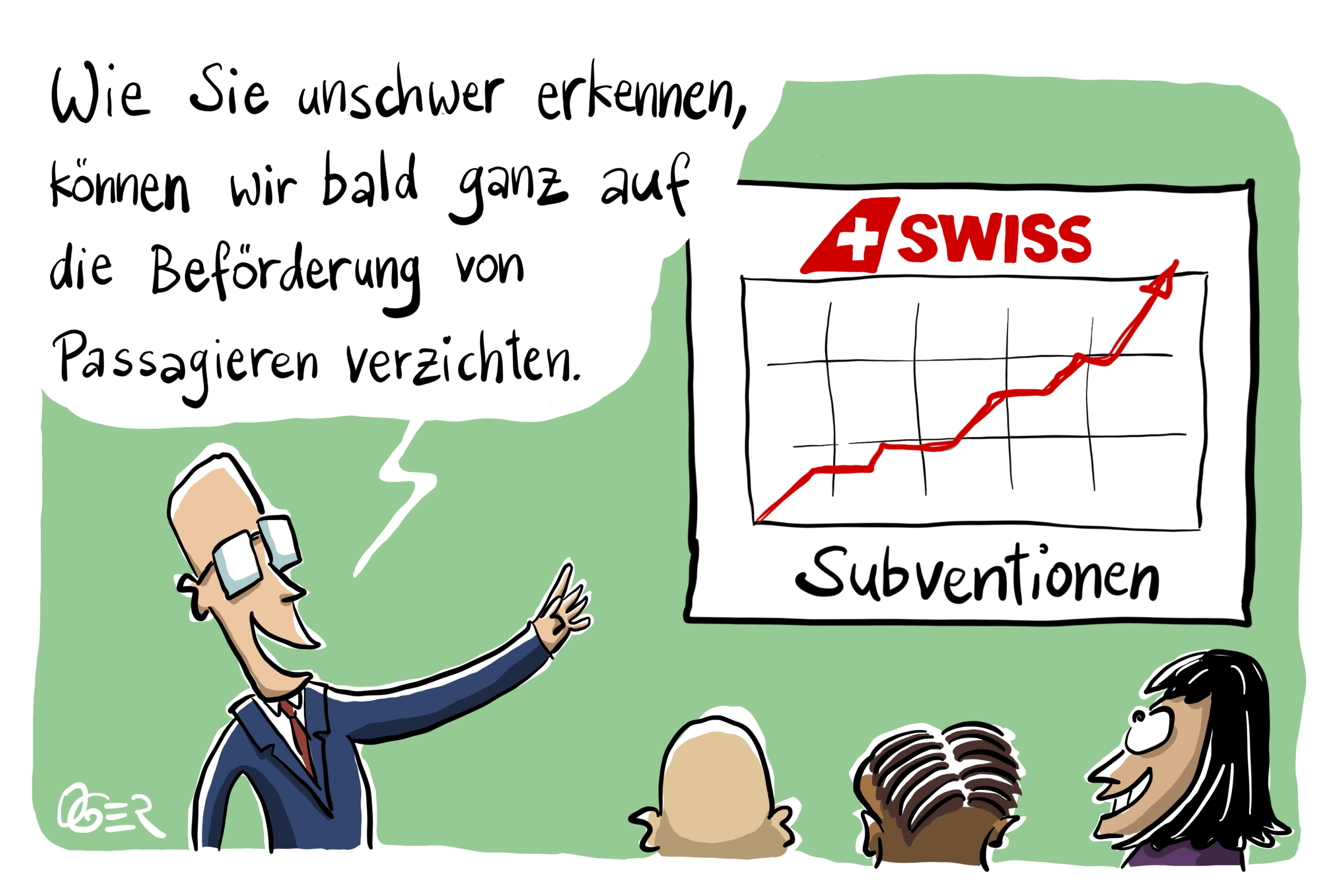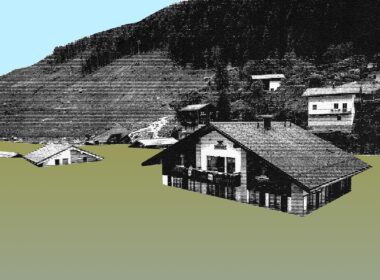Marcus Ulber und Sven Rindlisbacher kennen sich nicht. Das ist insofern mässig erstaunlich, als sie eigentlich nichts verbindet. Einer arbeitet im Hipsterquartier in Basel als Forstingenieur, der andere besitzt eine Gärtnerei im Berner Oberland. Der eine glaubt an den Klimawandel und daran, dass die Welt von morgen anders aussehen wird. Der andere ist davon nicht wirklich überzeugt. Trotzdem sind sie sich in einem einig: Gastbäume mögen sie nicht.
„Stihl“ steht auf Sven Rindlisbachers Hosenträgern, die seine graue Arbeitshose an Ort und Stelle halten. Er kommt gerade aus seiner Gärtnerei. Die Wanderschuhe zieht er trotzdem nicht aus, als er in sein umgebautes Bauernhaus mit Sicht auf den Thunersee stapft. Der grösste Stress des Jahres ist zwar schon vorbei, die meisten seiner 100’000 Primeln, 200’000 Geranien und 700’000 Gemüsesetzlinge sind an die Landi ausgeliefert. Aber „irgendetwas gibt es immer zu tun.“ Auch weil der Job als Gärtnermeister nicht seine einzige Aufgabe ist: Daneben amtet Rindlisbacher als Vorstandmitglied der SVP Spiez.
Gut, dass ihm da wenigstens der Klimawandel keine schlaflosen Nächte bereitet. „Es gibt mehr Wetterkapriolen, das stimmt wohl“, sagt er beim Mineral in seiner Küche sitzend. Aber dass die Temperaturen merklich steigen werden, das glaube er nicht so ganz. „Mit dem Waldsterben war’s auch so eine Hysterie, so schlimm kam’s dann doch nicht.“ Entsprechend muss man sich laut Rindlisbacher auch jetzt keine Sorgen um die Baumlandschaft der Schweiz machen: „Nur weil es etwas milder wird, sterben uns noch nicht gleich alle Bäume weg.“
Ganz negieren will er den Klimawandel dann aber doch nicht: „Natürlich verändert sich das Klima. Aber erstens tat es das schon immer und zweitens ist es ja klar, dass wir das, so viele Menschen wie wir jetzt sind, beeinflussen“, sagt Rindlisbacher. Und dann komme noch die katholische Kirche und mache die Überpopulation mit ihrer Anti-Verhütungspolitik noch schlimmer. „Ich finde, die Schweizer Hilfswerke sollten Aufklärung unterrichten.“
Die Angst vor der Invasion
Die einen oder anderen Hosenträger sieht man auch im Gundeldinger Feld in Basel. Nur sind sie hier modischer und werden eher in Kombination zu Chelsea Boots getragen. Auf dem ehemaligen Fabrikareal gibt’s heute alles, von der kleinen Brauerei bis zur Kletterhalle. Irgendwo dazwischen ist der Pro Natura-Hauptsitz angesiedelt. Marcus Ulber arbeitet seit 2005 hier. Der Forstingenieur betreut das Dossier Waldpolitik und hat unter anderem für das Vereinsmagazin einen Artikel verfasst mit dem Titel „Der Klimawandel wird zu Buche schlagen“.
Das Lamm: Herr Ulber, die Erde wird wärmer. Viele der Bäume, die heute in unseren Wäldern und Städten wachsen, werden das in fünfzig bis hundert Jahren nicht mehr tun. Richtig?
Marcus Ulber: Aller Voraussicht nach wird das der Fall sein.
Das Lamm: Aber Rettung naht. Wir können Gastbäume importieren, aus Regionen, in denen das Klima heute dem unsrigen in einigen Jahrzehnten entspricht. Zum Beispiel aus dem Balkan.
Marcus Ulber: Schlechte Idee. Man weiss nie genau, was man macht, wenn man fremde Arten in ein Gebiet bringt. Die können einen Pilz mitbringen und damit einen riesigen Einfluss auf das heimische Ökosystem haben. Es gibt wirklich genügend Beispiele von Pflanzen, die invasiv geworden sind. Zum Beispiel die Buddleja, die übrigens immer noch vielerorts verkauft wird. Was ich eine Frechheit finde. Wobei der Balkan für mich ein Grenzfall ist.
Das Lamm: Wieso sind Balkan-Bäume ein Grenzfall?
Marcus Ulber: Ein wirklich absolutes No-Go sollten meiner Meinung nach Pflanzenimporte aus Gegenden der Welt sein, von denen uns eine natürliche Verbreitungsbarriere trennt. Zum Beispiel ein Ozean oder auch ein grosses Gebirge. Zwischen dem Balkan und Mitteleuropa gibt es das nicht so wirklich, das heisst, theoretisch könnten sich diese Arten auch auf natürlichem Weg hierher bewegen.
Das Lamm: Also doch Balkan-Gastbäume!
Marcus Ulber: Nur weil ich sie kein absolutes No-Go finde, heisst es noch lange nicht, dass ich ein Fan dieser Importe bin. Ich finde sie vor allem unnötig.
Das Lamm: Wir brauchen Bäume. Sie kühlen und reinigen die Städte, sind Naherholungsraum und Rohstoff. Inwiefern ist das unnötig?
Marcus Ulber: Wir haben schon Bäume.
Das Lamm: Die ja eben aussterben.
Marcus Ulber: Bei weitem nicht alle. Es gibt schon lange Arten, denen es hier eigentlich eher zu kühl ist, die entsprechend ein Mauerblümchendasein fristen. Die werden dann vielleicht einfach ‚gross in Mode’ kommen.
Das Lamm: Welches sind Arten, die wir schon hier haben und die bald ‚in Mode’ sein werden?
Marcus Ulber: Etwa die Wildkirsche oder der Walnussbaum. Diese werden in unseren Wäldern einen Aufschwung erleben. Andere, zum Beispiel Buchen, werden es schwer haben.
Migration ausser Kontrolle
95 Kilometer vom Gundeldinger Feld entfernt kommt Rindlisbacher an seinem Küchentisch ebenfalls zum Schluss: Nur wegen des überpopulationsverursachten Klimawandels Bäume zu importieren, das finde er einfach übertrieben. „Ich finde, die gehören nicht hierher. Der Landschaft wegen und weil man nie weiss, wie sie sich ins Ökosystem einfügen werden.” Zudem sei die Globalisierung eh zu weit fortgeschritten. „Wir haben sie nicht mehr im Griff. Schon die Pflanzen, die hier sind, nicht. Die Goldrute zum Beispiel, wie sich die entwickelt hat, ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir nicht noch neue Neophyten zu uns holen sollten. Man sollte jede Kiste zurückschicken, die irgendeine neue Pflanze drin hat.“
Das mit dem umgehenden Zurückschicken will er ausserdem auch mit Wirtschaftsflüchtlingen machen. Rindlisbacher ist Kassier und Fraktionschef der SVP Spiez. Parallelen zwischen bäumischen und menschlichen MigrantInnen möge es geben. „Aber das ist sehr an den Haaren herbeigezogen. Die nicht standortgerechten Bäume werden von uns Menschen importiert, wohingegen die Wirtschaftsflüchtlinge von selber kommen.“ Übrigens habe er durchaus Verständnis für diese Wirtschaftsflüchtlinge. „Ich würde es auch versuchen, wenn ich keine Perspektive und nichts zu verlieren hätte. Aber eine 10-Millionen-Schweiz, das will ich nicht.“
Das Lamm: Herr Ulber, bis jetzt haben wir hauptsächlich über Wälder gesprochen. Die von Ihnen erwähnten Wildkirschen und Walnussbäume tragen Früchte und sind entsprechend ungeeignet als Stadtbäume. Haben Sie auch eine Lösung für die Städte?
Marcus Ulber: Bevor wir Bäume durch die Welt tragen, können wir vielleicht auch den Kriterienkatalog für Stadtbäume anpassen, oder?
Das Lamm: Was sagen Sie dem Stadtgärtner, der sich an diese Vorgaben halten muss? Lieber keine Bäume als fremde Bäume?
Marcus Ulber: Ich habe Verständnis für den Stadtgärtner, dem irgendwann die Möglichkeiten ausgehen. Ich bin ein Waldexperte, ich sehe durchaus, dass die Stadtbäume nochmals eine andere Herausforderung sind. Und wenn mir der Stadtgärtner versichern könnte, dass sein Gastbaum nicht durch Vermehrung in meinem Wald landet, dann soll er den haben. Nur ist es extrem schwierig, das zu garantieren. Und die Bemühungen, neue Arten zu holen, gibt es ja auch bereits bei gewissen Förstern.
Wie viel Risiko ist mit dem Klimawandel zu rechtfertigen?
Dass die Fortpflanzung der springende Punkt ist, darin ist Rindlisbacher mit Ulber einig. Er selber hat einen Kirschlorbeer im Garten, eine Pflanze, die ursprünglich aus Asien stammt. „Aber der wird einmal im Jahr zurückgeschnitten. Damit er sich nicht vermehren kann.” Denn: „Was sich nicht vermehrt, das soll hier meinetwegen sein können. Was schon, das nicht.“ Unverständlich sei für ihn, wieso man zum Beispiel den Buddleja noch vertreiben dürfe. „Invasive Neophyten zu verkaufen, sollte verboten werden“, sagt Rindlisbacher, und seine tiefe Stimme dröhnt.
Nach der Lehre hat er vier Jahre in der Stadtgärtnerei Bern gearbeitet, bevor er sich selbständig machte. Was der Stadtgärtner von Bern mit den Gastbäumen mache, finde er vor allem riskant, sagt Rindlisbacher. „Wie gesagt, ich finde, dieses Risiko ist mit dem Klimawandel nicht zu rechtfertigen.“
Auch sonst ist er nicht überzeugt von der Strategie der Stadtgärtnerei Bern: „Jetzt sind sie ja dort ziemlich auf dem Ökotrip.“ Bio finde er zwar nicht schlecht. „Aber ich bin überzeugt, dass wir die Welt so nicht ernähren können.“ Spritzmittel sollen seiner Meinung nach dann eingesetzt werden, wenn ein Mass an Schädlingen vorhanden sei. „Ich bin ein Chemiefan, aber nur, wenn es sie braucht. Die Dosis macht aus dem Gift Gift. Hat schon Paracelsus gesagt.”
Das Lamm: Herr Ulber, fremde Arten können das Ökosystem verändern. Aber wenn nichts passiert, werden gewisse Arten aussterben, dann geht die Biodiversität zurück – eine wichtige Kennzahl zur Qualität eines Ökosystems. Sollte man die nicht künstlich wieder aufstocken?
Marcus Ulber: Die Biodiversität ist eine von vielen Kennzahlen. Eine andere ist die Unversehrtheit. Es wäre sehr im Sinne der Unversehrtheit unserer Ökosysteme, keine fremden Arten zu importieren. Und im Übrigen können neue Arten auch selber einwandern, wenn es genug warm wird, die brauchen keine Hilfe dabei.
Das Lamm: Kann es nicht sein, dass die Bäume Mühe haben, zu wandern, weil die Siedlungsgebiete teils so gross sind?
Marcus Ulber: Dazu kenne ich keine Studien, aber es kann sein, dass es das erschwert.
Das Lamm: Ist es dann nicht nur fair, wenn wir den Bäumen über die Hindernisse helfen, die wir geschaffen haben?
Marcus Ulber: Gegen die Hilfe über menschgemachte Hindernisse – zum Beispiel Siedlungsgebiete – habe ich nichts einzuwenden. Aber das würde heissen, man nimmt Setzlinge eines Baumes von der einen Seite eines sehr grossen Siedlungsgebiets wie dem Grossraum Wien, und transportiert sie auf die andere Seite. Was für mich nicht darunter fällt, ist, den Baum gleich vom Balkan in die Schweiz zu transportieren.
Das Lamm: Der Klimawandel bereitet Ihnen also keine Sorge?
Marcus Ulber: Bezüglich Wald und Bäumen nicht, nein. Die Welt wird anders aussehen, unsere Vegetation wird anders aussehen. Wer am Bild unserer hohen Fichten hängt, der soll sich davon verabschieden. Zumindest im Mittelland.
Das Lamm: Das dünkt mich arg fatalistisch. Sie sind kein Fan der Gastbäume, aber was spricht denn konkret dagegen?
Marcus Ulber: Es ist ein menschlicher Eingriff in die natürliche Vegetation. Die Konsequenzen solcher Eingriffe kann man nie abschätzen, weshalb sie, wenn immer möglich, unterlassen werden sollten. Und hier ist es möglich. Zudem ist die Forschung, die in das Thema gesteckt wird, auch teuer. Das ist verschwendetes Steuergeld. Aktionismus ist einfach fehl am Platz, wenn sich die Natur auch selber regulieren kann.
Das Lamm: In der Schweiz wird der Wald grösstenteils bewirtschaftet. Wird es die Holzwirtschaft in Zukunft schwerer haben?
Marcus Ulber: Das ist möglich.
Das Lamm: Beunruhigt Sie das?
Marcus Ulber: Nein. Es gibt kein Menschenrecht auf immerwährende Holznutzung, vor allem, wenn der Mensch die künftige Holznutzung in der Schweiz mit dem Klimawandel selber gefährdet.
Neue Technologien gegen den Klimawandel
Einen anderen Blick auf die Holznutzung in der Schweiz hat Rindlisbacher: Anstatt sich unnötigerweise um neue Arten zu kümmern, solle man lieber mal sicherstellen, dass der Wald in der Schweiz ordentlich genutzt werde. „Der Wald in der Schweiz wird massiv unternutzt“, sagt er und fährt sich über seinen beeindruckend buschigen und ebenso beeindruckend wohlgetrimmten Schnauz. Dem Wald ginge es besser, wenn er mehr genutzt würde, ist er überzeugt. „So überaltert er nur. Menschen geht es auch schlecht, wenn sie überaltern.“
Natürlich sei es auch möglich, dass der Stadtgärtner von Bern recht behalte, sagt Rindlisbacher. Aber die Folgen, die der Klimawandel dann doch haben werde, die könne man mit neuen Technologien auffangen. „Ich würde zum Beispiel alle landwirtschaftlichen Intensivkulturen in Gewächshäuser stecken, dort kann man das Klima kontrollieren.“ Die Energie, die es dafür braucht, könne man ja aus nachhaltigen Quellen gewinnen. Zum Beispiel einer Holzschnitzelheizung.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 25 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1560 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 875 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 425 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?