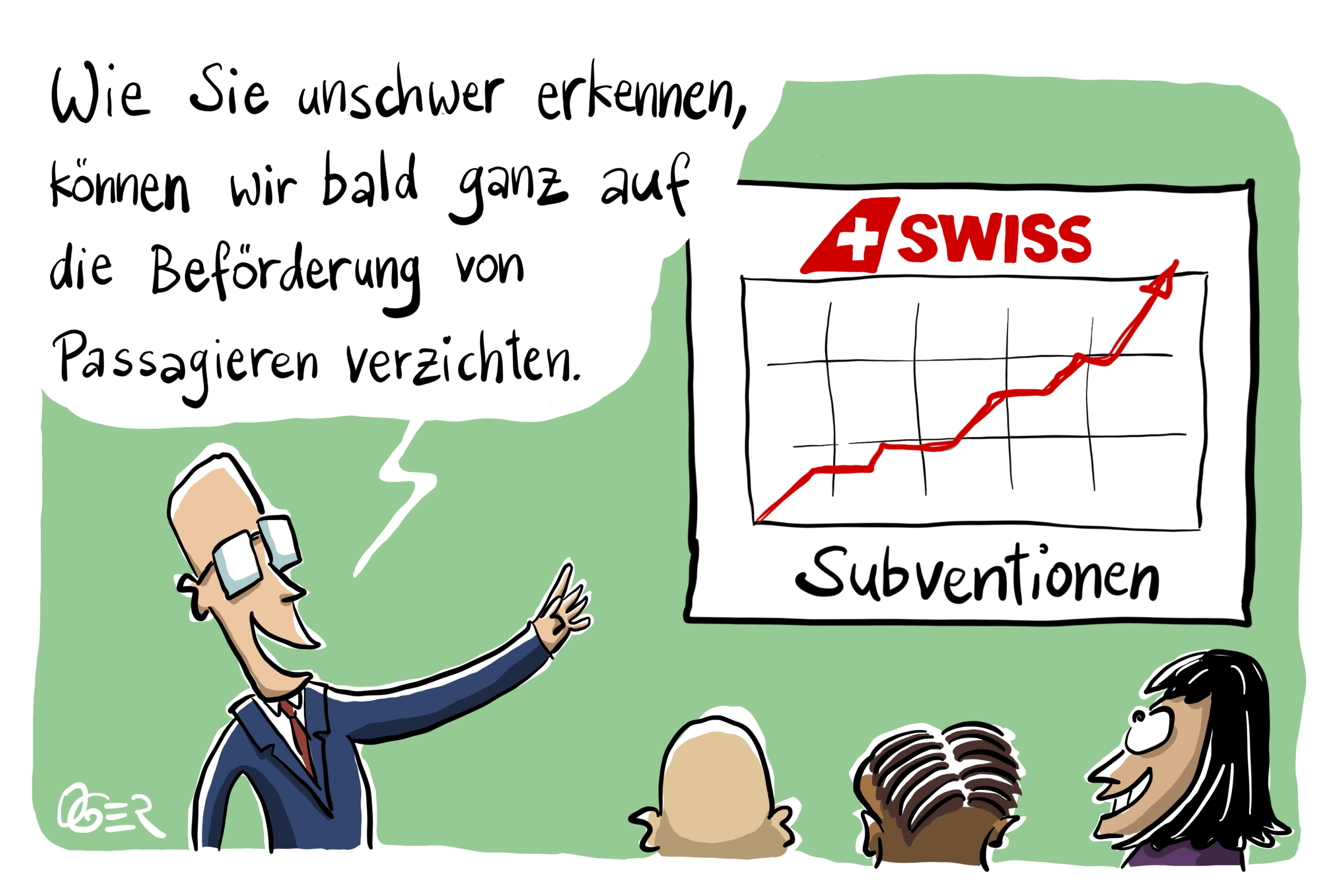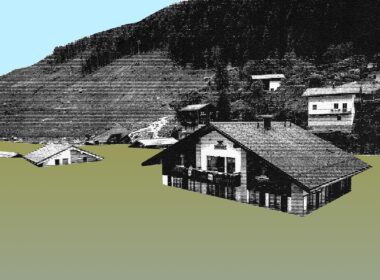„Klimaaktivisten haben Angst vor Burnout” titelte im November letzten Jahres die Gratiszeitung 20 Minuten. Einige Klimaaktivist*innen seien erschöpft, weil sie zu viel zu tun hätten. Ob Arbeit oder Hobby, was zähle sei die Eigenverantwortung, wurde ein Arbeitspsychologe im entsprechenden Artikel zitiert. Denn wer produktiv bleiben wolle, brauche eine konstante Work-Life-Balance. Und auch das klimastreikeigene Wiki gibt zum Thema Burn-Out-Aktivismus Tipps wie „Aufmerksamkeit auf klare Ziele lenken”, „Selbstfürsorge ernst nehmen” oder „Sich in gute Stimmung versetzten”.
Das klingt alles irgendwie so, als liesse sich Erschöpfung aufgrund politischen Engagements mit ein paar Retreats in den Bergen, Wohlfühltees oder Yogaworkshops beheben. Das ist aber ein Trugschluss.
Natürlich ist es nicht falsch, auf seine Grenzen zu achten. Und der Ratschlag „Mach mal Pause” ist als erste Sofortmassnahme, wenn es zu Überarbeitung kommt, sicher nicht falsch – ob bei aktivistischem Engagement oder in einer normalen Anstellung. Schlussendlich sind diese Ratschläge aber doch nur Symptombekämpfung. Denn egal, ob es nun ein Yoga-Retreat ist, das einem beim Entspannen helfen soll, oder gut gemeinte Tipps für eine bessere Work-Life-Balance: All diese Dinge zielen darauf ab, dass der einzelne Aktivist oder die einzelne Aktivistin entweder besser Nein sagen kann zu noch mehr Engagement, oder dass die einzelnen Aktivist*innen effizienter und stärker werden, um mehr leisten zu können.
Aber das wahre Problem liegt nicht darin, dass Menschen, die sich für Klimagerechtigkeit oder andere Ziele wie die Bekämpfung von Rassismus, Armut oder Hunger einsetzen, eine schlechte Work-Life-Balance haben. Es liegt darin, was die Gesellschaft unter Arbeit versteht und wie wir diese entlohnen.
Was genau ist denn eigentlich Arbeit?
Auch der bereits zitierte Arbeitspsychologe scheint sich nicht ganz sicher gewesen zu sein, mit was er es beim Einsatz der Klimastreikenden zu tun hat: mit einer Arbeit oder mit einem Hobby. Und tatsächlich ist es gar nicht so klar, welches Kriterium eine Tätigkeit nun als Arbeit kategorisiert. Der Lohn kann es nicht sein. Es gibt auch viele Tätigkeiten, die im unbezahlten Ehrenamt als Arbeit erledigt werden. Die Tätigkeit an und für sich jedoch auch nicht. Denn viele Tätigkeiten, die von Klimastreikenden gemacht werden, wie Demos organisieren, kochen oder Kommunikationsstrategien entwerfen, sind Dinge, die man genauso gut in einem klassischen Arbeitsverhältnis wie in einem aktivistischen Rahmen machen kann. Was also ist Arbeit?
Das Bundesamt für Statistik (BFS) erfasst im Rahmen der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) neben den bezahlten Arbeitsstunden auch regelmässig die Arbeitsstunden, die von Herrn und Frau Schweizer unbezahlt geleistet werden. Das dabei angewandte Kriterium, um etwas als Arbeit einzustufen, ist laut Jacqueline Schön-Bühlmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim BFS in der Sektion Arbeit und Erwerbsleben, das sogenannte Drittpersonen-Kriterium. Das Konzept dahinter: Jede unbezahlte Tätigkeit, die durch eine über den Markt engagierte Person gegen Bezahlung ausgeführt werden könnte, gilt als unbezahlte Arbeit. Darunter fallen laut Schön-Bühlmann sowohl Haus- und Betreuungsarbeiten, Freiwilligenarbeit für Vereine und Organisationen sowie informelle Hilfeleistungen.
Die Klimastreikenden, so Schön-Bühlmann, seien wahrscheinlich schwierig zuzuordnen: „Falls sie in einer Art Organisation aktiv sind, würde z.B. die Organisation von Streiks im Prinzip als Freiwilligenarbeit zählen. Die Teilnahme an Anlässen respektive Streiks jedoch nicht.” Das macht Sinn. Denn einen Menschen zu finden, der gegen Geld für mich an die Demo geht, ist schwierig. Eine Person zu finden, die für den Klimastreik gegen Geld eine Kommunikationsstrategie oder eine Medienmitteilung entwirft, jedoch nicht. Vieles von dem, was die Klimastreikenden leisten, ist also offiziell Arbeit. Die Kommentare unter dem Burnout-Artikel von 20 Minuten zeigen, dass das nicht allen klar ist.

Vielmehr scheinen die Kommentator*innen das Engagement für eine klimagerechte Welt als eine Art Freizeitbeschäftigung einzuordnen. Dabei sollte es ja offensichtlich sein, dass der Kampf gegen die Klimakrise nicht mit dem Besuch in einem Fitnesscenter gleichzusetzen ist, sondern viel mehr mit dem Einsatz in der ehrenamtlichen Feuerwehr gemein hat. Denn den Menschen das Gefühl zu geben, dass jemand zu Hilfe eilt, wenn das eigene Haus brennt, ist im Gegensatz zu einem dicken Bizeps gesellschaftlich wichtig. Genauso, wie es momentan wichtig ist, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit daran zu erinnern, endlich vehement gegen die Klimaerhitzung vorzugehen.
Was gemacht werden muss, ist Arbeit!
Deshalb: Es ist zwar freiwillig, sich dafür einzusetzen, dass die Fidschi-Inseln nicht untergehen, dass in den Hitzemonaten nicht jedes Jahr noch mehr alte Menschen sterben oder dass Milliarden von Koalas in Buschfeuern verbrennen. Trotzdem ist es Arbeit. Der Vorwurf „Geht doch erst mal arbeiten” ist haltlos. Denn die arbeiten schon. Einfach gratis.
Und sie sind nicht die Einzigen. Laut dem BFS kamen im Jahr 2016 auf 7.9 Milliarden bezahlte Arbeitsstunden nochmals 9.2 Milliarden unbezahlte Arbeitsstunden. Damit unsere Gesellschaft funktioniert, mussten diese genauso erbracht werden wie die bezahlten Stunden. Der grösste Teil dieser Gratisarbeit wird zur Betreuung von Kindern und Verwandten geleistet. Aber auch der Einsatz in Sportverbänden, karitativen Organisationen und Interessenverbänden wird hier mitgezählt. Wäre es nicht fair, wenn wir diese unbezahlte Arbeit gleichmässig über alle Mitglieder der Gesellschaft verteilen würden, statt dass sich die einen die gut bezahlten Jobs unter den Nagel reissen, während Mütter, Klimaaktivist*innen und sozial engagierte Menschen ausbrennen, weil sie all das übernehmen, was schlicht kein Geld abwerfen kann?
Witzigerweise könnte man mit vielen Leistungen, die von Aktivist*innen erbracht werden, durchaus einen Haufen Geld verdienen – würde man sie unter einem anderen Vorzeichen erbringen. Denn während die Klimastreikenden für das Verfassen ihrer Kommunikationsstrategien nichts verdienen und deshalb ihre Freizeit dafür einsetzen müssen, um doch noch ein paar Franken für die Krankenkassenrechnung zusammenzukriegen, sitzen auf der anderen Seite des gesellschaftlichen Spielfelds die Strategieberater*innen und Marketingmenschen des Energiekonzerns RWE[1] oder der Credit Suisse[2]. Sie können dieselben Leistungen in einem fürstlich bezahlten Arbeitsverhältnis erbringen. Die Freizeit bleibt ihnen, um sich zu erholen.
Klimaaktivist*innen haben hingegen weder einen Stundenlohn noch eine Pensionskasse, eine Krankentaggeldversicherung oder eine Unfallversicherung. Zusammengefasst: Ihre Ausgangslage ist richtig schlecht. Und dies, obwohl sie sich für ein Anliegen einsetzen, das uns alle betrifft. Denn auch der Chefstratege von RWE und die Starbankerin der Credit Suisse werden dereinst froh sein, wenn nicht alle Lawinenverbauungen der Schweiz wegen aufgetautem Permafrost erneuert werden müssen, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten.
Es bleibt die Frage, was dann keine Arbeit ist
Wir werden also alle etwas davon haben, wenn das Klima dank dem Einsatz der Klimastreikenden nicht vollends kollabiert. Die gesellschaftliche Stellung, in der die Aktivist*innen ihre Arbeit momentan verrichten müssen, ist jedoch mehr als prekär. Das ist nicht okay, denn sie leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Und das sollte auch dementsprechend goutiert werden. Vor allem wenn die Gegenseite, anders als die Klimastreikenden, lediglich für die Interessen privater Wirtschaftsplayer eintritt und ihr Personal easy mit ein paar Prozent des Profits finanzieren kann, den sie, wie im Fall von RWE oder der Credit Suisse, auf Kosten der Allgemeinheit erwirtschaftet hat. Die Frage bleibt, ob das, was dieses Personal macht, dann eigentlich noch Arbeit ist oder nicht. Denn Arbeit sollte nicht einfach das sein, was uns persönlich Geld einbringt. Sondern das, was die Gesellschaft braucht.
[1] Die RWE AG mit Sitz in Essen ist ein börsennotierter Energieversorgungskonzern und gehört weltweit zu den grössten CO2-Emittenten.
[2] Sowohl die Credit Suisse als auch die zweite Schweizer Grossbank, die UBS, investieren nach wie vor massiv in CO2-intensive Projekte. Laut einem Bericht von Greenpeace haben die zwei Schweizer Grossbanken im Jahr 2017 zusammen 12.3 Milliarden Dollar in fossile Energien investiert. Die dadurch geförderten Projekte sind für die Emission von 93.9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten verantwortlich. Das ist doppelt so viel, wie die ganze Schweiz in einem Jahr ausstösst.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 6 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 572 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 210 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 102 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?