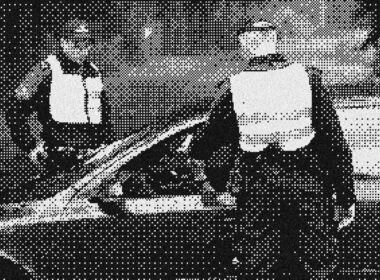In Deutschland laufen gerade Koalitionsverhandlungen zwischen den Grünen, der FDP und der SPD. Ein Thema, über das die drei Parteien sicherlich noch einige Stunden streiten werden, sind Verbote: Soll man benzinfressende SUVs verbieten? Sollte es eine Deadline für den Verkauf von erdölbetriebenen Autos geben? Braucht es ein Verbot für Inlandflüge oder ein Tempolimit auf der Autobahn?
Doch nicht nur der FDP stellen sich bei solchen Forderungen die Nackenhaare auf. Klimaverbote kommen bei vielen Leuten nicht gut an. Auch in der Schweiz schwebt Simonetta Sommaruga nach dem „Nein” zum CO2-Gesetz eine neue Vorlage vor, die ohne Verbote und Abgaben auskommt: „Die Bevölkerung möchte den Klimaschutz. Sie darf aber nicht das Gefühl haben, dass sie bestraft wird oder dass ihr alles verboten wird”, sagt die SP-Bundesrätin an der Presskonferenz zu den Eckwerten des neuen CO2-Gesetzes.
Verbote stossen allgemein auf wenig Sympathien. Viel netter findet man hingegen die Eigenverantwortung. Es ist deshalb wenig verwunderlich, dass sich diese im Klimaschutz durchgesetzt hat. Die Entscheidungen, mit dem Nachtzug anstatt mit dem Billigflieger nach Berlin zu reisen, auf Ökostrom umzustellen oder im Winter auf importierte Tomaten zu verzichten und stattdessen den regionalen Rosenkohl zu essen, werden so zu individuellen und freiwilligen Angelegenheiten. Man kann es tun oder eben auch nicht.
Auch für Firmen und Konzerne bleibt Klimaschutz weitgehend freiwillig. Sie dürfen für die Produktion von Fleisch, Keksen oder Schokolade weiterhin Sojabohnen, Palmöl und Kakao beziehen, für deren Anbau Regenwald gerodet wird. Dabei bräuchten wir diese Wälder dringend für die Neutralisation unserer Klimagase. Obwohl es der Gesellschaft eindeutig schadet, wird der Entscheid, es trotzdem zu tun weitgehend geduldet.
Ein anderes Beispiel dafür sind Fast-Food-Ketten: Es wäre angesichts der Klimakrise natürlich hilfreich, wenn diese den Verschleiss von Plastikgeschirr reduzieren würden. Denn durch deren Verbrennung landet der darin gespeicherte Kohlenstoff in Form von CO2 direkt in der Atmosphäre. Es zu tun oder eben nicht zu tun, liegt letztlich aber allein bei McDonalds und Co. Denn nicht nur klimafreundlich zu konsumieren, sondern auch klimafreundlich zu produzieren, ist freiwillig.
Sogar der internationale Rahmen des Klimaschutzes, das Pariser Klimaabkommen, basiert auf freiwilliger Selbstverpflichtung der Länder. Momentan befinden sich also Menschen, genauso wie Firmen und Staaten, in einer paradoxen Situation: Alle wissen, welches Verhalten einen positiven Einfluss auf die prekäre Situation dieser Welt hätte. Aber gleichzeitig steht es allen frei, sich klimaschädlicher zu verhalten.
Keine Verbote heisst Eigenverantwortung
Wer wie die FDP in Deutschland oder Umweltministerin Sommaruga keine Klimaverbote will, kommt nicht darum herum, sich genauer mit der Dynamik dieser Eigenverantwortung zu beschäftigen. Denn wenn wir Bezinautos, Kurzstreckenflüge oder SUVs nicht verbieten wollen, bleibt uns nicht viel anderes übrig, als die Menschen aufzufordern ihr Verhalten von sich aus anzupassen. Doch was aussieht wie Freiheit und Souveränität, hat auch eine düstere Seite – dazu später mehr.
Zuerst aber eine einfache Erkenntnis: Nicht alle haben dieselben Möglichkeiten, wenn es darum geht, die Welt vor dem Klimakollaps zu bewahren. In mindestens drei Punkten unterscheiden wir uns wesentlich voneinander. Erstens: Würden die CEOs der Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS beschliessen, auf Investitionen in die Förderung fossiler Energieträger zu verzichten, fiele diese Entscheidung um ein Vielfaches stärker ins Gewicht als mein individueller Entscheid, auf ein Ökostrom-Abo zu wechseln. Je grösser die Wirkung, die ein einzelner Mensch herbeiführen kann, desto grösser ist die Verantwortung dieser Person.
Zweitens haben nicht alle dieselben Möglichkeiten, zum Klimaschutz beizutragen. Wer sich bereits um drei Kinder und eine kranke Mutter kümmern muss, kann nicht auch noch jede Woche auf den Markt gehen, um das frische Biogemüse vom Bauernhof in der Region zu kaufen. Und drittens verlangt dasselbe Klimaengagement den Betroffenen je nach Lebensrealität mehr oder weniger ab.
Die Eigenverantwortung ist flexibel
An diesem dritten Punkt zeigt sich, dass das Konzept der Eigenverantwortung auch gute Seiten hat. Richtig umgesetzt, ist die Eigenverantwortung gar sozialer als Verbote und Regeln. Wieso? Die Eigenverantwortung erlaubt es einem, selbst zu entscheiden, was drin liegt und was nicht.
Einem Menschen mit chronischen Rückenschmerzen wird mehr abverlangt, wenn er auf ein klimaschädliches Auto verzichten soll als einem jungen und sportlichen Menschen. Reiche Leute können sich locker Bio-Demeter-Fairtrade Essen leisten, während dies bei Geringverdienenden viel schneller aufs Budget schlägt. Wer die ganze Familie auf einem anderen Kontinent hat, kann schwerer auf Flugreisen verzichten. Beim Konzept Eigenverantwortung können wir die Einschränkungen an die eigenen, individuellen Lebensumstände anpassen. Sie lässt den Menschen einen gewissen Spielraum.
Den Klimakollaps müssen wir trotzdem verhindern
Aber Achtung: Eigenverantwortung heisst nicht, dass einfach alle so viel oder so wenig Klimaschutz betreiben können, wie sie gerade möchten. Denn auch wenn es keine Verbote gibt: Das Problem, die Klimakatastrophe, muss ja trotzdem gelöst werden. Etwas „machen” müssen wir trotzdem alle – auch ohne Verbote. Der einzige Unterschied: In der Eigenverantwortung müssen sich alle selbst überlegen, wie viel man zur Lösung des Problems beitragen soll, kann oder muss.
Und genau das ist gefährlich. So besteht nämlich auch die Gefahr, dass alle zusammengezählt über die Stränge schlagen. Denn bei der Klimarechnung gibt es nicht nur den eigenen Beitrag und den Beitrag der anderen, sondern es gibt auch noch die Erde, die der gesamten Menschheit eine klare Obergrenze setzt: das planetarische Kompensationspotential.
Die Erde kann der Atmosphäre pro Jahr nämlich eine gewisse Menge an Klimagasen wieder entziehen. Damit die Menschheit die Erdatmosphäre langfristig nicht aus dem Gleichgewicht bringt, dürfen die Klimagasemissionen von allen zusammen nicht höher sein als dieses Kompensationspotential. Und das liegt bei 0.6 Tonnen CO2 pro Person und Jahr. So viel haut man bereits mit einem Flug von Zürich nach Istanbul und zurück raus.
Grundsätzlich liegen diese 0.6 Tonnen für jede:n drin, ohne dass es zum Kollaps kommt. Alle, die der Meinung sind, dass sie mehr brauchen, müssten theoretisch einen anderen Menschen finden, der so nett ist und sagt: „Ok, weil Klimaschutz für mich weniger anstrengend ist, kannst du einen Teil meiner Klimagase haben.” Passiert das nicht, wird es für uns alle schädlich. Denn dann lassen wir alle zusammen mehr Klimagase raus, als neutralisiert werden können. Und das führt zu Überschwemmungen, Tornados und Dürren.
Damit die Flexibilität der Eigenverantwortung nicht in gefährlichen Egotrips und damit in der gemeinschaftlichen Sprengung der planetarischen Grenzen endet, müssen sich also dauernd alle hinterfragen, ob sie bereits genug beisteuern oder ob es noch mehr braucht. Wobei Schweizer:innen wohl alle noch drauflegen müssen bei ihrem Einsatz. Denn der hiesige Durchschnitt liegt momentan bei 14 Tonnen pro Person und Jahr. Also dem 24-fachen vom dem, was drin liegen würde. Und das muss natürlich runter.
Angesichts dieser Zahlen ist eigentlich klar, dass die Menschen, die keine Familie in Australien haben, sicher nicht für einen Tauchtrip nach Melbourne fliegen. Es ist auch klar, dass Besserverdienende sich nichts anderes mehr in den Einkaufskorb legen sollten als Bio, Demeter und Fairtrade. Und es sollte eigentlich auch allen einleuchten, dass man auf ein Auto verzichtet, wenn es die Möglichkeit gibt, das Fahrrad zu nehmen.
Wieso?
Nur so bleibt genug übrig, für diejenigen, die das Klimapotential dringender brauchen. Nicht nur hier in der Schweiz oder in Deutschland, sondern vor allem auch in Ländern, die sich noch nicht so viel Wohlstand und Stabilität aufbauen konnten, wie wir Mitteleuropäer:innen.
In der Eigenverantwortung müssen also alle nicht nur permanent abschätzen, was insgesamt drin liegt, sondern auch ob das, was sie sich selber rausnehmen wollen tatsächlich angebracht ist. Theoretisch in Absprache mit allen anderen auf diesem Planeten. Das ist nicht nur anstrengend, sondern natürlich auch die totale Überforderung. Und das ist noch nicht einmal das grösste Problem.
Eigenverantwortung bestraft die Falschen
Denn eine andere Fehlfunktion der Eigenverantwortung ist so offensichtlich, dass man sie glatt übersehen könnte: Die Eigenverantwortung belohnt diejenigen, die das Falsche machen. Wer mit EasyJet nach Berlin düst, hat mehr Zeit für Sightseeing in der Hauptstadt. Wer den Haushalt oder die Firma nicht mit teurem Ökostrom füttert, hat mehr Geld. Unternehmen, die in den klimazerstörenden Kohleabbau investierten, erzielen hohe Gewinne. Alles ganz normale Klimasünden, die täglich begangen werden. Und dies, obwohl die Warnungen vor der Klimakatastrophe schon seit Jahrzehnten unüberhörbar sind. Aber eben: Etwas dagegen zu tun, ist freiwillig.
Und wer es nicht tut, hat mehr Geld, mehr Zeit und weniger Stress. Wieso soll man es dann machen? Es ist offensichtlich: Eigenverantwortung hat das Potential, diejenigen zu bestrafen, die das Richtige tun.
Das ist nicht nur unfair, sondern führt auch dazu, dass wir in Sachen Klima den Karren gerade ziemlich an die Wand fahren. Denn unter den momentanen Spielregeln profitieren diejenigen am meisten, die bis zu einem Verbot der Kurzstreckenflieger nicht auf den Zug umsteigen. Sie sparen am längsten und dementsprechend am meisten. Im aktuellen System profitieren die Firmen, die weiterhin Soja, Kaffee und Kakao verarbeiten, für deren Herstellung Regenwald gerodet wurde. Und so lange es freiwillig ist, ein Ökostrom-Abo zu machen, werden natürlich diejenigen am meisten sparen, die es nicht abschliessen.
Ein System, in dem man am meisten gewinnt, wenn man am längsten das Falsche macht, zementiert logischerweise das falsche Verhalten. Klare und verbindliche Vorgaben wären deshalb nicht nur fairer, sondern auch zielführender. Denn wer wählt schon freiwillig die für ihn schlechtere Variante?
Wer mitmacht, ist für verbindliche Regeln
Klimafreundliches Leben und Wirtschaften ist zumindest in der momentanen Übergangszeit zwischen dem fossilen und dem postfossilen Zeitalter anstrengend und teuer. Wäre dem nicht so, hätten schon lange alle umgestellt. Gerade deshalb ist es aber wichtig, dass wir uns gegenseitig darauf verlassen können, dass alle mitmachen und alle ihren Teil der Last tragen. Und dass der individuelle Beitrag nicht umsonst gewesen sein wird, weil der Egoismus der anderen das planetarische Potential trotzdem gesprengt hat.
Ein guter Freund, der nach wie vor nicht auf Flugreisen verzichtet, hat mir kürzlich folgendes gesagt: „Weisst du, wenn wir darüber abstimmen würden, ob wir Fliegen verbieten sollen, würde ich ‚Ja’ stimmen. Aber solange es alle anderen machen, habe ich keine Lust alleine einzustecken.”
Genau deshalb wären klare Regeln und Verbote eigentlich für alle besser als die Eigenverantwortung. Zumindest für alle, die ihren Teil leisten wollen. Für die anderen sind sie natürlich einschränkend. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb Klimaverbote sowohl in der Schweiz, wie auch in Deutschland einen schlechten Stand haben: Wenn alle nach wie vor das tun, was eigentlich verboten werden müsste, ist es logisch, dass Verbote nicht sonderlich gut ankommen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 23 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1456 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 805 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 391 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?