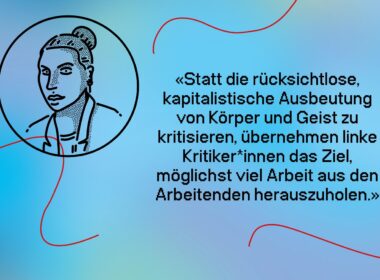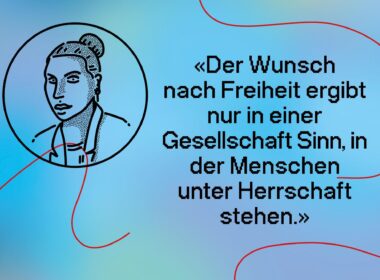Wir überschätzen manchmal, wie viel der Staat eigentlich tut, schrieb der Anthropologe und Anarchist David Graeber in seinem Buch „The Utopia of Rules” von 2015. Oft sei der Staat nichts weiter als eine bürokratische Fassade.
Im ländlichen Madagaskar, wo Graeber in den 1980er-Jahren arbeitete, gab es keine Polizei und keine Ämter. Niemand kontrollierte, ob Bauvorschriften und Verkehrsregeln eingehalten wurden. Der Staat erfüllte hier keine Funktion mehr. „Aber alle sprachen über die Regierung, als ob sie wirklich existierte, in der Hoffnung, dass niemand Aussenstehendes etwas bemerkt. Sonst könnte irgendein Amt in der Hauptstadt noch auf die Idee kommen, sich einzumischen.”
An diese Anekdote musste ich am 21. März denken, als der „Tierquäler von Hefenhofen” vom Arboner Bezirksgericht weitgehend freigesprochen wurde. In der Schweiz gibt es ein staatliches Tierschutzsystem, aber wir überschätzen manchmal, wie viel es eigentlich tut. Vieles daran ist nur Fassade.
Aber alles der Reihe nach.
Was im „Fall Hefenhofen” passiert ist
Im Juli 2017 erhielt das Thurgauer Veterinäramt schlimme Fotos misshandelter Tiere, darunter auch abgemagerte, sichtlich kranke und teils tot daliegende Pferde. Die Aufnahmen stammten von einer Ex-Mitarbeiterin des Züchters und Landwirts Ulrich K., einem vorbestraften Gewalttäter gegen Tiere und Menschen. In früheren Jahren wurde er zum Beispiel gewalttätig gegen einen Kontrolleur des Veterinäramts. Ein andermal tötete er ein Fohlen mit einem Bolzenschussgerät, als das Amt es ihm wegnehmen wollte.
Schaut einmal zum Fenster raus, wahrscheinlich seht ihr bald ein Tier. Sie sind die Mehrheit der Bevölkerung. Doch in der Schweizer Medienlandschaft werden sie meist ignoriert. Animal Politique gibt Gegensteuer. Nico Müller schreibt über Machtsysteme, Medien, Forschung und Lobbyismus. Und denkt nicht, es gehe immer „nur” um Tiere. Ihre Unterdrückung hängt oft mit der Unterdrückung von Menschen zusammen. Animal Politique macht das sichtbar.
Nico Müller hat den Doktor in Tierethik gemacht und arbeitet an der Uni Basel. Daneben setzt er sich politisch für Tierschutz und ‑rechte ein, besonders mit dem Verein Animal Rights Switzerland.
Etwa zwei Wochen nachdem das Amt die neuen Tierquälerei-Fotos erhalten hatte, veröffentlichte der Blick eine Auswahl von ihnen – und plötzlich wurden Behörden und Politik tätig. In einer Hauruck-Aktion wurden 93 Pferde, 50 Kühe, vier Lamas und 80 Schweine, Ziegen und Schafe vom Hof geräumt. Konkret hiess das für viele von ihnen, dass sie eingeschläfert, notgeschlachtet oder in die weitere Nutzung versteigert wurden. Zwei Drittel der Kühe wurden zudem laut einem Kantonssprecher „aus wirtschaftlichen Gründen” getötet.
Genau diese Hauruck-Aktion hat sich nun für die Staatsanwaltschaft gerächt. Denn laut dem Bezirksrichter hat man die eigentliche Tierquälerei nie richtig dokumentiert – weder nach den ersten Fotos noch bei der Hofräumung. Was an Beweisen vorliege, sei juristisch nicht verwertbar. Ulrich K. wurde in den Hauptanklagepunkten freigesprochen und erhielt sogar eine Genugtuung von 6’000 Franken – eine Ohrfeige an die Staatsanwaltschaft. Diese hat angekündigt, Berufung einzulegen.
Wie auch immer der Fall ausgehen wird: Das juristische Hin und Her erweckt den Eindruck, dass der Tierschutzvollzug im Thurgau komplett desorganisiert ist.
Was ist da bloss los? Ich frage bei einer Juristin nach.
Vollzug funktioniert nirgends so richtig
„Fehler und Überforderung sehen wir in den meisten Kantonen in gewissem Ausmass”, sagt mir Vanessa Gerritsen von der Stiftung für das Tier im Recht. Kaum ein Kanton sei im Tierschutzvollzug konsequent genug.
„In vielen Kantonen arbeiten zum Beispiel keine im Tierschutzrecht ausgebildeten Personen bei Polizei oder Staatsanwaltschaft”, sagt Gerritsen. So würden Beamte mit Tierschutzermittlungen beauftragt, die sich mit den komplexen Vorschriften nicht auskennen – und die sich auch oftmals nicht besonders dafür interessieren. „Fehler sind praktisch vorprogrammiert.” Und selbst wo es Fachstellen gäbe, würden diese innerhalb von Polizei und Staatsanwaltschaft nicht immer einbezogen.
Wohin das führt, kann man in einem Buch derselben Stiftung nachlesen. Demnach verfolgte der Staat in den letzten dreissig Jahren zwar immer mehr Tierschutz-Straffälle, statt sie direkt unter den Teppich zu wischen. Aber die Dunkelziffer sei nach wie vor hoch und die ausgesprochenen Strafen überaus mild. Wer überhaupt wegen eines Tierschutzdelikts verurteilt werde, erhalte in der Schweiz meist nur eine Busse und selbst in schweren Fällen von Tierquälerei häufig nur eine Geldstrafe.
Zudem, so erklärt ein weiteres Buch der Stiftung, unterlaufen den Behörden immer wieder „teilweise eklatante juristische Fehler – meist zugunsten der Täter”. Der Thurgau ist also keineswegs der einzige Kanton, wo für die Umsetzung des Tierschutzrechts die Strukturen und Kompetenzen fehlen.
Aber auch das ist nicht das einzige Problem.
Tierschutzrecht mit paradoxem Auftrag
Das Stichwort „Behördenversagen” dominiert die mediale Diskussion über den Fall Hefenhofen. Die NZZ schreibt etwa über den „Staat als Dilettant”. Von einem möglichen Versagen der Justiz liest man hingegen kaum. Die meisten Journalist*innen scheinen die Meinung des Bezirksgerichts unkritisch zu übernehmen, dass die Beweise im Fall Hefenhofen allesamt nicht verwertbar sind.
Bei einem digitalen Austauschtreffen von Tierschützer*innen – darunter auch Jurist*innen – höre ich den gegenteiligen Konsens: „Völlig überrissene Ansprüche” habe das Gericht gestellt. „Wie sollen wir denn Tierquälerei beweisen, wenn nicht einmal Fotos zählen?!” Man spekuliert, der Richter habe den Behörden womöglich einen Denkzettel verpassen wollen, weil sie bereits in früheren Fällen nicht nach seinen Ansprüchen arbeiteten.
Vor lauter Behörden- und Justizkritik geht jedoch eines unter: Wenn kein Kanton ein Gesetz so richtig umsetzen kann, ist ein Teil des Problems vielleicht auch das Gesetz.
Grundsätzlich fusst das Schweizer Tierschutzrecht auf der Annahme, dass Menschen Tiere ausbeuten dürfen, solange sie gewisse Grenzen der Grausamkeit nicht überschreiten. Es soll zum Beispiel erlaubt sein, en masse Fleisch, Eier und Milch zu produzieren – auch auf Kosten des Tierwohls, solange die Gewalt auf das wirtschaftlich Nötige beschränkt bleibt.
So verlangt das Tierschutzgesetz nur, dass das Wohlergehen der Tiere sichergestellt wird, „soweit es der Verwendungszweck zulässt”. Man darf also Mutterkühe von ihrem Nachwuchs trennen, Hühner in riesigen Gruppen ohne Sozialstruktur halten, Schweine in CO2-Kammern unter Erstickungspanik zusammenbrechen lassen und so weiter. Alles normal, alles legal. Der Verwendungszweck geht vor.
Der Auftrag des Tierschutzrechts ist damit paradox: Es soll Tiere schützen, dies aber nur innerhalb eines Produktionssystems, das auf ihrem Leiden und Sterben beruht. Der Staat soll eine Grenze durchsetzen zwischen illegaler Misshandlung, die unter Strafe steht, und der legalen Misshandlung, die zur Tierindustrie selbstverständlich dazugehört.
Kein Wunder, ist so ein paradoxer Auftrag in der Praxis schwer umzusetzen.
Wie geht Systemverbesserung?
Es gibt viele Ansätze, wie man das Vollzugssystem im Thurgau und anderswo verbessern könnte. Als ich den Verein Global Animal Law für Inputs anfrage, erhalte ich umgehend ein dreihundertseitiges Gutachten voller Vorschläge.
Man könnte zum Beispiel Weiterbildungen durchführen, die Kommunikation zwischen verschiedenen Behörden verbessern und Fachstellen für den Tierschutz einrichten. Man könnte auch grösser denken und dem gemeinnützigen Tierschutz ein Verbandsbeschwerderecht geben, analog zum Umweltschutz. Oder man könnte ein unabhängiges Amt einführen, das es im Kanton Zürich früher einmal gab: die „Rechtsanwältin für Tierschutz in Strafsachen”.
Klingt alles gut, ich bin dafür. Wir sind so weit von einem funktionierenden Tierschutzsystem entfernt, dass wir experimentieren müssen. Doch ob Hefenhofen hilft, dafür den politischen Willen zu schaffen, ist fraglich. Womöglich hat der sensationelle Fall sogar eine unnötig hohe Messlatte gesetzt, welche Tierquälerei unsere Aufmerksamkeit verdient. Über zwei andere Fälle – einer im Kanton Fribourg und einer im Rheintal – wurde im März nur ganz am Rande berichtet. Von einer Grundsatzdiskussion über den Tierschutz in der Schweiz fehlt bisher jede Spur.
Und ich muss zugeben: Als Tierrechtler bin ich pessimistisch, wie viel wir allein durch Verbesserungen am bestehenden Tierschutzsystem erreichen können. Das Tierschutzgesetz ist fundamental fehlkonzipiert und heisst die meiste Gewalt an Tieren gut. Da bringt auch der strengste Vollzug nicht viel.
Tierleid nicht aktiv fördern
Um nachhaltig etwas zu verbessern, müssen wir nicht nur beim Tierschutz ansetzen, wo der Staat weitgehend Fassade ist. Wir müssen auch dort ansetzen, wo der Staat tatsächlich etwas tut und Einfluss darauf nimmt, was mit Tieren geschieht.
Das tut er zum Beispiel über Subventionen. Der Bund gibt massive Fehlanreize, die den Konsum und die Produktion tierischer Lebensmittel übermässig fördern, wie neulich eine Studie von Vision Landwirtschaft aufzeigte. Der Schweizer Staat ist also nicht nur zu passiv im Tierschutz, er fördert auch aktiv tierschädliches Verhalten.
Zufällig just am Tag der Urteilsverkündung traf ich mich mit Franziska Herren, dem Kopf der Trinkwasser-Initiative. Mit einer neuen Initiative wird Herren fordern, dass genau die erwähnten Fehlanreize behoben werden. „Wenn wir Tiere wirklich schützen wollen, müssen wir viel weniger Fleisch und mehr Pflanzen essen”, sagt sie mir. Ich bin genau ihrer Meinung.
Käme Herrens neue Initiative durch, würde die tierische Landwirtschaft schrumpfen, die pflanzliche wachsen. So gäbe es auch weniger Nährboden für das Elend von Tieren und Menschen, das im Fall Hefenhofen sichtbar wurde. Der nächste Ulrich K. wäre dann vielleicht nur ein renitenter Ackerbohnenbauer.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 32 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1924 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1120 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 544 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?