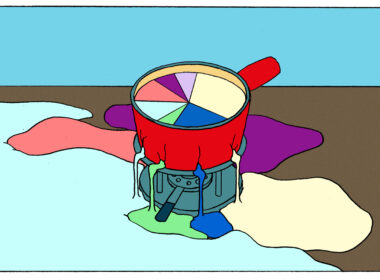Das geheime
Dokument im
Abstimmungskampf
Das geheime
Dokument im
Abstimmungskampf
Mehr Geld für Frontex: Das beschlossen die Schweizer Stimmbürger*innen im Mai 2022. Eine geheime Infonotiz zeigt nun: Die Bundesverwaltung hielt brisante Informationen zurück. Derweil gehen die Menschenrechtsverletzungen an den EU-Aussengrenzen weiter.
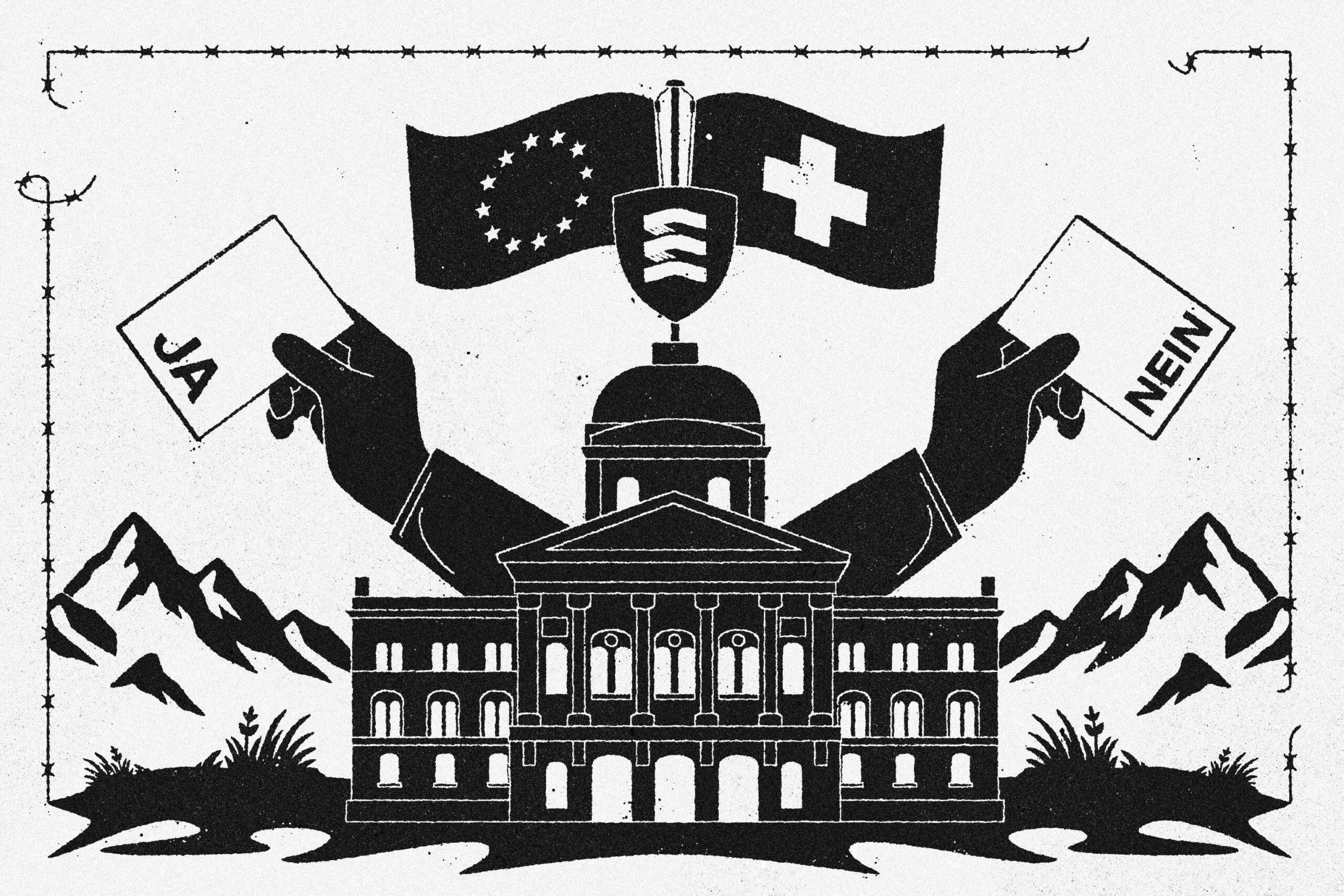
Am 4. April 2022 ist der Abstimmungskampf um die Schweizer Frontex-Finanzierung in vollem Gange. An diesem Tag schickt Christian Bock eine vertrauliche Infonotiz an Bundesrat Ueli Maurer. Er habe soeben den Bericht der EU-Antikorruptionsbehörde über Missstände bei der Europäischen Grenzschutzagentur gelesen: „Der Bericht ist für die Medien und die Frontex-Gegner gerade auch im Zusammenhang mit der Abstimmung am 15. Mai 2022 von grossem Interesse”. Bock ist zu dem Zeitpunkt Direktor des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit, der Schweizer Schnittstelle zu Frontex.
Trotz des genannten öffentlichen Interesses hielt der Bund den Inhalt des Berichts unter Verschluss. Währenddessen versprach Ueli Mauer, dass die Schweiz durch ihre Beteiligung an Frontex die Grundrechtslage an den europäischen Aussengrenzen verbessern könne. Was war dieses Versprechen wert?
Nach mehrjähriger Verhandlung erhielt das WAV Recherchekollektiv über das Öffentlichkeitsgesetz Einsicht in über 1000 Seiten Dokumente zur Schweizer Mitarbeit bei Frontex. Diese zeigen: Schweizer Frontex-Beamt*innen sind bis heute dort im Einsatz, wo systematisch Menschenrechte verletzt werden. Und: Trotz hoher Geldbeiträge hat die Schweiz wenig Mitspracherecht.
Die Frontex-Befürworter*innen und die Behörden sagten im Abstimmungskampf zum Frontex-Referendum, sie wollen die Agentur von innen heraus verbessern. Gelingt das tatsächlich? Das untersuchen wir in dieser vierteiligen Rechercheserie.
Artikel 1: Im Abstimmungskampf
Eine geheime Infonotiz zeigt: Die Bundesverwaltung hielt brisante Informationen zurück. Ein Blick auf die damaligen Versprechen und die Situation heute wirft Fragen auf. Wurde die Debatte unvollständig geführt?
Artikel 2: Im Ausseneinsatz
Schweizer Beamt*innen stehen an den Grenzen Europas im Einsatz – dort, wo Menschenrechte systematisch verletzt werden. Doch ihre Einsatzberichte erwähnen keine Verstösse. Wie kann das sein?
Artikel 3: Im Verwaltungsrat
Die Schweiz zahlt Hunderte Millionen an Frontex, hat aber kaum Mitspracherecht. Warum akzeptiert sie diesen Deal? Und: Will sie überhaupt mehr Einfluss?
Artikel 4: Am Scheideweg
Laut Menschenrechtsaktivist Amadou M’Bow ist es unmöglich, Frontex zu reformieren. Wie weiter?
Die „No Frontex”-Abstimmung
Am 15. Mai 2022 stimmte die Schweiz über ihre Beteiligung bei der EU-Grenzschutzagentur Frontex ab. Das Resultat war erdrückend: Über 70 Prozent der Stimmbürger*innen wollten die Frontex-Gelder von damals 14 Millionen auf 61 Millionen jährlich aufstocken und auch die personelle Unterstützung bis 2027 ausbauen.
Dem ging ein ungewöhnlicher Abstimmungskampf voraus: Aktivist*innen und Basisorganisationen rund um das Migrant Solidarity Network führten als „No Frontex”-Referendumskomitee eine grosse Kampagne. Die Parteien hielten sich dabei auffällig zurück.
Die Frontex-Gegner*innen warnten: Wer Ja sagt zu Frontex, macht sich mitschuldig an Menschenrechtsverletzungen.
Die Kritik rund um Frontex befand sich zu diesem Zeitpunkt europaweit auf einem Höchststand. Zahlreiche Berichte von Geflüchteten, Nichtregierungsorganisationen und Medien brachten die Agentur mit schweren Menschenrechtsverstössen in Zusammenhang: Frontex sei systematisch an illegalen Pushbacks von Menschen auf der Flucht beteiligt und habe eine Führungsriege, die die Aufklärung von Missständen aktiv verhindere. Die EU-Kommission leitete eine Untersuchung ein.
Erstaunlich ruhig blieb es in der ganzen Debatte aus der Ecke der verantwortlichen Behörde, dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit.
Die Schweiz unterstützt Frontex nicht nur finanziell, sondern auch mit Personal: Sie schickt seit 2009 Grenzbeamt*innen an die EU-Aussengrenzen. Zudem sitzt sie mit zwei Vertreter*innen im Frontex-Verwaltungsrat, dem Führungsgremium der Agentur.
Diese Beteiligung sei aus zwei Gründen wichtig, argumentierten die Frontex-Befürworter*innen im Abstimmungskampf. Trage die Schweiz den Ausbau nicht mit, falle man wegen der sogenannten Guillotine-Klausel aus dem Schengen und Dublin Abkommen. Und: Man könne sich aus dem Innern der Agentur für den Schutz der Menschenrechte einsetzen. „Wir engagieren uns im Sinne der Rechtssicherheit und der Menschenrechte”, sagte Bundesrat Maurer in der Abstimmungsarena. Dieses Argument vertrat etwas überraschend auch die Operation Libero und forderte Verbesserungen – herbeigeführt von der Schweiz.
Erstaunlich ruhig blieb es in der ganzen Debatte aus der Ecke der verantwortlichen Behörde – dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), das bis im Januar 2022 Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hiess. Das BAZG stellt die beiden Verwaltungsräte bei Frontex und schickt Schweizer Grenzschutzbeamt*innen an die Aussengrenzen. Im Abstimmungskampf traten Vertreter*innen der Behörde kaum in Erscheinung. Doch hinter den Kulissen war das BAZG durchaus aktiv, wie die vertrauliche Infonotiz an Ueli Maurer zeigt, die wir über das Öffentlichkeitsgesetz einsehen konnten.
Die Informationslücke
Die Infonotiz von BAZG-Direktor Bock an Bundesrat Maurer macht klar, wie schwerwiegend die Missstände sind, die der Bericht der EU-Antikorruptionsbehörde (OLAF) aufdeckt. Die Notiz hält fest,
- dass klare Anzeichen für ernsthaftes Fehlverhalten von drei hochrangigen Mitarbeitenden der Agentur bestehen und dass sowohl OLAF als auch das BAZG disziplinarische Massnahmen fordern.
- dass Personen aus dem Frontex-Verwaltungsrat versucht haben, Menschenrechtsverletzungen zu vertuschen und dass sie die Arbeit des Grundrechtsbeauftragten von Frontex behindert haben.
- dass die stellvertretende Schweizer Frontex-Verwaltungsrätin den Bericht am 7. März 2022 in Brüssel gelesen hat.
- dass der OLAF-Bericht für die Medien und Frontex-Gegner*innen gerade auch im Hinblick auf die Abstimmung am 15. Mai 2022 von grossem Interesse ist. Da der Prozess im Frontex-Verwaltungsrat jedoch noch läuft – unter anderem war eine Anhörung der betroffenen Personen geplant –, kann dieser nicht veröffentlicht werden.
Der geheimgehaltene Bericht hatte Konsequenzen: Der damalige Frontex-Direktor Fabrice Leggeri kam der Forderung nach disziplinarischen Massnahmen zuvor und trat noch Ende April zurück. Heute ist Leggeri Europaabgeordneter für die rechtsextreme Partei Rassemblement National.
Dem WAV Recherchekollektiv und das Lamm liegen neben der vertraulichen Infonotiz auch die interne Sprachregelung vor, die die öffentliche Kommunikation der Behörden zum Thema regelt. Diese erwähnt zwar den OLAF-Bericht, schweigt aber dazu, welch katastrophales Zeugnis dieser Frontex ausstellt – und damit die vorangegangenen Vorwürfe amtlich bestätigt: Frontex sei aktiv an illegalen Pushbacks beteiligt, vertusche diese systematisch und hindere das interne Grundrechtsbüro an der Aufklärung.
Ein besonders gravierender Fall ereignete sich am 10. April 2020, als Frontex mehrere Boote mit insgesamt 250 Geflüchteten sichtete, die maltesischen Behörden jedoch tagelang nicht eingriffen und schliesslich einen Teil der Menschen nach Libyen zurückdrängten – 12 Menschen starben. Fünf Körper wurden im Boot gefunden, sieben weitere Personen ertranken. Frontex klassifizierte den Vorfall bewusst falsch, um eine Untersuchung durch das Grundrechtsbüro zu vermeiden.
Die Schweizer Öffentlichkeit erfuhr erst dank einem Leak vom OLAF-Bericht. Der Abstimmungskampf war da schon lange vorbei.
Ebenso unerwähnt bleibt in der Sprachregelung, dass es sich bei vielen der untersuchten Fälle um Menschenrechtsverstösse in Regionen handelt, in denen auch Schweizer Frontex-Beamt*innen im Einsatz waren. Oder dass die Schweiz mit zwei Verwaltungsrät*innen in jenem Gremium sitzt, das vom Bericht starke Kritik einstecken muss. Marco Benz, einer ebenjener Verwaltungsräte, beteuerte Mitte April an einer Podiumsdiskussion: „Frontex nimmt den Schutz der Grundrechte sehr ernst.” Was die WOZ Monate später nur vermutete, wird mit der vorliegenden Infonotiz klar: Maurer und die Verwaltung wussten Bescheid. Aber schwiegen bewusst.
Was war da los? Wäre es angesichts des Zeitpunkts nicht möglich, oder sogar nötig gewesen, die Öffentlichkeit über den Inhalt der Untersuchung zu informieren? Diese erfuhr erst dank einem Leak vom 129-Seiten langen OLAF-Bericht. Dieser wurde im Sommer 2022 dem Spiegel, Lighthouse Reports und Frag den Staat zugespielt und im Oktober in zahlreichen europäischen Medien veröffentlicht. Der Abstimmungskampf war da schon lange vorbei.
Die SP Schweiz sagt heute auf Anfrage: „Es wiegt schwer, dass unter Alt-Bundesrat Ueli Maurer innerhalb des Departements abstimmungsrelevante Informationen unterdrückt wurden.” Auch die Grünen betonen, dass gerade bei Volksabstimmungen alle relevanten Tatsachen der Bevölkerung unterbreitet werden müssten, sofern sie veröffentlicht werden dürfen. Gesicherte Hinweise über gravierende Missstände und Fehlverhalten, die im Zusammenhang mit dem Geschäft stehen, gehörten hier dazu.
Unterstütze unabhängige Recherchen.
Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!
Das BAZG will von der Kritik nichts wissen: Der OLAF-Bericht sei ein klassifiziertes Dokument und die Haltung der Schweiz sei im Rahmen der Möglichkeiten kommuniziert worden. Die Rolle der Bundesbehörde beschränke sich auf sachliche und ausgewogene Erläuterungen zur Vorlage. Die Frage, ob das BAZG wegen seiner zentralen Rolle aktiver hätte an der Debatte teilnehmen sollen, lässt die Behörde weitgehend unbeantwortet.
„Diese Infonotiz so kurz vor der Abstimmung ist in der Tat brisant”, sagt Silvano Möckli, emeritierter Professor für Politikwissenschaften an der Universität St. Gallen und Experte für Abstimmungsfragen. Doch eine rechtliche Pflicht, darüber zu kommunizieren, gebe es nicht. Und überhaupt: Angesichts des deutlichen Abstimmungsergebnisses hätte eine Veröffentlichung das Resultat kaum geändert. Relevant sei aber die Frage, was man daraus lerne.
1) Vertrauliche Infonotiz von Zolldirektor Christian Bock an Ueli Maurer: In dieser informiert Bock Maurer am 4. April 2022 über den Inhalt des OLAF-Berichts.
2) Sprachregelung zum OLAF-Bericht: In dieser steht nichts über die in der Untersuchung festgestellten, schwerwiegenden Missstände innerhalb von Frontex.
3) Sprachregelung zu früheren Untersuchungen bei Frontex: Bereits im Juli 2021 liefen Untersuchungen gegen Frontex. In der Kritik stand bereits damals der umstrittene Direktor Fabrice Leggeri. Trotzdem hielt die Schweiz bis zu dessen Rücktritt Ende April 2022 an ihm fest.
Anhaltende Gewalt
Aus der Vergangenheit lernen und aktiv Verbesserungen anstreben – das wiederholten die Frontex-Befürworter*innen im Abstimmungskampf mantraartig. Doch bis heute reisst die Kritik an Frontex nicht ab, in Menschenrechtsverletzungen verstrickt zu sein.
Die Agentur solle Leben retten, anstatt seine Infrastruktur für das illegale Abfangen von Flüchtenden auf dem zentralen Mittelmeer zu nutzen. Das fordert Human Rights Watch mit ihrer im April lancierten Kampagne #WithHumanity. Frontex überwacht das Mittelmeer mit einer riesigen Flotte, die anstatt aus Schiffen zunehmend aus Flugzeugen und Drohnen besteht. Wenn sie Boote auf dem Weg nach Europa entdeckt, dann rettet sie diese nicht, sondern informiert aus der Luft meist die aus bewaffneten Milizen hervorgegangene libysche „Küstenwache”. Diese fängt die Boote ab – oft mit Gewalt, manchmal gar mit Schusswaffen – und bringt die Menschen zurück nach Libyen. Dort drohen ihnen Gefängnis, Folter und sexualisierte Gewalt. So dokumentieren es Human Rights Watch und die Schweizer Rechercheagentur Border Forensics, oder die Seenotrettungsorganisation Sea Watch seit vielen Jahren.
„Die Gewalt hat dort, wo Frontex aktiv ist, zugenommen.”
Lena Karamanidou, Migrationsforscherin und Frontex-Expertin
Im Fokus der Kritik stehen nicht nur die hohe See, sondern auch die Landgrenzen – besonders im Dreiländereck Türkei-Griechenland-Bulgarien. Und sie kommt nicht nur von zivilgesellschaftlichen Organisationen, sondern auch aus den eigenen Reihen: So empfahl der Grundrechtsbeauftragte von Frontex, die Tätigkeiten in Griechenland entweder auszusetzen oder ganz einzustellen. Dies, weil es immer wieder zu heftiger Gewalt von griechischen Grenzwächter*innen gegenüber migrierenden Menschen komme. Besonders die Grenze am Fluss Evros ist berüchtigt: Hunderte Berichte schildern, wie Patrouillen Flüchtende aufgreifen, teils schwer misshandeln und anschliessend über den Fluss zurückdrängen.
Ähnliche Berichte gibt es aus Bulgarien, wo die Schweiz ebenfalls mit Personal stationiert ist: Flüchtende werden von bulgarischen Grenzbeamt*innen nackt ausgezogen, ausgeraubt, tagelang eingesperrt, gezwungen, zurück in die Türkei zu schwimmen, mit Hunden angegriffen und als „Taliban” beschimpft. Das berichtet die Investigativplattform BIRN im Februar 2024.
Im Rahmen des Frontex-Ausbaus wurden neu 40 Grundrechtsbeobachter*innen eingestellt, die die Arbeit des Grundrechtsbeauftragten unterstützen. Auch weitere Massnahmen zum Grundrechtsschutz hat die Agentur ergriffen. Haben sie keine Wirkung gezeigt? „Nicht wirklich”, sagt Lena Karamanidou, Migrationsforscherin und Frontex-Expertin. „Die Gewalt besteht weiter. Und sie hat dort, wo Frontex aktiv ist, gar noch zugenommen.”
Karamanidou arbeitet bei der Nichtregierungsorganisation Border Violence Monitoring Network, die Grenzgewalt dokumentiert und sich gegen Straflosigkeit an den EU-Aussengrenzen einsetzt. Sie spricht von einem System der stillen Aufgabenteilung: Die Präsenz von Frontex legitimiere und schütze das Vorgehen der lokalen, beispielsweise griechischen Grenzschutzbehörden. Diese wiederum führten die Pushbacks und Angriffe aus. Karamanidous Haltung ist klar: Würde sich Frontex wegen der Menschenrechtsverletzungen zurückziehen, würde dies eine starke Botschaft senden. „Denn die jahrelange Präsenz hat die Situation ja nicht verbessert”, sagt die Forscherin insbesondere mit Blick auf die Evros-Region.
Kritik an der Schweiz
Sowohl Befürworter*innen wie die Operation Libero als auch Gegner*innen des Frontex-Ausbaus – etwa die SP und die Grünen – kritisieren diese Zustände. Und sie alle sagen auf Anfrage, dass die Schweiz für die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen mitverantwortlich sei. Sie müsse ihre Verantwortung wahrnehmen und sich aktiv für Verbesserungen einsetzen.
Zu den anhaltenden Verstössen wiederholt das BAZG auf Anfrage, was es seit Jahren sagt: Probleme könnten nur erkannt werden, wenn man vor Ort präsent sei. Die Zusammenarbeit mit den Einsatzstaaten und deren Behörden sei für die Einhaltung der Grundrechte zentral. Auf die Frage nach der Mitverantwortung der Schweiz schweigt die Behörde. Nur so viel: Die Schweizer Vertreter*innen von Frontex würden sich im Verwaltungsrat konsequent für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen.
Bis heute ist die Schweiz in Bulgarien und Griechenland mit zahlreichen Grenzschutzbeamt*innen im Ausseneinsatz. Was machen diese genau? Setzen sie sich für die Menschenrechte ein? Können sie das überhaupt? Im zweiten Artikel der Serie blicken wir auf die Schweizer Frontex-Einsätze in der Evros-Region.
Diese Recherche wurde durch zweckgebundene Beiträge vom Europäischen Bürger*innen Forum (EBF) und Solidarité sans frontières (SOSF) unterstützt. Die Unterstützung ermöglichte die Auswertung von den über 1000 Seiten Dokumenten, die via Öffentlichkeitsprinzip offengelegt werden konnten. Die Artikelserie wurde redaktionell unabhängig nach journalistischen Standards produziert. Jegliche Einflussnahme auf den redaktionellen Prozess ist laut Vereinbarung ausgeschlossen. Die Recherche wie auch die redaktionelle Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit zwischen dem WAV Recherchekollektiv und das Lamm.
Newsletter
Einmal im Monat alle Artikel von das Lamm in deiner Mailbox!
Telegram-Kanal
All unsere frisch publizierten Artikel landen direkt in unserem Telegram-Kanal. Hier geht’s zum Kanal.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 60 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 3380 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 2100 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 1020 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?