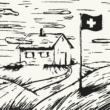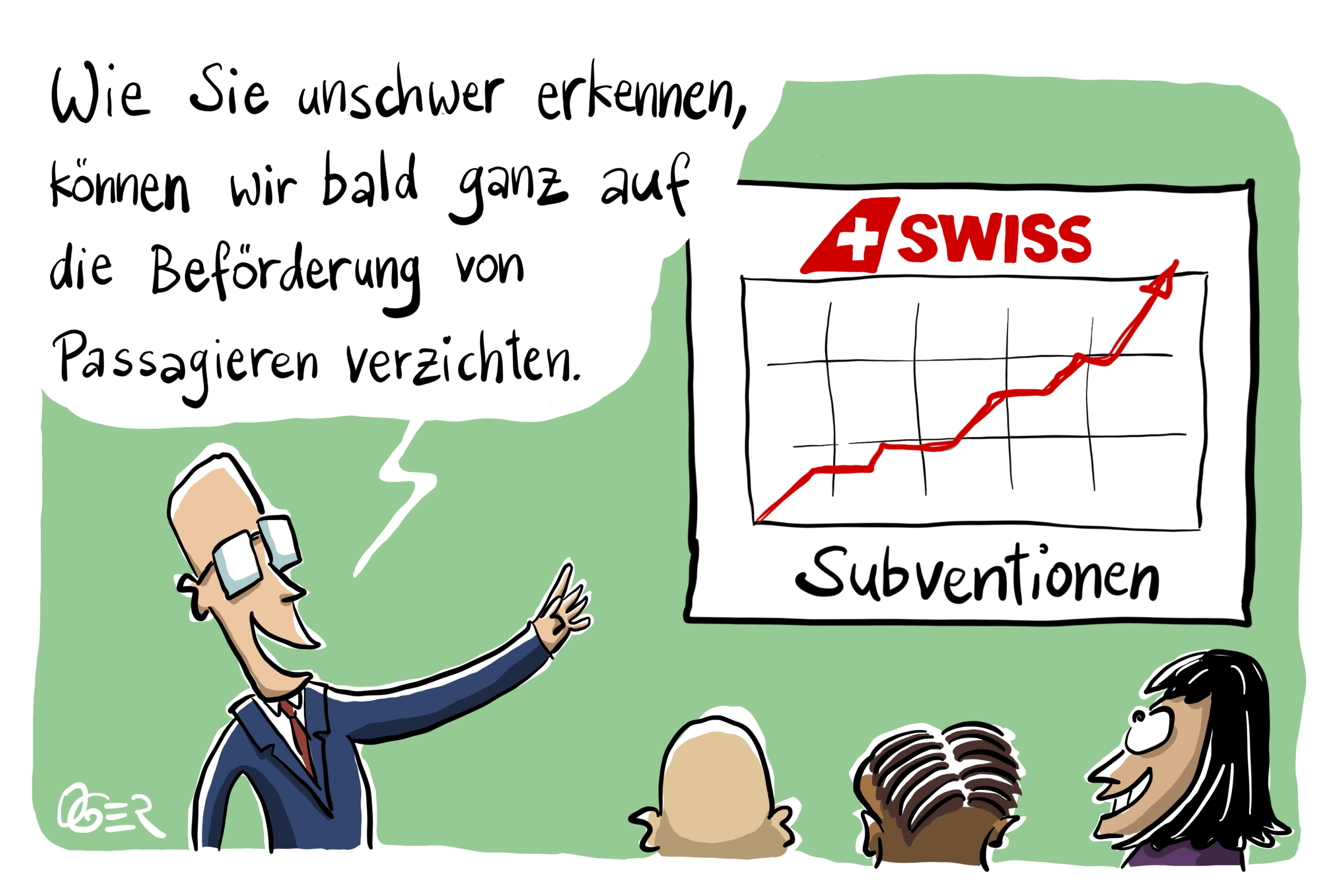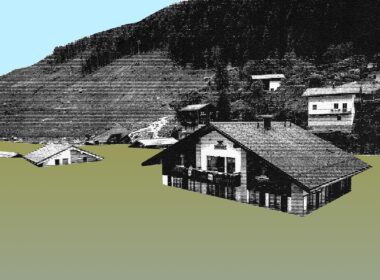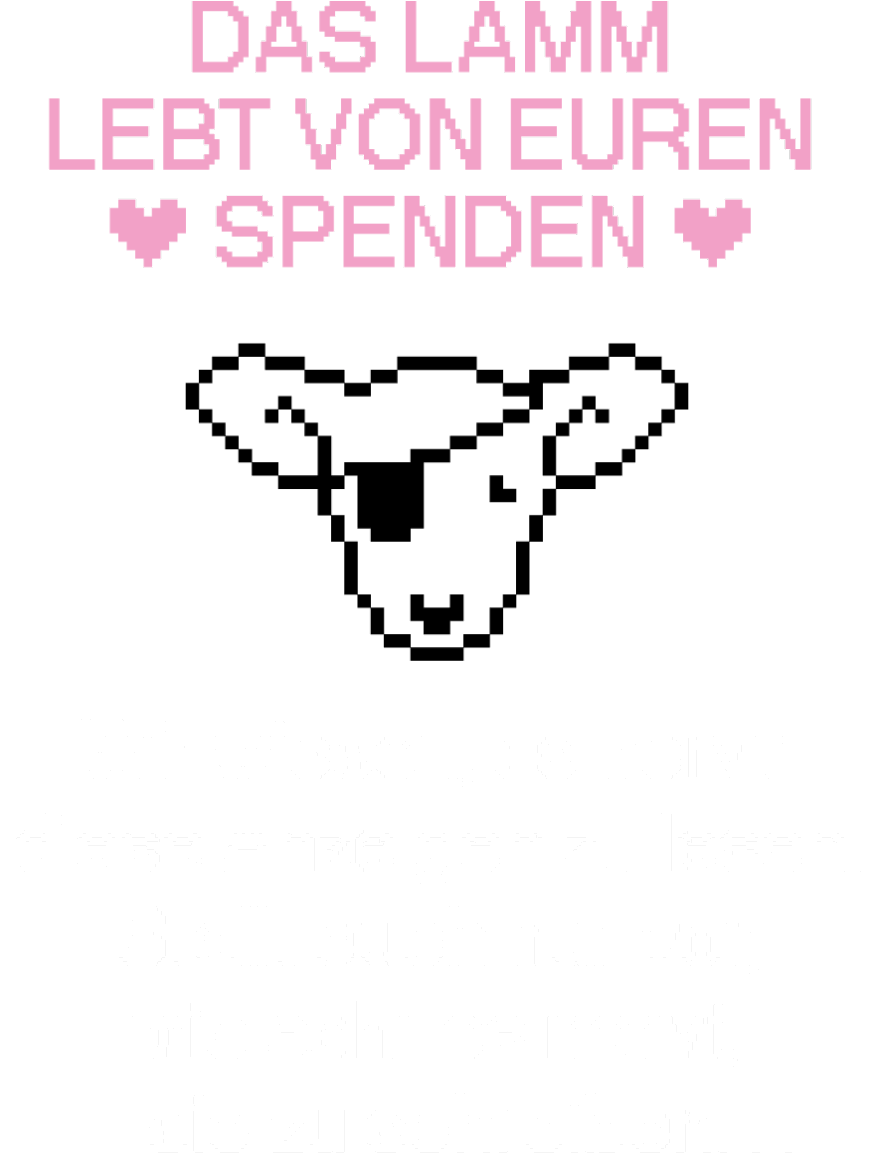Ibu Asmania steht die Wut ins Gesicht geschrieben, als sie am 3. September die breite Treppe des Zuger Regierungsgebäudes herunterläuft. Noch wurde nichts entschieden, doch das Plädoyer des Holcim-Verteidigers hat ihr die Laune verdorben. «Wir sind von einer kleinen Insel und kämpfen gegen einen riesigen Konzern. Wir spüren den Klimawandel Tag für Tag – die Vertreter von Holcim nicht.» Asmania ist zusammen mit ihrem Mitstreiter Arif Pujinto für den Prozessauftakt nach Zug gereist. Die anderen beiden Kläger, Pak Bobby und Edi Mulyono, verfolgen den Prozess von Indonesien aus.
Das Interesse am Prozess ist so gross, dass die Anhörung ins Regierungsgebäude verlegt werden musste. Unter einem grossen Jesus, mit einem Schweizerkreuz zur linken und einer weiss-blau-weissen Kantonsflagge zur rechten Seite, lauschen die drei Kantonsrichter*innen zunächst den Argumenten der Kläger*innen, dann jenen der Verteidigung. Ausgerechnet hier, im kapitalfreundlichen Kanton Zug, könnte Rechtsgeschichte geschrieben werden: Der ansässige Zementkonzern steht erstinstanzlich vor Gericht, weil sein CO₂-Ausstoss die Persönlichkeitsrechte der vier Fischer*innen verletze.
Durch den steigenden Meeresspiegel wird ihre Insel Pari, die nur 1,5 Meter über dem Meeresspiegel liegt, überflutet. Zum ersten Mal beschäftigt sich ein Schweizer Zivilgericht mit einer Klimaklage aus dem globalen Süden. Unterstützt werden die Kläger*innen von Nichtregierungsorganisation wie der HEKS.
Ist der Zementhersteller für seine CO₂-Emissionen haftbar?
Doppelt so viele Emissionen wie die Schweiz
Holcim betreibt in Indonesien keine eigene Zementproduktion, muss sich in Zug aber wegen seiner globalen Emissionen verteidigen. Laut dem Climate Accountability Institute ist Holcim für 0,42 Prozent der weltweiten industriellen CO₂-Emissionen seit 1750 verantwortlich – mehr als doppelt so viel wie der CO₂-Fussabdruck der Schweiz.
Die Forderungen der Kläger*innen: Holcim soll seine Emissionen so weit verringern, dass sie mit dem 1,5‑Grad-Ziel von Paris vereinbar sind.
Der Hunger nach dem Bau-Allheilmittel Beton hat sich in den letzten drei Jahrzehnten vervielfacht. Davon profitiert Holcim, eines der weltweit führenden Unternehmen der Baustoffindustrie. Acht Prozent des jährlich ausgestossenen CO₂ gehen auf das Konto der Zementindustrie – dreimal so viel wie der globale Flugverkehr.
Drei Forderungen, eine Hoffnung
Sanftes Morgenlicht plätschert durch den Raum, als die Anwältin der Kläger*innen, Cordelia Bähr, ihr Plädoyer eröffnet. Bähr ist ein bekannter Name, sie hat die Klimasenior*innen erfolgreich in Strassburg vertreten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte folgte ihrer Argumentation, dass die Schweiz zu wenig tue, um ältere Frauen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen.
Heute argumentiert Bähr jedoch nicht gegen einen Staat, sondern gegen den privaten Konzern Holcim. Ihre Argumentation basiert auf dem Zivilgesetzbuch: Die Kläger*innen seien durch den Klimawandel akut und existenziell in ihren Persönlichkeitsrechten laut Artikel 28 ZGB bedroht. Doch es gebe Hoffnung: Werde die Erhitzung eingedämmt, bleibe die Insel Pari bewohnbar. Dafür sei Holcim mitverantwortlich.

Die Forderungen der Kläger*innen: Holcim soll seine Emissionen so weit verringern, dass sie mit dem 1,5‑Grad-Ziel von Paris vereinbar sind. Der Konzern soll eine Entschädigung für vergangene Schäden auf der Insel Pari zahlen, denn der Meeresspiegel ist bereits um 20 Zentimeter gestiegen. Und, Holcim soll sich finanziell an Massnahmen beteiligen, um weitere Schäden zu verhindern, etwa an der Bepflanzung mit Mangroven oder dem Bau von Wellenbrechern.
Die geforderten Summen sind gering, insgesamt etwa 15 000 Franken. Für Holcim kaum der Rede wert. Doch ein Schuldspruch könnte Präzedenzwirkung haben und eine Flut ähnlicher Verfahren auslösen.
Bähr trägt ihre Argumente klar und frei von Pathos vor. Als Ibu Asmania am Ende des Plädoyers aufsteht, wird es still im Saal. «Sehr geehrte Kantonsrichter», setzt sie an. «Ich bin weit gereist und habe meine Kinder allein gelassen, um hier zu sein.» Inständig bittet Asmania die Richter*innen, die Klage zu prüfen. Denn heute geht es nicht um deren materiellen Inhalt, sondern um die Zulässigkeit der Klage: Hat die Kläger*innenschaft ein schutzwürdiges Interesse? Und ist das Kantonsgericht Zug überhaupt dafür zuständig?
Unterstütze unabhängigen Journalismus.
Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!
«Wer klagt? Die ganze Menschheit?»
Holcims Verteidigung versucht darzulegen, warum diese Fragen mit «Nein» beantwortet werden müssen. Bei Klimafragen liessen sich Kläger*innen, Beklagte und Kausalitäten nicht trennscharf identifizieren. Holcim bedauere das Schicksal der vier Fischer*innen, doch weltweit seien über drei Milliarden Menschen besonders vom Klimawandel betroffen, so die Verteidigung unter Verweis auf Zahlen des IPCC. Würde die Klage Erfolg haben, könnte theoretisch jeder jeden wegen Klimaschäden verklagen. «Wer klagt: Die gesamte Menschheit? Wer wird angeklagt: Ebenfalls die gesamte Menschheit?», fragt die Verteidigung rhetorisch.
Holcim sei willkürlich ausgesucht. Das Unternehmen produziere nicht aus Böswilligkeit, sondern aufgrund der Nachfrage. Selbst bei null Produktion würde der Meeresspiegel weiter steigen. «Rein gar nichts würde sich dadurch am Schicksal der Kläger*innen ändern», so der Verteidiger. Die Schadensersatzforderung sei bestenfalls symbolisch. Umständlich kramt er ein paar Münzen aus der Hosentasche und legt sie auf das Rednerpult. Wenn es um ein paar Franken gehe, könne man das auch so lösen, meint der Verteidiger. Die Geste sorgt für Stirnrunzeln.
Die Verteidigung fährt fort: Der Prozess sei eine theatrale Inszenierung – vier hart betroffene Kläger*innen gegen einen Bösewicht. Das Kantonsgericht sei aber nicht die richtige Bühne, um solche Diskussionen zu führen. Zuständig für die Durchsetzung der CO₂-Reduktionen seien die Parlamente, nicht die Gerichte.
«Die Verteidigungsstrategie der grossen Emittenten ist weltweit die gleiche.»
Roda Verheyen, Anwältin
Dann greift die Verteidigung die unterstützenden NGOs an. Diese hätten die Kläger*innen strategisch ausgewählt und instrumentalisiert. Eine aktivistische Klage, eingereicht von Schweizer Nichtregierungsorganisationen, denen der parlamentarische Prozess zu schleppend voranschreite.
Bekannte Argumente
Von diesen Argumenten ist auf Seiten der Kläger*innen niemand überrascht. Bähr hat sie in ihrem Plädoyer bereits vorweggenommen. Auch Roda Verheyen kennt sie aus früheren Verfahren. Sie vertrat den peruanischen Bauern Saúl Luciano Lliuya gegen den deutschen Kohlekonzern RWE vor dem Obergericht in Hamm. In dem Fall erkannte ein europäisches Gericht erstmals an, dass grosse Emittenten nach Zivilrecht für Klimafolgen haftbar gemacht werden können.
«Die Verteidigungsstrategie der grossen Emittenten ist weltweit die gleiche», so Verheyen. «Alles, was hier in dreieinhalb Stunden besprochen wurde, hat man in Hamm zugunsten des Klägers entschieden.» Argumente, dass es sich um politische und nicht zivilrechtliche Fragen handele, seien erfolgreich entkräftet worden.
Klimaklagen weltweit im Aufwind
Seit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens 2015 nehmen Klimaklagen rapide zu: Von sechs Verfahren 2015 auf 56 im Jahr 2023 und 36 im Jahr 2024, wie Recherchen der Republik zeigen. Eine der bedeutendsten hängigen Klagen ist die niederländische Sammelklage gegen Shell mit über 17 000 Beteiligten. Der Konzern soll Menschenrechte verletzen, etwa das Recht auf Leben oder auf Achtung des Privat- und Familienlebens.

«Solange solche Konzerne nicht haftbar gemacht werden, kann es keine ausreichenden Fortschritte in Richtung Klimagerechtigkeit geben», sagt Sébastien Duyck vom Center for International Environmental Law in Genf. In Bezug auf Holcim wagt er keine Prognose, betont jedoch: «In immer mehr Ländern führen Richter*innen Verfahren, in denen sie das Recht konsequent durchsetzen und so Straflosigkeit verhindern.»
Und welche Rolle spielen die NGOs im Prozess? Wurden die Kläger*innen strategisch ausgesucht, um einen Prozess à la David gegen Goliath zu inszenieren? Nina Burri von HEKS winkt ab: «Es gab keine Auswahl. Die Kläger*innen haben selbst Klage eingereicht.» Die Gemeinschaft auf Pari sei schon aktiv gewesen, bevor HEKS auf sie aufmerksam wurde. Sie hätten sie lediglich beraten und unterstützt. «Holcim spricht ihnen ihre Selbstbestimmung ab – das ist absurd und anmassend.»
Entscheidung steht aus
Kurz vor Mittag zieht sich das Gericht zurück. Die drei Kantonsrichter*innen haben noch nicht entschieden, ob sie den Fall verhandeln oder abweisen. Ihren Entscheid würden sie zu gegebener Zeit schriftlich mitteilen, so der Richter. Die Anwältin Cordelia Bähr äussert sich nicht zur laufenden Verhandlung. Ibu Asmania zeigt sich siegessicher: «Ich glaube, dass Richter*innen auf unserer Seite stehen werden. Wir werden gewinnen – und damit andere Betroffene ermutigen, für Klimagerechtigkeit zu kämpfen.»
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 15 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1040 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 525 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 255 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?