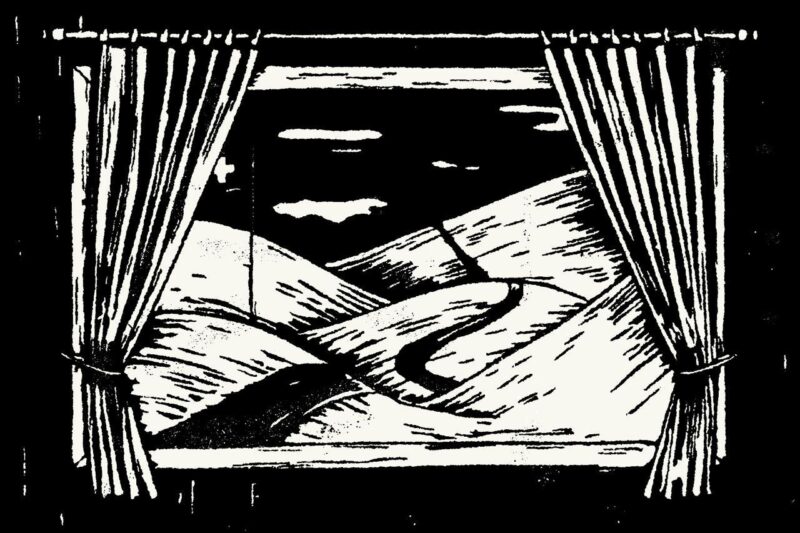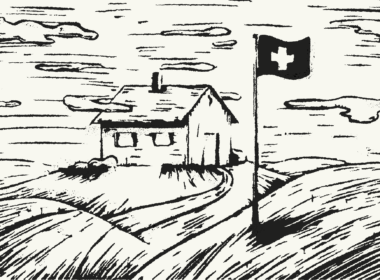Michael Graff bietet in seinem Text «Ist links, wo keine Heimat ist?» eine linke Perspektive auf das Konzept der «Heimat». Graffs Text liegt in vielen Punkten richtig. Er bietet eine solide Betrachtung auf Heimat, stellt treffend fest, dass linke Bestrebungen den Heimatsbegriff «zurückzuerobern», Klassendifferenzen ausblenden, rechte Narrative nähren und letztlich zum Scheitern verurteilt sind. Die Analyse zeigt auf, dass Heimat ein reaktionäres Konzept ist und mündet folgerichtig im Aufruf zum Widerstand gegen Nationalstaaten, Militarisierung und Vaterlandsliebe – insbesondere an die politische Linke.
Chinesisch spreche ich noch alle paar Wochen. Und trotzdem ist Taiwan mehr Heimat, als es die Schweiz je war.
Allen weissen Schweizer*innen, die einen Heimatbezug zur Schweiz haben (oder wollen), bietet der Text gute Gedanken. Die Perspektiven jener, denen dieses Heimatsgefühl stets verwehrt blieb – und die es gerade deshalb nicht einfach von sich weisen können – fehlen in Graffs Text allerdings. Er blendet die Perspektive von uns Migrant*innen aus.
Ich bin in der Schweiz geboren, doch lebte hier stets mit einem migrantischen Selbstverständnis. Meine Mutter lebte in Taiwan und ist vor rund 25 Jahren in die Schweiz migriert. Als Kind besuchte ich Taiwan oft. Schon damals fiel mir eine interessante Formulierung der chinesischen Sprache auf: Wann auch immer wir nach Taiwan gingen, dann sprachen wir nicht von 去台灣 (qù tái wān; nach Taiwan gehen) sondern stets von 回台灣 (huí tái wān; nach Taiwan zurückkehren).
Das letzte Mal war ich vor sechs Jahren in Taiwan. Für längere Zeit auf der Insel gelebt habe ich nie. Chinesisch spreche ich noch alle paar Wochen, wenn ich meine Mutter treffe. Und trotzdem ist Taiwan mehr Heimat, als es die Schweiz je war. Im Februar reise ich vermutlich wieder nach Taiwan, doch ich gehe nicht einfach dahin – ich kehre zurück. Kehre zurück in die Grossstädte meiner Kindheit, besuche die Märkte und Tempel mit meiner Ama und feiere Neujahr mit meiner Familie.
Es ist ein Ort, an dem ich nicht Ausländer*in, sondern Zurückgekehrte*r bin.
Gäbe es das exklusive schweizerische Heimatsgefühl nicht, dann wäre auch die Verteidigung gegen dieses hinfällig.
Dieses Heimatsgefühl für einen abstrahierten Ort am anderen Ende der Welt ist zweifelsohne auch romantisierend. Mit einem «ländlichen Idyll» oder einer «rückwärtsgewandten Einbildung», wie sie Michael Graff beschreibt, hat das aber nichts zu tun.
Die migrantische Heimat ist ein Verteidigungsmechanismus gegenüber einer Gesellschaft, die uns jeden Tag klarmacht, dass wir nicht dazugehören. Meine Heimat ist keine bürgerliche Idylle, sie ist lediglich ein Ort, an dem meine äusserlichen Merkmale, für die ich meine halbe Kindheit gehänselt wurde, mehr als nur akzeptiert werden: Sie sind einfach normal.
Dieser Bezug zu Heimat ist ebenfalls ein im Grunde schlechter – er entstammt negativen Erfahrungen und ist mit dem Pathos der «Verwurzerlung» verwandt. Doch er kommt aus einem anderen Verständnis von Heimat und Wohnort. Er ist nicht eine Besinnung auf den stolzen Stammbaum mit Familienhof, sondern eine Reaktion auf das plumpe «Verpiss dich dahin, wo du hergekommen bist!».
Unterstütze unabhängigen Journalismus.
Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!
Es handelt sich um einen Heimatsbezug, welcher der Diaspora aus aller Welt hilft, in einer rassistischen Gesellschaft klarzukommen.
Dieses Gefühl, andernorts «normal» sein zu können, gibt migrantischen Menschen erst die Kraft, gerade dieses Gefühl in der rassistischen Schweiz wiederum einzufordern. Gäbe es das exklusive schweizerische Heimatsgefühl nicht, dann wäre auch die Verteidigung gegen dieses hinfällig.
Gleichzeitig greift ein migrantisches Heimatsgefühl durch die damit einhergehende, halbfreiwillige Verweigerung von linksliberalen Assimilierungsfantasien genau diese an. Es zeigt auf, dass Migrant*innen sich nicht einfach in die gutschweizerische Kultur zu integrieren haben, sondern stellt diese als Ganzes in Frage.
Die breite politische Linke muss sich diese Perspektive nicht zunutze machen. Sie kann es gar nicht. Dafür fehlen einer breiten, weissen – wenn auch sensibilisierten – Bevölkerung schlicht die Erfahrungen. Aufgrund dieser fehlenden Erfahrungen jedes Heimatsgefühl als reaktionär und rechts abzutun, greift aber zu kurz.
Die Arbeiter*innen haben kein Vaterland. Auf einen Ort, an dem wir keinen Rassismus erleben, können wir uns aber trotzdem beziehen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 8 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 676 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 280 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 136 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?