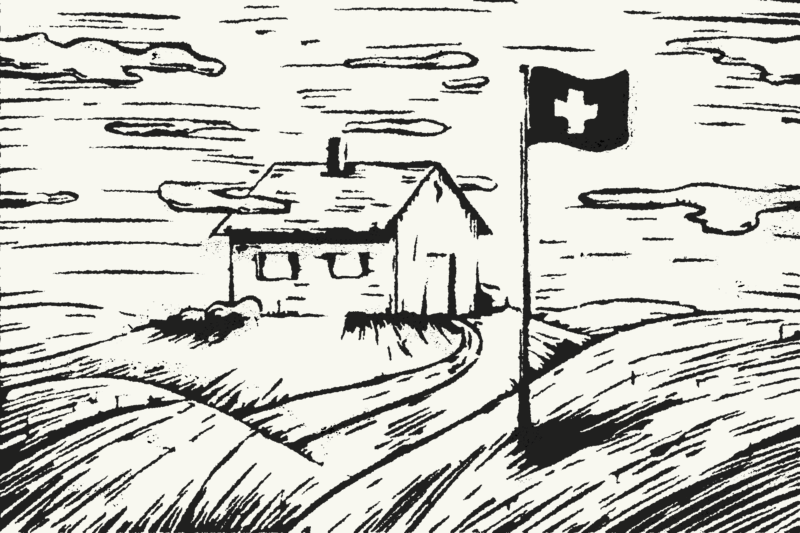Eine Replik zu diesem Text aus migrantischer Perspektive findest du hier.
Die Zugehörigkeit zu einem «Volk» oder einer «Nation» und das Gefühl der Verbundenheit mit einer «Heimat» gelten weithin als selbstverständlich. Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat sich das noch verschärft. So wird bis in linke Kreise hinein kaum mehr ernst genommen, wer die Selbstverständlichkeit der nationalen Identität bezweifelt und der Auffassung widerspricht, dass es sich lohnt, dafür zu sterben.
Eine konsequent linke, kritische Sicht auf «Heimat» sieht anders aus. Sie gerät aber leider häufig in Vergessenheit – und zwar immer dann, wenn «Linke» behaupten, man dürfe den Begriff «Heimat» nicht den Rechten überlassen, sondern müsse ihn selbst positiv besetzen. Dahinter steckt wohl die Absicht, die nach rechts Gedrifteten zurückzugewinnen, indem man ihnen das anbietet, was sie sich von rechts versprechen: geschlossene Grenzen, Autorität, Tradition und eben «Heimat».
«Heimat» ist also genau dort, wo die SVP ihre Hochburgen hat.
Ein positiver Bezug auf «Heimat» wirkt oft harmlos, kommt sie doch häufig als regionales Idyll daher, das Vertrautheit und Geborgenheit verspricht. Doch was ist «Heimat»?
Ein «mächtiges Gefühl»
Als das Nationalgefühl um sich griff, stellte 1837 die Brockhaus-Enzyklopädie fest:
«Heimat nennt man das Land, wo man geboren ist. Jeder Mensch fühlt in seiner Brust ein mächtiges Gefühl, welches ihn zu dem Lande hinzieht, in welchem er seine Kindheit und Jugendzeit verlebte. […] Diese Liebe zur Heimat, welche sich auch bei den rohesten Völkern findet, wird bei dem gebildeten und mündigen Staatsbürger zur Vaterlandsliebe, welche sich nicht bloss auf ein dunkles Gefühl stützt, sondern auf eine bestimmte Überzeugung von der Tüchtigkeit vaterländischer Einrichtungen und von der Möglichkeit, mittels derselben seine Zwecke als vernünftiger Mensch und als Staatsbürger erreichen zu können. In rechtlicher und staatswirtschaftlicher Beziehung wird der Begriff der Heimat besonders dadurch wichtig, weil aus ihm für die Angehörigen derselben gewisse Rechte und Verbindlichkeiten erwachsen.»
Heute, knapp 200 Jahre später, ist «Heimat» für den Brockhaus etwas nüchterner «eine teils vorgestellte, teils real angebbare Gegend (Land, Landschaft oder Ort), zu der – aufgrund tatsächlichen Herkommens oder vergleichbarer ‹ursprünglicher› Verbundenheitsgefühle – eine unmittelbare und für die jeweilige Identität konstitutive Vertrautheit besteht.»
Aus dem «mächtigen Gefühl» von 1837 für das «Vaterland», wo man geboren ist – der Verliebtheit ähnlich, aber zugleich eine «mündige» Überzeugung von der Zweckmässigkeit und Verbindlichkeit der nationalen Institutionen -, ist etwas Abstrakteres geworden. «Heimat» ist nicht mehr immer real, sondern auch imaginiert, und der tatsächliche Geburtsort legt auch nicht mehr zwingend fest, wo «Heimat» ist. Sie bleibt aber etwas «Ursprüngliches» und damit ausschlaggebend für die Identität.
Wenn die Fremden ungefragt in der «Heimat» auftauchen, werden sie zu Kriminellen, da sie gegen die Ausländergesetze der «Heimat» verstossen.
«Heimat» als Vorstellung ist nun meist ein ländliches Idyll: Der Mühlbach plätschert, die Gänse schnattern, der Grossvater raucht seine Pfeife, und die Grossmutter backt Kuchen. «Heimat» ist also genau dort, wo die SVP ihre Hochburgen hat. Das Zürcher Langstrassenquartier mit seiner ethnischen Diversität und der Sichtbarkeit von Unangepasstheit, Sucht und Prostitution passen nicht dazu. Ebenso wenig die Agglomeration, das zersiedelte Gebiet zwischen Land und Stadt, wo der Grossteil der Bevölkerung lebt.
«Heimat» ist also nicht nur eine romantisierende Idee vom Ort der behüteten Jugend, sondern eine rückwärtsgewandte Einbildung. Vom Grauen, welches das Dorfleben im Verborgenen prägte, wird geschwiegen.
Die mörderische Logik von Heimat
Dem deutschen Publizisten und Politiker Thomas Ebermann folgend, ist «Heimat» mit zwei unheilvollen Ideen belastet: «Prägung» und «Verwurzelung». Die angeblich unwiderrufliche «Prägung» durch die «Heimat» ist ein Angriff auf den gesellschaftlichen Fortschritt. «Heimat» schützt die Tradition, Neues bedroht sie. Und man hat genau eine «Heimat», nicht etwa mehrere oder gar viele «Heimaten». Diese Exklusivität ist für die Identität der Heimatverliebten entscheidend, für die anderen ist sie ausgrenzend. Das zeigt sich in den ständig geäusserten Zweifeln an der Loyalität von Menschen mit mehr als einer Staatsbürgerschaft – an ihrer Eignung für politische Ämter oder als Sportler*innen in «Nationalmannschaften».
Der minimale Fortschritt der letzten Jahre, der mehr Toleranz für mehrfache Staatsbürgerschaften brachte, ist unter Druck geraten. Verschärfungen und Ausbürgerungen von missliebigen Personen stehen zur Debatte. Auf die Spitze treibt es die Forderung nach «Remigration», also die Ausschaffung von Menschen, die anderswo geboren wurden, um die «Identität» der «Heimat» zu bewahren.
Die zweite unheilvolle Idee, die «Verwurzelung», macht faktenwidrig aus Menschen Bäume. Nicht Sesshaftigkeit, sondern Migration – die Suche nach einem besseren Leben anderswo – ist seit ihren Anfängen kennzeichnend für die Menschheit. Freiheit bedeutet auch, wegzugehen und woanders willkommen zu sein.
Wie können Menschen, die zufällig in einem Land geborenen wurden, sich anmassen, anderen, die ebenso zufällig anderswo geboren wurden, den Aufenthalt zu verbieten?
Der Gegensatz zu «Heimat» ist die «Fremde». Die dort Lebenden betrachten die Heimatverliebten im Urlaub zwar mit Neugier, vielleicht sogar Wohlwollen. Aber wenn die Fremden sich anmassen, ungefragt in der «Heimat» aufzutauchen, rühren sie an den Grundfesten von Identität und Nation und werden zu «Scheinasylant*innen», «Wirtschaftsflüchtlingen» und stets zu Kriminellen, da sie per Definition gegen die Ausländergesetze der «Heimat» verstossen.
Dass Leute gute Gründe zur Migration haben könnten, die sie dazu auch moralisch berechtigen, ist für die Heimatverliebten undenkbar. Die laute Forderung nach einem «besserem Schutz der Grenzen», bei dem sich alle bemühen, die anderen an Unmenschlichkeit zu übertreffen, hat längst das rechtsnationale Milieu verlassen. Die Verwehrung des Familiennachzugs, menschenunwürdige Unterbringung und Arbeitsverbot bei finanziellen Zuwendungen unter dem bereits kläglichen Sozialhilfeniveau gehören angesichts der mörderischen Grenzen der westlichen «Wertegemeinschaft» noch zu den milderen Massnahmen.
Tausende von in den Meeren Ertrunkenen und in den Wüsten Verdursteten dienen gezielt dazu, abzuschrecken und Härte zu demonstrieren. Der Zynismus, mit dem man die Gier der «Schlepper*innen» für die Toten verantwortlich macht und die Krokodilstränen für die Opfer sind widerwärtig. Denn es bräuchte nicht einmal die Aufhebung des Visazwangs für Menschen aus den Fluchtursprungsländern. Es bräuchte lediglich einen Verwaltungsakt: Die Aufhebung der Verpflichtung der Fluggesellschaften, auf eigene Kosten alle Passagiere ohne gültige Einreisedokumente an den Abflugort zurückzufliegen.
Niemand bräuchte mehr sein Leben zu riskieren, um in ein Land der Hoffnung zu gelangen. Wer in der Schweiz einen Asylantrag stellen möchte, könnte das einfach am Zürcher oder Genfer Flughafen tun. Die «Schlepper*innnen» müssten sich einen anderen Lebensunterhalt suchen.
Unterstütze unabhängigen Journalismus.
Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!
Der Schutz der «Heimat» und der dort Verwurzelten ist also identisch mit der Abwehr der Fremden. Man braucht keinem linken Internationalismus anzuhängen, um für offene Grenzen einzutreten. Andreas Cassee hat die philosophischen Argumente für und wider das von den Einheimischen beanspruchte Recht, Fremden die Einreise und den Verbleib zu verbieten, gründlich analysiert. Ausgehend davon, dass es in der Schweiz heute völlig inakzeptabel wäre, jemandem den Zuzug in einen anderen Kanton von einer Bewilligung abhängig zu machen, fragt er, wieso das bei Ländern als selbstverständlich gilt. Wie können Menschen, die zufällig in einem Land geborenen wurden, sich anmassen, anderen, die ebenso zufällig anderswo geboren wurden, den Aufenthalt zu verbieten?
Seine Antwort: «Jeder Mensch sollte frei entscheiden können, in welchem Land er leben will. Einwanderungsbeschränkungen sind nur in Ausnahmesituationen zulässig.» Wenn man das Nationale nicht zu einem schützenswerten Wert erklärt, der über dem eines guten Lebens aller anderen steht, sind Zuwanderungsbeschränkungen also moralisch nicht haltbar.
Menschen, Bewegungen und Parteien, die sich als links verstehen, sollten also allein aus moralischen Gründen den mörderischen «Grenzschutz» ablehnen und Forderungen nach noch mehr Härte den Rechten überlassen.
Der Hauptfeind steht im eigenen Land
Zudem ist zu bedenken: Nach Marx gibt es seit dem Ende der Steinzeit in allen Gesellschaften eine privilegierte Klasse. Diese Klasse sichert sich den Zugriff auf die Produktionsmittel, eignet sich den Mehrwert an und entscheidet über die Entstehung und Verteilung der Güter, wobei der Staat und der kulturelle Überbau für stabile Verhältnisse sorgen. Der bürgerliche Staat entstand mit dem Aufstieg des Kapitalismus im 19. Jahrhundert. Er sicherte der Bourgeoisie die Aneignung des Mehrwerts aus der gesellschaftlichen Arbeit auf ihrem Staatsgebiet mit Gesetz, Verwaltung und Staatsgewalt. Nationale Identität diente dabei als Herrschaftsmittel.
Mit fragwürdigen Bezügen zur Geschichte wurde die Nation zum Subjekt erhoben. Volkstümliche Bräuche, Trachten und Helden sind zu grossen Teilen erfunden, aber die nationale Indoktrination ist allgegenwärtig. Sie verbirgt die Klassengegensätze im Inneren und lenkt den Blick auf den äusseren Feind.
Ein völkisch begründetes Heimatgefühl wird zugunsten eines staatlichen zurückgewiesen, das die in der Schweiz lebenden Menschen umfasst.
Auch wer sonst nichts hat, es bleibt die Nation – von der «Nationalfahne» über das Lied bis zur Umschlagsfarbe des Reisepasses ist nichts belanglos genug für die Stiftung nationaler Identität. Die Berge, die Küste, die Steppe – alles wird besungen, und nirgendwo ist es schöner. Wenn die «Nationalmannschaft» antritt und die «Nationalhymne» erschallt, soll die Nation kollektiv eine Gänsehaut bekommen. Leute schminken sich seit einigen Jahren bei solchen Anlässen die «Nationalfarben» ins Gesicht. Das nationale Kollektiv ist klassenübergreifend.
Wenn Linke dabei mitmachen, vergessen sie das grösste historische Versagen der Linken: den Burgfriedensschluss im August 1914, als die meisten sozialdemokratischen Parteien ihre antimilitaristische Haltung aufgaben. Daraufhin schossen Arbeiter an den Fronten auf ihresgleichen, anstatt die Gewehre gegen die eigenen Offiziere zu richten.
Die organisierte internationale Linke hatte 1912 am Friedenskongress in Basel feierlich geschworen, das absehbare Gemetzel durch einen Generalstreik und die Weigerung, Waffen aufeinander zu richten, zu verhindern. Im Sommer 1914 gaben die linken Parteien und Gewerkschaften – mit wenigen Ausnahmen – ihr internationales Antikriegsbündnis zugunsten eines aggressiven Patriotismus auf und stellten Nation vor Klasse.
Linker Internationalismus hätte den Krieg verhindern können, aber die nationale Indoktrination erwies sich als stärker.
Die Lektion daraus ist: «Der Hauptfeind steht im eigenen Land», wie der Titel eines Buches des linken deutschen Politiker Karl Liebknecht heisst. Wenn Linke von «Heimat» sprechen, vergessen sie das. Katrin Göring-Eckhardt, die damalige Vorsitzende der deutschen Grünen, sagte am Parteitag 2017: «Wir lieben dieses Land. Es ist unsere Heimat. Diese Heimat spaltet man nicht. Für diese Heimat werden wir kämpfen.» Das ist nicht links.
In der Schweiz gilt der SP-Bundesrat Beat Jans als links. Seine Asylpolitik ist so streng, dass er von rechts Applaus bekommt. Das von ihm 2019 verfasste Vorwort zum Sammelband «Unsere Schweiz. Ein Heimatbuch für Weltoffene» zur «Rückeroberung» des Heimatbegriffs macht klar, wie es dazu kommen konnte: «Sosehr wir uns auch bemühen, global zu denken und Grenzen zu überwinden – wir werden doch immer wieder auf unsere Heimat zurückgeworfen.» Der vergebliche Versuch, sich von der «Heimat» zu befreien, führt Jans folgerichtig zu einem «gesunden Heimatverständnis», bei dem «alle Menschen, die hier leben, […] die Schweiz aus[machen].»
Ein völkisch begründetes Heimatgefühl wird zugunsten eines staatlichen zurückgewiesen, das die in der Schweiz lebenden Menschen umfasst. Das mag ein «gesunderes» Gefühl sein als das am SVP-Stammtisch unter dem Hirschgeweih, ein linkes ist es aber nicht. Es taugt vielmehr trefflich zum Schutz der Grenzen.
Ein klares «Nein» zum Militär
Hier ist auch vom Aufrüstungswahn zu sprechen, der seit 2022 die westliche Welt erfasst hat. Ziel ist es, immer höhere Prozentanteile der Wirtschaftsleistung (BIP) des jeweiligen Landes für die «Verteidigung» auszugeben – also für den Unterhalt der Armee und die Produktion von Rüstungsgütern. Donald Trump spricht von fünf Prozent.
Jeder Rappen und jeder Cent für das Militär verschwendet in diesem Fall gesellschaftlichen Reichtum auf die denkbar schlechteste Weise.
Selbst wenn man zugesteht, dass es militärische Verteidigung brauchen könnte, fehlt hier jede militärische Logik. Was es zur Verteidigung gegen einen Angriff braucht, hängt von der Feindseligkeit der Nachbarländer und der Topografie ab, aber nicht im Geringsten von der inländischen Wirtschaftsleistung. Eine Bedrohungsanalyse müsste klären, gegen wen man sich mit welchen Mitteln wehren soll, und der dafür erforderliche militärische Aufwand kann beziffert werden. Der Anteil am BIP, der sich dann ergibt, steht aber am Ende des Prozesses, und nicht am Anfang.
Die Prozentziele bedeuten massive Subventionen für den militärisch-industriellen Komplex – finanziert mit Steuergeldern. Wo das die Korken knallen lässt, ist offensichtlich. Wenn Linke da mitmachen, sollten sie aber gute Gründe haben, und die gibt es heute nicht. «Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben», schrieben Engels und Marx 1848 ins «Kommunistische Manifest». Aus linker Sicht heisst kämpfen, sich gegen Macht und Herrschaft im eigenen Land zu stellen. Kriege hingegen werden fast immer im Interesse der Herrschenden geführt.
Für die unteren Klassen macht es keinen Unterschied, welche Fahne auf dem Rathaus weht, solange sie als formal Freie ihre Arbeitskraft verkaufen dürfen. Ob sich die heimatliche herrschende Klasse den Mehrwert aneignet oder eine andere, spielt für die unteren Klassen nur dann eine Rolle, wenn Aggression von aussen das Leben der einfachen Leute Zwängen unterwirft, die noch härter sind als die eigene Herrschaft.
Beispiele hierfür sind der Krieg gegen Deutschland (1939−45), wo es im Osten Europas um den Kampf gegen Versklavung und Völkermord ging, und der Sklavenaufstand auf Haiti gegen die französische Kolonialmacht (1791). Auch einige der kolonialen Befreiungskriege des 20. Jahrhunderts dürften dazugehören, da der Kolonialismus die Beherrschten häufig als «kulturell minderwertig» verachtete, misshandelte und hemmungslos ausbeutete.
Die aktuell herangezogene Bedrohung durch Russland und China, um Aufrüstung und Militarisierung zu begründen, gehört nicht in diese Kategorie. Hier geht es einzig um geopolitische Vorherrschaft. Jeder Rappen und jeder Cent für das Militär verschwendet in diesem Fall gesellschaftlichen Reichtum auf die denkbar schlechteste Weise. Über die Tatsache hinaus, dass man damit Nützliches finanzieren könnte, verschlingt das Militär Unmengen an Rohstoffen und fossilen Treibstoffen. Links ist daher hier und heute nur ein kategorisches «Nein» zum Militär.
Was heisst das in der heutigen Situation, wo der Weltuntergang denkbarer erscheint als die Weltrevolution? SP und Grüne haben mit der Einbindung in die Konkordanz einen Schweizer Burgfrieden geschlossen. Die Gewerkschaften betrachteten ausländische Kolleg*innen über Jahrzehnte hinweg als störende Konkurrenz, und die SVP bewirtschaftet seit langem erfolgreich die fremdenfeindlichen Einstellungen der Leute, die es bequemer finden, nach unten zu treten, anstatt sich gegen oben zur Wehr zu setzen.
Es braucht keine «Heimat»
Es gilt zunächst, bei Verstand zu bleiben. «Progressive Heimatgefühle» oder «linken Patriotismus» gibt es nicht. Wer aus der Tatsache, irgendwo geboren worden zu sein, Identität, klassenübergreifendes Zusammengehörigkeitsgefühl, Heimeligkeit oder Geborgenheit ableiten will, verschleiert den Klassenwiderspruch. Das giftige Gebräu von Heimat, Volk und Nation gehört den Rechten. Von links kann es nicht positiv besetzt, sondern nur als gefährlich gekennzeichnet werden.
Es bleibt der aufreibende und frustrierende politische Alltag der Linken. Sie können aktuell kaum auf mehr hoffen, als den Abbau der sozialen und zivilisatorischen Errungenschaften zu verhindern, die den Herrschenden einst abgerungen wurden. Dieser politische Alltag spielt sich im nationalen Rahmen ab, und auch linke Menschen müssen sich angesichts des aufgezwungenen Lebens im Falschen irgendwo einrichten.
«Heimat» braucht es dafür aber nicht. Sich angesichts der schlechten Umstände trotzdem irgendwo wohlfühlen zu wollen, geht in Ordnung. Es muss nur nicht immer das Jammertal sein, wo man geboren wurde – vielleicht auch nicht nur ein Ort. Wenn sich das Wohlfühlen aber an der «Heimat» festmacht, besteht die Gefahr, in die rechte Falle zu tappen.
So haben mir Leute, die sich als links verstehen, gesagt: Kritik am Zürcher Brauchtum wie dem «Sechseläuten» – ein Umzug der Zünfte, der mit der Verbrennung einer Menschenpuppe auf dem Scheiterhaufen endet, umringt von kostümierten Reitern –, dem «Knabenschiessen» – eine Wehrertüchtigungsübung – oder dem nachweislich gesundheitsschädlichen Kirchengeläut sei völlig unangebracht. Denn es handle sich um liebenswerte Traditionen. Kürzlich war in den Zeitungen zu lesen, dass die Zürcher Stadtregierung «Sechseläuten» und «Knabenschiessen» weiter subventionieren wird.
Das alles ist nicht links. Links ist, wo keine Heimat ist.
Dieser Artikel erschien zuvor im Widerspruch, Heft 83.