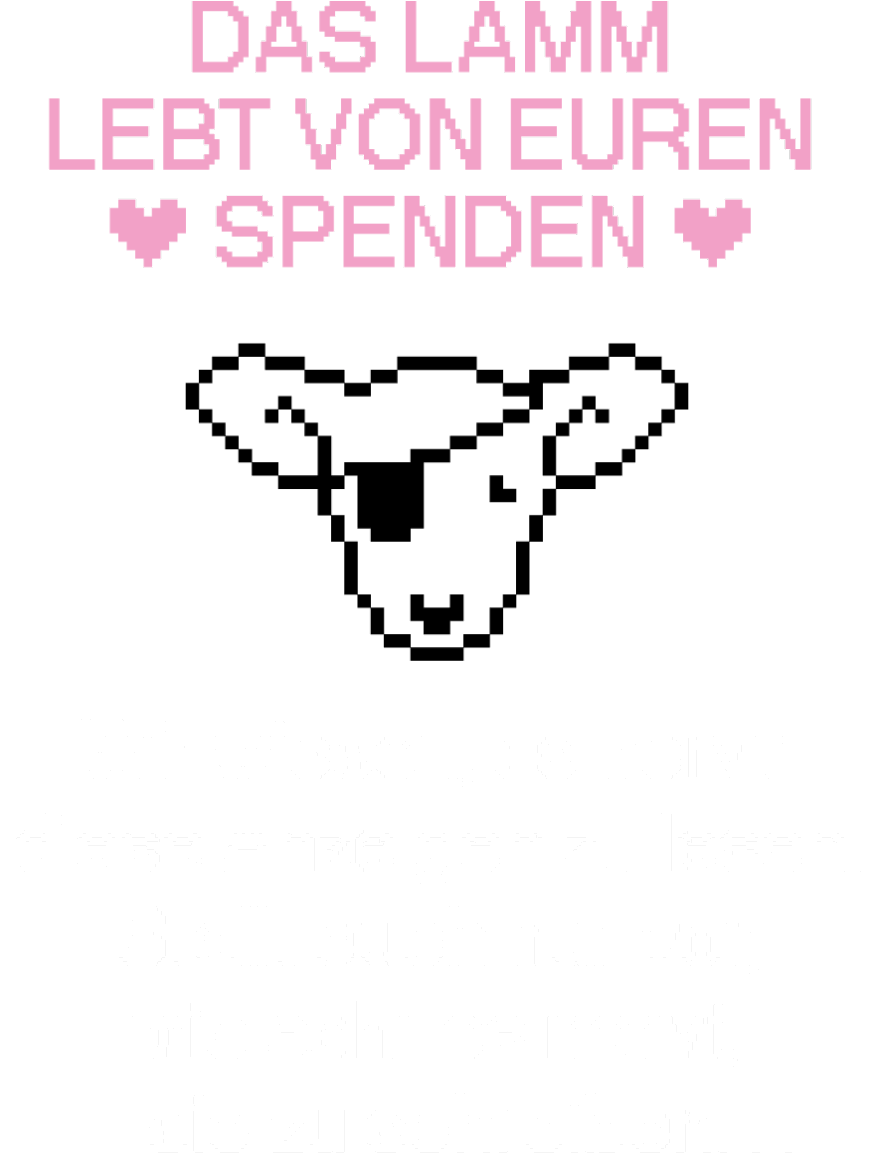«Wenn du ein Milliardär bist – warum bist du ein Milliardär?», fragte die Popikone Billie Eilish letzte Woche an einer Veranstaltung des Wall Street Journals. Im Publikum sassen so prominent wie reiche Gäste, beispielsweise Facebook-Gründer und Multimilliardär Mark Zuckerberg. «Kein Hate, aber gebt euer Geld ab, Shorties», appellierte die 23-Jährige, deren Vermögen auf 50 Millionen geschätzt wird, an noch reichere Personen. Sie selbst will 11.5 Millionen Dollar (rund neun Millionen Franken) der Einnahmen ihrer letzten ausverkauften Tour an Organisationen für Ernährungsgerechtigkeit und Umweltschutz spenden.
Dieser Appell an die Grosszügigkeit überreicher Personen ist zwar diskursiv erfrischend, politisch aber wirkungslos. Die globalen Besitzverhältnisse werden immer ungleicher und konzentrierter Reichtum steht der Ausbeutung der Vielen gegenüber. Das Ziel einer Linken kann nicht darin bestehen, auf die Spendenfreude der Überreichen zu hoffen. Erstens, weil sie mit grosser Wahrscheinlichkeit ausbleibt. Zweitens, weil sie nichts an der grundlegenden Verteilung von Besitz und Macht ändern würde.
Grosszügige Kapitalist*innen
Mittlerweile besitzen die reichsten zehn Prozent der Welt über 85 Prozent des globalen Vermögens. Das bedeutet nicht nur, dass sie sich Yachten, Villen und Privatjets leisten können und damit unser aller CO2-Budget in kürzester Zeit sprengen. Vor allem bedeutet es, dass sehr wenige über das verfügen, was alle zum Leben brauchen und wofür Milliarden Menschen täglich arbeiten: über Unternehmen, die Lebensmittel herstellen, den Boden, auf dem alle wohnen, oder Medienkonzerne, von deren Informationen wir abhängen.
Für den Kapitalismus ist die Moral der Kapitalist*innen irrelevant. Milliardär*innen können die freundlichsten Menschen sein, ihre Angestellten lieben und sich als philantropisch verstehen – das ändert nichts daran, dass sie Teil der herrschenden Klasse eines Systems sind, das starke Ungleichheit produziert. Ihre Absichten sind zweitrangig; weil auch sie sich den ökonomischen Zwängen und Einschränkungen des Marktes unterwerfen müssen. Als Eigentümer*innen der Unternehmen müssen sie ihren Investor*innen Profite sichern und weiter wachsen – ungeachtet ihrer persönlichen Überzeugungen oder Gefühle.
Zwar belohnt der Konkurrenzkampf unsoziales Verhalten, aber es ist durchaus möglich, dass sich die herrschende Klasse als moralisch im Sinne von queerfreundlich, antirassistisch oder ökologisch versteht. Es ist theoretisch kein Widerspruch, sich eine queere, Schwarze Konzernbesitzerin vorzustellen, die an den Klimawandel glaubt und ihr bestmögliches dagegen unternimmt. Wirklich ökologisch, queerfreundlich und antirassistisch könnte sie aufgrund der selben ökonomischen Zwänge, die sie zur Milliardärin gemacht haben, zwar nie sein – doch sie kann sich so geben und selbst begreifen und auch von anderen so verstanden werden.
Die Absichten der Milliardär*innen sind zweitrangig; weil auch sie sich den ökonomischen Zwängen und Einschränkungen des Marktes unterwerfen müssen.
Selbst wenn ein Milliardär so grosszügig wäre, dass er all sein Vermögen verschenken würde und nur noch den globalen Durchschnittsbesitz von rund 10’000 Dollar hätte, würde sich an der Struktur des Systems nichts ändern. An die Stelle des grosszügigen Milliardärs träte sofort ein anderer. Das Problem ist nicht der Charakter Einzelner, sondern unser globales Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, das uns in zwei Klassen teilt: Die Besitzenden und die, die für sie arbeiten müssen, um zu überleben.
Unterstütze unabhängigen Journalismus.
Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!
Nehmen, um zu geben
Es ist ausserdem ein sinnbefreiter Vorgang, wenn die Milliardär*innen ihren Reichtum erst durch den Profit, den sie ihren Angestellten vorenthalten, erwirtschaften, um ihn später wieder «zurück zu spenden». Der logische Schritt wäre, eine Wirtschaft aufzubauen, in der diese Ausbeutung und Konzentration von Reichtum und Macht gar nicht erst stattfindet. Eine klassenlose Gesellschaft also, in der niemand auf den guten Willen einzelner Spender*innen angewiesen ist.
Die sogenannte Philanthropie der Milliardär*innen ist selten uneigennützig – klar, sonst würde sich ihre ökonomische und soziale Stellung verschlechtern. Es gibt etliche Berichte darüber, wie Reiche durch Spenden ökonomische Macht ausüben, in soziale Sphären eingreifen, demokratische Prozesse umgehen und öffentliche Institutionen beeinflussen.
Würde Zuckerberg sein Vermögen tatsächlich «teilen», müsste er die Kontrolle über Facebook, Instagram und WhatsApp vollständig aufgeben und an seine Angestellten übertragen.
Ausserdem – das weiss man im Land der Stiftungen und Steuertricks sehr gut – werden philanthropische Spenden steuerlich gefördert und bleiben oft intransparent in privaten Stiftungen verborgen. Was Milliardäre «spenden» nennen, ist oft nur ein neues Gefäss für ihr Kapital: Mark Zuckerberg etwa kündigte 2015 an, 99 Prozent seiner Facebook-Aktien zu «spenden». Wie grosszügig – nur gehen diese Spenden an eine von ihm kontrollierte Gesellschaft, die Lobbying und Risikoinvestitionen betreiben kann, aber niemandem öffentliche Rechenschaft schuldet.
Auch die Initiative «The Giving Pledge», 2010 von Bill Gates und Warren Buffett ins Leben gerufen, zeigt den Widerspruch zwischen Grosszügigkeit und Überreichtum: Überreiche versprechen darin, den Grossteil ihres Vermögens zu spenden – eine moralische Geste ohne rechtliche Verpflichtung. In den veröffentlichten Begleitbriefen begründen sie ihre Grosszügigkeit selten mit Reflexion über strukturelle Ungleichheit, sondern mit familiärer Erziehung, Dankbarkeit oder dem Wunsch, «etwas zurückzugeben».
Sich selbst und das System abschaffen
Laut Forbes verfügt Mark Zuckerberg über ein Vermögen von rund 228 Milliarden Dollar – das 22.8 Millionenfache des globalen Durchschnittsvermögens von 10’000 Dollar. Kein Mensch kann 22.8 Millionen Mal fleissiger, verantwortungsbewusster, klüger oder innovativer arbeiten als der Rest der Weltbevölkerung. Kapitalist*innen erarbeiten den grössten Teil ihres Besitzes nicht selbst. Sie heimsen das ein, was alle anderen erwirtschaftet haben, vermehren es durch Investitionen und haben nicht selten einen Grossteil von vornherein geerbt.
Das Vermögen von Überreichen besteht zudem nicht mehrheitlich aus Geld, sondern aus Eigentum – aus Aktien, Immobilien, Unternehmensanteilen. Echte Grosszügigkeit würde also bedeuten, Besitz, Macht und Kontrolle demokratisch zu teilen – nicht Geld zu «spenden». Würde Zuckerberg sein Vermögen tatsächlich «teilen», müsste er die Kontrolle über Facebook, Instagram und WhatsApp vollständig aufgeben und an seine Angestellten übertragen. Nur so würden die Unternehmen und Produktionsmittel nicht länger von einer oder wenigen Personen kontrolliert, sondern kollektiv verwaltet, nicht-hierarchisch organisiert und ohne primäre Profitorientierung betrieben. Es wären Ansätze für eine sozialistische Wirtschaft, auch wenn diese die kapitalistische Gesamtstruktur noch nicht auflösen würden.
Zuckerberg müsste sich also selbst enteignen. Freiwillig macht das keine*r – schon gar nicht in einer Welt, die zunehmend unsicherer wird. Die Frage ist also nicht, ob Milliardär*innen grosszügig genug sind, sondern warum wir ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem akzeptieren, das sie überhaupt erst hervorbringt.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 10 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 780 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 350 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 170 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?