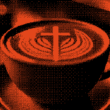Wie schlimm steht es wirklich um die Welt? Das weiss niemand ganz genau. Eine Nachricht jagt die nächste – wie einen Überblick gewinnen, das Chaos ordnen? Wir helfen, indem wir ausgewählte News häppchenweise servieren und einordnen. So liefern wir Ihnen einmal pro Monat Anhaltspunkte zur Lage der Welt aus Lamm-Sicht.
Heute: Die Sonne beeinflusst das Klima doch. // Mehr Asylsuchende werden Opfer von Menschenhandel. // Die Schweiz soll eine Abgabe auf Flugtickets prüfen.
Good News 1: Erhalten wir durch die „kalte Sonne“ wichtige Zeit im Kampf gegen den Klimawandel?
Was ist passiert? Eine vom Schweizer Nationalfonds finanzierte Studie hat zum ersten Mal beziffert, wie stark sich die zyklischen Aktivitäten der Sonne auf die Klimaerwärmung auswirken. Dass die Sonnenaktivität variiert, ist schon länger bekannt. Die wärmeren Phasen, auch „heisse Sonnen” genannt, wechseln sich mit den kälteren Phasen, den „kalten Sonnen”, in einem Rhythmus von rund 400 Jahren ab.
Die Studie beziffert den möglichen Einfluss solcher Zyklen auf die Temperatur der Erde mit einem Maximalwert von einem halben Grad Celsius. Da die StudienautorInnen prognostizieren, dass wir in 50 bis 100 Jahren den Tiefpunkt einer kälteren Phase erreichen werden, würde die Sonnenaktivität also das Erdklima um ein halbes Grad abkühlen.
Warum ist das wichtig? Grundsätzlich widerspricht die Studie den letzten Berichten des Weltklimarats, kurz IPCC (International Panel of Climate Change). Die Hauptaufgabe des IPCC ist es, politische Entscheidungsträger in Fragen rund um den Klimawandel zu beraten. Hierzu fasst der IPCC die neusten Erkenntnisse in der Klimaforschung zusammen. Das Gremium internationaler ForscherInnen hielt bislang in seinen Berichten fest, dass die Sonnenaktivität keinen Einfluss auf die längerfristige Entwicklung des Klimas habe.
Die Daten, welche die Nationalfondsstudie liefern, korrigieren diese Aussage nun. Eine fundierte Auseinandersetzung könnte bei vorhandenem politischem Willen eine Chance sein. Wie Werner Schmutz vom Physikalisch-Meteorologischen Observatorium Davos (PMOD) sagt, gewinnen wir durch die bevorstehende „kalte Sonne“ eventuell einen Hauch mehr Zeit in der Bewältigung der Klimaerwärmung. Die menschenverursachte Klimaerwärmung wird momentan auf etwa 2 Grad Celsius geschätzt. Eine Abkühlung verschafft allen Ländern mehr Zeit, sich auf die Folgen des Klimawandels einzustellen. Das ist gerade für die Länder wichtig, die es bis anhin verschlafen haben, eine umfassende und nachhaltige Klimapolitik auszuarbeiten. Ein Beispiel dafür wären die USA, deren Klimapolitik durch die bizarren Argumente der KlimawandelskeptikerInnen torpediert wird.
Eines der Argumente der KlimaskeptikerInnen: Der republikanische Kongressabgeordnete Randy Hultgren sagte zum Beispiel in einem Interview, dass die Sonne den grössten Einfluss auf die Temperaturen hat. Der bevorstehende Wechsel in eine kältere Phase der Sonne habe einen viel grösseren Einfluss auf das Klima als die menschlichen CO2-Emissionen, so Hultgren.
Die Studie zeigt: Die Sonnenzyklen haben durchaus Einfluss auf das Klima, allerdings steht der in keinem Vergleich zu den menschgemachten Erwärmungen. Obwohl die Liste von empirisch (und logisch) fragwürdigen Argumenten von SkeptikerInnen der Klimaerwärmung endlos scheint: Das Argument zyklischer Sonnenaktivität müssen sie wohl endgültig aufgeben.
Aber? Allen wissenschaftlichen Studien zum Trotz stimmen die jüngsten Entwicklungen in den Vereinigten Staaten nicht gerade optimistisch. Der präsidiale Budgetvorschlag schlägt vor, 31 Prozent des Budgets der Umweltschutzbehörde zu streichen. Zwar liegt die Budgethoheit beim Parlament, doch der Entwurf des Präsidenten steckt das Feld ab. Ob die empirischen Daten wie etwa diejenigen des Nationalfonds auf den amerikanischen Präsidenten Einfluss haben werden, ist fragwürdig. Die Chance, dass Trump von der Studie erfährt, ist aber dennoch intakt: Der Schweizer Nationalfonds hat einen Twitter-Account.
Einfluss der #Sonne auf den #Klimawandel erstmals beziffert https://t.co/gIIkpteLlA #SNF_Forschung pic.twitter.com/xrYIfirgT0
— Schweizerischer Nationalfonds (SNF) (@snf_ch) March 27, 2017
Bad News: Das Problem mit dem Menschenhandel im Schweizer Asylsystem
Was ist passiert? MenschenhändlerInnen nutzen verstärkt das langwierige Schweizer Asylverfahren aus, um MigrantInnen auszubeuten. Das berichtet die Schweiz am Wochenende. Verwandte, Bekannte oder Männer, die vorgeben verliebt zu sein, locken vornehmlich junge Frauen unter falschen Versprechen in die Schweiz — um sie dann hier anschaffen zu schicken.
Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ), sieht das Hauptproblem in der Identifikation von Opfern. Die Behörden können diese gar nicht erkennen, teils weil die Mechanismen fehlen, teils weil sich die Opfer aus Angst vor Konsequenzen nicht selbst zu erkennen geben. Aber selbst wenn sie identifiziert werden, fehlen im Schweizer Asylsystem die Abläufe, um die Opfer zu unterstützen und zu betreuen. Besonders schlimm ist die Situation für sogenannte Dublin-Fälle. Diese MigrantInnen, die in der Schweiz ein Asylantrag stellen, obwohl ein anderes Land zuständig wäre, werden in der Regel vor Abklärung der genauen Umstände ausgeschafft. Dieser Mechanismus spiele den MenschenhändlerInnen in die Karten, so die FIZ.
Warum ist das wichtig? Das scheint selbsterklärend zu sein: Die Schweiz lässt mit den Schwächen in ihrem Asylsystem zu, dass die Situation von Asylsuchenden ausgenutzt wird. Viele der Opfer von MenschenhändlerInnen werden in die Sexarbeit gezwungen. Der überwiegende Teil der Opfer sind Kinder und Frauen. Dies sind unhaltbare Zustände für ein Land, das sich etwas auf seine humanitäre Tradition einbildet.
Aber: Der Bund hat erkannt, dass das heutige Asylverfahren die Menschen in die Hände von Schleppern treibt. Der Bundesrat hat das internationale Abkommen gegen Zwangsarbeit ratifiziert. Momentan befindet sich das Geschäft im Parlament. Der Ständerat hat am 6. März 2017 der Inkraftsetzung zugestimmt.
Das Protokoll verlangt von der Schweiz, dass sie sich stärker für präventive Massnahmen und Opferhilfe im Zusammenhang mit Zwangsarbeit und Menschenhandel einsetzt. Das Abkommen zwingt die Schweiz allerdings nicht zu Gesetzesänderungen. Damit die Situation sich bessert, muss der Bund NGOs und Hilfsorganisationen stärker einbeziehen. An der Tagung zu Menschenhandel im Asylsystem vom 20. März 2017 haben VertreterInnen von NGOs, der UNO und des Europarates die Probleme identifiziert und klare politische Forderungen aufgestellt.
Der Bund hatte bereits 2012 Besserung geschworen: Ziel 19 im Nationalen Aktionsplan gegen Menschenhandel verlangte eine „Sicherstellung der Identifikation von Menschenhandelsopfern in Asylverfahren und Klärung der Abläufe, die für die Gewährleistung des Opferschutzes notwendig sind“. Das Ziel hätte 2013 erreicht werden sollen. Immerhin: Inzwischen sind die Probleme identifiziert und die Lösungsvorschläge ausformuliert. Hoffen wir, dass sich der neuerliche politische Wille zur Bekämpfung von Menschenhandel im Asylwesen nicht mit der Ratifizierung eines internationalen Abkommen erschöpft hat.
Good News 2: Erhebt die Schweiz bald eine Flugverkehrsabgabe?
Was ist passiert? Die Zürcher Nationalrätin Priska Seiler Graf hat am 15. März 2017 ein Postulat zuhanden des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) eingereicht: Der Bundesrat soll die Einführung einer sogenannten Flugticketabgabe prüfen. Die Einnahmen sollen für Umwelt- und Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit dem Luftverkehr verwendet werden.
Abgaben auf den Flugverkehr sind keine revolutionäre Forderung. Neben Deutschland und Österreich erheben zahlreiche weitere europäische Staaten streckenabhängige Abgaben auf den Abflug von einem inländischen Standort. Diese Flugticketabgaben funktionieren nach einer ähnlichen Logik wie die Lenkungsabgaben auf fossile Heizstoffe in der Schweiz. Durch die Verteuerung des Produktes soll unter anderem das Verhalten der KonsumentInnen in eine ökologische Richtung gelenkt werden.
Warum ist das wichtig? Der Luftverkehr ist in der Schweiz für etwa 16 Prozent des emittierten CO2 verantwortlich. Gerade innereuropäische Flüge sind dank Easyjet ab Basel günstig: Viele Wochenendtrips sind bereits für unter 100 Franken erhältlich. Hingegen werden ökologischere Fernreisen mit der Bahn in der näheren Zukunft nicht billiger werden.
Wie Graf in ihrem Postulat festhält, geht es in erster Linie darum, dass die Kosten der CO2-Emission aus dem Flugsektor verursachergerecht gedeckt werden. Von den 6.4 Milliarden Franken, die der Luftverkehr in der Schweiz kostet, übernimmt die Allgemeinheit 14 Prozent: Als Gesundheits- oder Umweltkosten, wie das BFS festhält (konkret: Kosten wegen der Beinträchtigung durch Fluglärm oder Kosten die wegen dem auch durch den Flugverkehr befeuerten Klimawandel entstehen).
Doch es geht nicht nur um diese Kosten: Damit die Schweiz das Pariser Klimaabkommen erfüllen kann, muss sie unter anderem beim Luftverkehr ansetzten. Dafür braucht es auch sogenannte „erzieherische Massnahmen“ wie Flugticketabgaben. Durch eine Umleitung von PassagierInnen aus der Luft auf die Schiene könnte man nicht nur einen gewichtigen Teil der CO2-Emissionen einsparen, sondern auch endlich die Integration des innereuropäischen Schienenverkehrs vorantreiben.
Aber: Der Vorschlag wird sowohl vom Flugsektor als auch von bürgerlichen PolitikerInnen kritisiert. Solche Abgaben schadeten der Wirtschaft und dem Tourismus und seien nicht zielführend. Und obwohl die Diskussion über eine bessere Kostendeckung des Luftverkehrs positiv einzustufen ist, scheint die Kritik der GegnerInnen etwas für sich zu haben: Das niederländische Ministerium für Infrastruktur und Umwelt kommt in einer Evaluation der eigenen Flugticketabgabe zum Schluss, dass nur gerade 7 Prozent der Befragten wegen der Abgabe ihre Reise entweder gestrichen oder auf ein anderes Verkehrsmittel verlegt haben. Hingegen nahm das Passagiervolumen bei grenznahen ausländischen Flughäfen, wo die Abgabe nicht anfiel, zu.
Doch dieser Effekt der Passagierflucht entsteht nur dann, wenn man mit der Steuer alleine dasteht. Da aber fast alle Nachbarstaaten der Schweiz bereits eine Flugticketabgabe kennen, ist die Gefahr einer Passagierflucht wohl eher gering. Aus den negativen Konsequenzen, die in anderen Ländern durch die Einführung von Flugticketabgaben entstanden sind, kann die Schweiz lernen und so einen wichtigen Schritt in Richtung eines nachhaltigeren Reiseverkehrs machen.
Aktuelle Lese- und Sehtipps
- So viel kostet es, einen US-Senator zu kaufen.
- In Russland kam es erstmals seit langer Zeit zu grossen Protesten gegen Putins Regime. Dahinter steckt auch dieses Video (Untertitel auf Englisch einstellen).
- Der Guardian hat Internet-Trolle in ihrem Zuhause besucht.
- An den Ufern des Perl-Flusses in China hat sich in den letzten 50 Jahren die stärkste Urbanisierung der Menschheitsgeschichte vollzogen. Ein Vergleich von historischen Aufnahmen aus den 1940er Jahren mit aktuellen Bildern zeigt, wie dramatisch sich die Gegend verändert hat.
- Nudging ist eine Technik, mit der wir dazu verleitet werden sollen, unser Verhalten zu ändern, ohne dass Verbote erlassen werden müssen. Nudging steht deshalb auch unter UmweltschützerInnen hoch im Kurs. Aber wie jede Technik hat auch Nudging seine Schattenseiten.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 18 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1196 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 630 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 306 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?