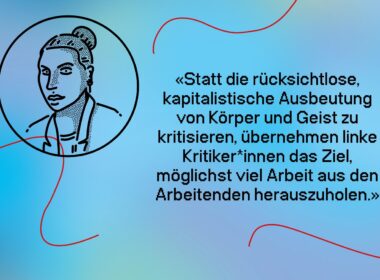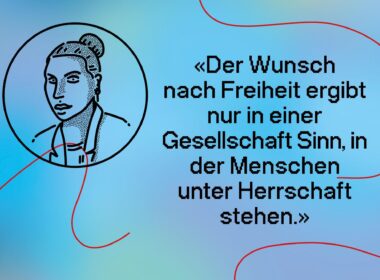In einem Text für den Freitag schreibt die Autorin Marlen Hobrack („Klassenbeste“) über das Verhältnis zu ihrem Körper aus weiblicher Sicht. Bereits ihr jugendlicher Körper, so Hobrack, sei von ihren Familienmitgliedern kommentiert worden. „Zu dünn, hiess es lange, und dann, mit Beginn der Pubertät: zu dick.“ Viele Frauen und Queers dürften sich in ihren Beschreibungen wiederfinden.
Auch ihre Tanten und ihre Mutter hätten permanent mit ihrem Gewicht zu kämpfen gehabt. In Deutschland gehören Hobracks Verwandte damit zur Mehrzahl der Menschen. Zahlen des Robert Koch Instituts aus den Jahren 2019/2020 zeigen, dass 53 Prozent der Menschen hierzulande als adipös gelten. Dabei ist es spektakulär, wie stark sich das mediale Gespräch an adipösen Frauen orientiert, während die Verhältnisse in der Realität umgekehrt sind: 60 Prozent der Männer sind adipös, bei den Frauen sind es 46 Prozent.
Vor allem Frauen und Queers wehren sich seit Jahren gegen fatshaming – zu Recht. Allerdings werden dabei die gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen von Adipositas oft ausgeklammert. So schreibt Hobrack über das sogenannte Fat Acceptance Movement, eine Bewegung, die gegen stereotype und patriarchal geprägte Körperbilder kämpft:
„Eine Bewegung, die den Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit, Armut und frühzeitigem Tod einfach negiert oder unterdrückt, leistet nichts, aber auch gar nichts für die Gleichstellung übergewichtiger Menschen. Fat Acceptance stützt ein zutiefst ungerechtes System des ungleichen Umgangs mit dem eigenen Körper.“
Wer jedem Menschen mit Adipositas sagt: „Du bist normal, so wie du bist”, der normalisiert die oft sozialen Entstehungsbedingungen von Adipositas gleich mit.
Ganz normale Armut
Diese Kritik Hobracks lässt sich auf verschiedenste gesellschaftliche Phänomene und Anerkennungskämpfe anwenden. Ein Beispiel liefert der Kanal von Funk, einem Angebot der deutschen öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Auf dem Instagramkanal von Funk tauchte im Dezemeber 2022 in einem Infopost zum richtigen Umgang mit Freund*innen, die Armutserfahrungen machen, folgender Tipp auf: „Akzeptiert, dass eure Freund*innen weniger Geld haben. Das ist normal und niemand kann was dafür.“ Gesellschaftliche Verhältnisse werden normalisiert.
Dabei stehen Hobracks Kritik und der Post von Funk beispielhaft für eine Individualisierung gesellschaftlicher Schieflagen. Bei psychischen Erkrankungen und dem Thema Sterbehilfe sieht es nicht anders aus. Den Marker „Klasse” aus diesen Kämpfen um Anerkennung auszuklammern, reproduziert Unrecht, anstatt es zu bekämpfen. Wer jedem Menschen mit Adipositas sagt: „Du bist normal, so wie du bist”, der normalisiert die oft sozialen Entstehungsbedingungen von Adipositas gleich mit.
So zeigt beispielsweise die KIGGS-Studie des Robert Koch Instituts aus dem Jahr 2008, dass schon bei armutsbetroffenen Kindern der Anteil derer, die von Adipositas betroffen sind, fast zwei- bis viermal so hoch war, wie in der höchsten sozioökonomischen Schicht.
Makaber wird es beim Thema Sterbehilfe. So spricht sich der Bestseller-Autor und Nazi-Enkel Ferdinand von Schirach („Gott“) schon seit Jahren prominent für eine Legalisierung der Sterbehilfe aus. Und weite Teile der deutschen Öffentlichkeit stehen hinter derlei Forderungen. 2021 befürworteten 72 Prozent der Menschen laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov eine Legalisierung aktiver Sterbehilfe.
„Ich habe keinen anderen Grund, Sterbehilfe zu beantragen, ausser dass ich es mir einfach nicht mehr leisten kann, weiterzuleben.“
Während die legale Sterbehilfe in Deutschland noch immer verboten ist, ist sie in der Schweiz schon seit 1942 erlaubt. Von 2010 bis 2018 haben sich die Zahlen des assistierten Suizids mehr als verdreifacht. Bereits jeder fünfzigste Todesfall in der Schweiz ist ein selbstgewählter Freitod. Der selbstbestimmte Suizid kommt dort vor allem in sozioökonomisch starken Gegenden vor.
Es gibt jedoch auch Hinweise auf gegenteilige Entwicklungen. Die Autor*innen einer Studie aus Kanada – dem Land, das das Verbot von Sterbehilfe 2016 gelockert hat – rechnen vor, dass sich das dortige Gesundheitssystem durch Sterbehilfe schon für 43 Millionen Euro „Nettokostenreduzierung” gesorgt hat. Also Geld, dass das Gesundheitssystem ansonsten für die Behandlung von Patient*innen ausgegeben hätte.
So berichten Menschen, die sich beispielsweise die Behandlungskosten ihrer Krankheit nicht leisten können und sich aus ökonomischen Gründen für ihren Suizid entscheiden. So sagt eine Frau: „Ich habe keinen anderen Grund, Sterbehilfe zu beantragen, ausser dass ich es mir einfach nicht mehr leisten kann, weiterzuleben.“
Die Legalisierung der Sterbehilfe macht assistierten Suizid gesellschaftlich akzeptierter. Das ist begrüssenswert, jedoch müssen dadurch auch die Umstände, die Menschen in den Suizid treiben, nicht näher beleuchtet und damit auch nicht mehr bekämpft werden.
Jede*r hat doch mal was mit der Psyche
Dritter und letzter Punkt: psychische Erkrankungen. Auch hier gibt es die verständlichen Wünsche von Betroffenen, neben dem Gepäck der Erkrankung nicht auch noch stigmatisiert zu werden. Dieser Wunsch verwandelt sich aber allzu oft in einen Versuch, psychische Erkrankungen zu individualisieren. In einem Beitrag konstatiert die Soziologin Christina Meyn, das „neue Sprechen über Depression” sei mit einer „Unsagbarkeit der Kritik an Arbeitsverhältnissen” verbunden.
Ähnlich argumentiert ein Artikel in der Zeit über Depressionen: „Die Erleichterung, die die medizinisch ermöglichte Selbstzuschreibung der Depression als Krankheit dem Einzelnen verschafft, hat somit die Kehrseite, dass der Einzelne, sobald die Depression seine ihm attestierte Krankheit ist, deshalb auch alleine mit ihr und ihren Folgen fertigwerden muss: Individualisierung der Krankheit meint auch Individualisierung der Verantwortung für die Krankheit.“
Was Gespräche um Adipositas, psychiche Erkrankung und Freitod gemein haben, und hier stossen gut gemeinte Rufe nach Normalisierung an ihre Grenzen: All zu oft klammern sie gesellschaftlich verursachtes Leid aus.
Zoomen wir ein bisschen raus. So unterschiedlich die Themen Adipositas, psychische Erkrankung und Freitod sind, gibt es doch Gemeinsamkeiten. In liberalen Gesellschaften gibt es lauter werdende Rufe von Aktivist*innen und Betroffenen nach einem Ende von Ausgrenzung, Stigmatisierung und Diskriminierung. Dagegen lässt sich erst einmal nichts sagen, denn selbstverständlich hat jede*r das Recht, mit der eigenen Lebensrealität anerkannt zu werden – ohne dafür beschämt zu werden.
Was die Gespräche allerdings ebenfalls gemein haben, und hier stossen gut gemeinte Rufe nach Normalisierung an ihre Grenzen: All zu oft klammern sie gesellschaftlich verursachtes Leid aus.
Wenn wir sehen, dass mehr Menschen aus der Armutsklasse Suizid begehen, mehr Menschen aus der Armutsklasse Adipositas haben und auch die Zahl psychischer Erkrankungen wie Depression oder Angststörung proportional bis zu drei Mal so hoch sind, wie in der höchsten sozioökonomischen Statusgruppe, dann sind Forderungen nach einer Normalisierung dieser Phänomene nicht nur kontraproduktiv, sondern mitunter gefährlich. Denn wenn diese Zustände Normalität werden, geraten ihre Ursprünge aus dem Blickfeld.
Nicht die gesellschaftlichen Entstehensbedingungen stehen im Fokus, sondern der eigene Körper, nicht die psychische Gesundheit, die von den Zumutungen der Klassengesellschaft torpediert wird, sondern der Gedanke: Jede*r hat doch mal was mit der Psyche. Nicht Suizid als letzte Konsequenz ökonomischer Bedrohung, sondern die vermeintlich freie, selbstgewählte Entscheidung, die unabhängig ist von realen Lebensbedingungen.
Aktivist*innen und Betroffene, die um ihre Rechte und ihr Ansehen kämpfen, werden sich – wenn sie sich nicht dem Vorwurf der selbstgerechten Entpolitisierung von Kämpfen um Anerkennung aussetzen wollen – fragen müssen, wie sie ihre Anliegen mit einer materiellen Analyse und Forderungen nach einer sozial gerechten Welt verbinden können.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 12 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 884 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 420 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 204 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?