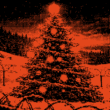Es wirkt wie ein leiser historischer Scherz: Seinen letzten regulären Wohnsitz hatte der kongolesische Intellektuelle Mathieu Musey ausgerechnet in der Looslistrasse im Stadtberner Aussenquartier Betlehem. Sie ist nach dem 1877 unehelich geborenen Carl Albert Loosli benannt. Loosli wuchs in Heimen und Anstalten auf und wurde auf autodidaktischem Weg zum bekannten Philosophen und Schriftsteller. Zeitlebens setzte er sich scharfzüngig gegen gesellschaftliche Ausgrenzung und Behördenwillkür ein.
Und genau davon glaubte auch Mathieu Musey ein Lied singen zu können. Asile en Suisse: Nègres s’abstenir ou la démocratie à l’épreuve, titelte dieser 1987. Auf Deutsch etwa: „Asyl in der Schweiz: N**** haben sich zu enthalten oder Demokratie auf dem Prüfstand.” Der polemische Titel des autobiografischen Buchs zeigt: Musey verstand das, was ihm in seinen Jahren in der Schweiz widerfahren war, als historischen „Präzedenzfall”.
Der in der damaligen belgischen Kolonie Kongo-Freistaat aufgewachsene Musey kam 1972 in die Schweiz, nachdem er in Rom Theologie und Philosophie studiert hatte. Dank eines Stipendiums des katholischen Justinuswerks konnte er an der Universität Freiburg in Philosophie promovieren.
Seine Zeit in der Schweiz endete am 11. Januar 1988 mit einem Paukenschlag: Mit Helikopter und Einsatzwagen stürmte die Polizei den abgelegenen jurassischen Hof Mont Dedos, wo Musey zusammen mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern bei einer mennonitischen Bauernfamilie Unterschlupf gefunden hatte. Die Abschiebung der schweizweit bekannten Familie führte im ganzen Land zu Protesten, die alles Bisherige übertrafen.
An jenem 11. Januar verlor die Familie Musey den jahrelangen Kampf um ihr Anwesenheitsrecht endgültig. Der Streit über den zum Symbol gewordenen Musey und dessen Angehörige aber war damit erst recht entbrannt. Was lässt sich heute über die „Affäre Musey” sagen?
Fragen stellen sich viele: Wie ist aus Musey, der einst als ambitionierter Geisteswissenschaftler in die Schweiz gekommen war, einer jener „Drittweltflüchtlinge” geworden, mit denen sich das Land seit den frühen 1980er-Jahren plötzlich in steigender Zahl konfrontiert sah?
Warum ist Musey zu einer asylpolitischen cause célèbre geworden, die landauf, landab hohe Wellen warf und sogar international für Aufsehen sorgte? Was lässt sich anhand der zum Symbol gewordenen Figur Musey über die Geschichte der Schweiz seit den 1970er-Jahren sagen?
Steht sein Fall – wie es Musey selbst darstellte – dafür, wie Rassismus das Asylrecht und die Demokratie untergräbt? Und wie kommt es, dass es auch über dreissig Jahre nach den äusserst umstrittenen Ereignissen überaus schwierig ist, solche Fragen historisch fundiert zu beantworten?
Hochstapler oder dissidenter Exil-Intellektueller?
Einige Eckpunkte der Affäre Musey sind klar. Das erste Mal in die Schlagzeilen geriet Mathieu Musey im Sommer 1985. „Ewiger Student 15 Jahre in der Schweiz – jetzt will er politisches Asyl”, titelte der Blick. Das Boulevardblatt suggerierte damit, der Fall sei so klar wie empörend: Da gewährt man jemandem zu Studienzwecken jahrelang Aufenthalt, der in all der Zeit in der Schweiz keinen akademischen Abschluss hinkriegt.
Dennoch spielt sich dieser als „Doktor” und gar „Professor” auf. Logisch also, dass der Berner Fremdenpolizei irgendwann der Geduldsfaden reisst und sie die seit 1977 immer wieder verlängerte Aufenthaltsbewilligung auslaufen lässt. Und siehe da: Der Betroffene zaubert plötzlich ein Asylgesuch aus dem Hut.
Ein akademischer Hochstapler und Asylbetrüger: Das war das Bild, das der Blick von Musey zeichnete. Und es war mutmasslich jenes, welches die Behörden von ihm hatten. Denn der Artikel stützte sich auf durchgesickerte amtliche Unterlagen und Auskünfte.
Wir suchen neue Beiträge für Geschichte Heute
In dieser monatlich erscheinenden Artikelserie beleuchten Expert*innen vergangene Ereignisse und wie sie unsere Gesellschaft bis heute prägen.
Befasst auch du dich intensiv mit einem geschichtlichen Thema, das für das Lamm interessant sein könnte? Und möchtest du dieses einem breiten Publikum zugänglich machen und damit zu einem besseren Verständnis des aktuellen Zeitgeschehens beitragen?
Dann melde dich mit einem Artikelvorschlag bei: geschichte.heute@daslamm.ch.
Die Episode zeigt aber auch: Musey verstand sich zu wehren. Er ging juristisch gegen den Blick vor. Wegen Ehrverletzung angeklagt gab die Zeitung beinahe ein Jahr später zu, Musey führe seine akademischen Titel zu Recht. Wirkliche Genugtuung erreichte er indes nicht. Die „Verleumdungskampagne” habe denn auch nicht aufgehört, kommentierte Musey später.
Was aber hatte es mit dem Asylgesuch und dessen Zeitpunkt auf sich? Hierfür muss man wenige Jahre zurückblenden. 1982 hatten Exiloppositionelle aus Zaïre, heute Demokratische Republik Kongo, das Genfer Büro der UNO-Mission ihres Herkunftslands besetzt. Dabei hatten sie eine Liste mit Personen gefunden, die vom Regime des berüchtigten Diktators Mobutu als potenzielle Staatsfeinde überwacht wurden. Musey gehörte dazu. Zwar stand er nicht ganz zuoberst auf der Liste, aber genannt wurde er eben doch.
Die Liste rief die Schweizer Bundesanwaltschaft auf den Plan, die Musey damals empfahl, Asyl zu beantragen. So erzählte er es ein paar Jahre später in seiner Autobiografie. Er entschied sich dagegen. Noch hatte er eine gültige Aufenthaltsbewilligung und war daran, sich an der Universität Bern zu habiliteren. „Profiteur, Untermensch, ein Niemand: So lautete das geläufige Bild der Asylbewerber”, erklärte Musey im Rückblick, weshalb er damals keinen Schutz beantragt hatte.

Kritiker der „Aktion Schwarzer Herbst”
Eine weitere mutmasslich folgenschwere Entscheidung fällte Musey im Herbst 1985. Wenige Monate nachdem er schliesslich doch um Asyl ersucht hatte, exponierte er sich als Kritiker der offiziellen Asylpolitik. Anlass war eine Grossrazzia unter zaïrischen Asylsuchenden, der die Behörden den tief blickenlassenden Namen „Aktion Schwarzer Herbst” gaben.
„Wie Vieh”, hiess es in Medienberichten, seien die 59 Verhafteten per Sonderflug nach Kinshasa verfrachtet worden. Mit seiner öffentlichen Kritik an der spektakulären Ausschaffungsaktion habe sich Musey keine Freunde bei den Behörden gemacht, weder in der Schweiz noch in Zaïre. So kommentierte es das Westschweizer Fernsehen später.
Was folgte, war ein zunehmend öffentlich ausgetragener Streit um das Bleiberecht der Familie Musey. Briefe, Verfügungen, Rekurse und Wiedererwägungsgesuche flogen hin und her. Es kreuzten sich offizielle Communiqués und Stellungnahmen mit solidarischen Protestaktionen. Rasch ging es in der Affäre Musey um mehr als das Schicksal der namensgebenden Familie allein: Auf dem Spiel stand die Glaubwürdigkeit der offiziellen Asylpolitik und ‑praxis als solche.
Den einen galt Mathieu Musey als besonders dreister „Pseudoasylant”, den anderen als Beleg für die rassistische Borniertheit des Schweizer Staats. Aufgelöst hat sich diese polarisierte Wahrnehmung nie. In der Affäre Musey stand Aussage gegen Aussage. Und dabei blieb es, bis die Angelegenheit nach einiger Zeit wieder aus den Schlagzeilen verschwand.
Auf wessen Seite steht das öffentliche Interesse?
Für die historische Forschung lässt sich die Affäre Musey bisher nur als Aussage-gegen-Aussage-Geschichte erzählen. Um zu verstehen, warum dem so ist, muss man die Ebene wechseln. Denn zur Geschichte der Affäre Musey gehört auch, wie schwierig es bis heute ist, sich archivbasiert mit der damaligen Rolle des Staats zu befassen.
Wie handelten die Behörden im Fall Musey hinter den Kulissen? Wie reagierten sie intern darauf, es nicht wie üblich mit einem anonymen „Asylanten” zu tun zu haben, sondern mit jemandem, der wortgewaltig auftreten und auf grosse gesellschaftliche Unterstützung zählen konnte?
Der Streit um die Akten zum seinerzeit umstrittensten Asylfall dauert nun schon gut vier Jahre. Im Mai 2018 lehnte es das Staatssekretariat für Migration (SEM) ein erstes Mal ab, die noch unter Schutzfrist stehende Asylakte von Mathieu Musey für die Forschung freizugeben. Dabei berief sich das SEM unter anderem darauf, das öffentliche Interesse spreche dagegen, Einsicht zu gewähren. Mit Blick auf das Archivrecht klingt diese nicht weiter ausgeführte Behauptung ominös.
Laut Verordnung zum Archivgesetz besteht nur in drei Fällen ein öffentliches Interesse an der Geheimhaltung archivierter Akten. Erstens: wenn die „innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft” gefährdet wird. Zweitens: wenn dadurch die „Beziehungen zu ausländischen Staaten, internationalen Organisationen oder zwischen Bund und Kantonen” dauerhaft beeinträchtigt werden. Drittens: wenn „die Handlungsfähigkeit des Bundesrates schwerwiegend” bedroht wird.
Was also könnte das SEM konkret meinen, wenn es auf öffentliche Interessen anspielt? Zeigt sich in den Akten etwa, dass die offizielle Schweiz in der Asylpraxis geneigt war, Rücksicht auf das Mobutu-Regime zu nehmen? Dieses unterhielt bekanntermassen äusserst enge Beziehungen zur Schweiz. Der Diktator mit der ikonischen Mütze aus Leopardenfell parkierte viel Geld in der Schweiz und residierte regelmässig in einer Villa am Genfersee. Das Herrschaftshaus mit 16 Zimmern und grossem Umschwung hatte der Schweizer Aussenminister Pierre Graber vermittelt, der gleich nebenan wohnte.
Von öffentlichen Interessen, die gegen die Einsicht sprechen, wollte das Bundesverwaltungsgericht nichts wissen, als es im Januar 2021 den Rekurs gegen den Entscheid des SEM beantwortete. Es verwarf die Behauptung des SEM in knappen Worten. Ähnlich kurzen Prozess machte das Gericht allerdings auch mit dem Argument, das öffentliche Interesse an der Aufarbeitung der Vergangenheit spreche für die Einsicht. Für ausschlaggebend hielt die zweite Instanz, was auch das SEM plädiert hatte: die privaten Interessen, sprich, den Daten- und Persönlichkeitsschutz der Familie Musey.
Wenn der Datenschutz dem Staat nützt
Der Streit um den Archivzugang zeigt: In Sachen Persönlichkeits- und Datenschutz kann der Staat plötzlich eine sehr ernste Miene aufsetzen, wenn er verhindern möchte, dass ihm jemand in die Karten respektive das Archiv blicken kann. Im Allgemeinen steht das Datenschutzrecht jedenfalls nicht im Ruf, die Privatsphäre der „kleinen Leute” besonders effektiv vor staatlicher oder grossunternehmerischer Neugier zu schützen.
Das Argument des Persönlichkeitsschutzes ist mit Blick auf das geltende Archivrecht umso erstaunlicher. Mit seiner Gesetzesbotschaft machte der Bundesrat nämlich 1997 eine klare Ansage: „Dem Schutzbedürfnis der Betroffenen steht immer ein legitimes – und häufig überwiegendes – Bedürfnis der Öffentlichkeit an der Aufarbeitung der kollektiven Vergangenheit gegenüber. Solche historischen Diskussionen sollen und können nicht durch eine Behinderung des Zugangs zu Quellen unterbunden werden. Forschung soll nicht immer durch den Hinweis auf potentielle Gefahren unterbunden werden.”
Die zitierte Passage war Grund genug, um den Fall dem Bundesgericht vorzulegen. Und siehe da: Anders als die zwei Instanzen ging das höchste Gericht darauf ein, die Gesetzesbotschaft sei für das Einsichtsbegehren relevant. Das Bundesverwaltungsgericht habe nicht korrekt abgewogen, was gegen und was für die verlangte Akteneinsicht spreche, lautet das kürzlich ergangene Verdikt aus Lausanne.
Deshalb muss das Bundesverwaltungsgericht das Anliegen im Licht des bundesgerichtlichen Urteils neu beurteilen. Unter anderem wird hierbei die Wissenschafts- und Forschungsfreiheit stärker berücksichtigt werden müssen, gab das Bundesgericht der Vorinstanz mit auf den Weg. Das ist eine gute Nachricht für alle, die historisch forschen.
Und die Moral von der Geschicht’?
In Bern wird Carl Albert Loosli auf einer Gedenktafel als „Mahner des Gewissens und Freund der Armen” erinnert. Ob es Grund gäbe, an der Looslistrasse eine weitere Gedenktafel anzubringen, ist noch offen. Jedenfalls ist es höchste Zeit, erforschen zu können, wie der Staat in der Affäre Musey hinter den Kulissen agierte. Die bisherige Erfahrung stimmt allerdings nicht optimistisch, dass der neue Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts rasch vorliegen wird.
Deshalb ist jetzt schon klar: Der Gang durch alle Instanzen taugt im Normalfall nicht, um die Interessen der historischen Forschung zu wahren. Es ist in juristischer und zeitlicher Hinsicht viel zu aufwendig, einer unwilligen Amtsstelle Archivzugang abzutrotzen. Dazu kommt: Das finanzielle Risiko beträgt schnell mal mehrere Tausend Franken.
Deshalb hält der Streit um die Akte Musey auch eine Lehre für die derzeit laufende Revision des Archivgesetzes bereit: Aus Sicht der Forschung – und des öffentlichen Interesses – sollte bei dieser Gelegenheit der Zugang zu archivierten Akten grundsätzlich liberaler und der Rechtsweg schneller, günstiger und griffiger gestaltet werden. Auch hier verweist der Fall Musey über sich selbst hinaus.
Jonathan Pärli ist Historiker an der Universität Basel. In seiner Dissertation hat er die Geschichte des asylpolitischen Aktivismus und Protests untersucht (Die andere Schweiz: Asyl und Aktivismus 1973–2000). Für seine Beständigkeit, um Archivzugang im Fall Musey zu erhalten, erhielt er im Juli 2022 den Forschungspreis lapis animosus der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 28 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1716 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 980 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 476 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?