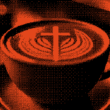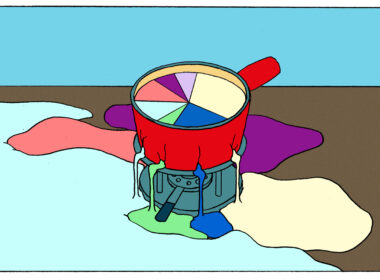„Liebe Patrioten in der Schweiz“, beginnt die E‑Mail, die eine linke Kleinpartei in Bern im Frühjahr 2024 erhält. „Ich sende euch eine Tabelle zur Anpassung und Erweiterung des ‚Patriotischen Fussabdrucks‘ für eure Nachwuchs-Schulungen und wünsche viel Erfolg!“ Die E‑Mail liegt das Lamm vor. Der Absender unterschreibt mit „Juventus“. Neben der linken Partei erhalten die rechtsextreme Junge Tat und die Identitäre Bewegung Schweiz die E‑Mail. Angehängt ist ein Dokument, das Einblicke in die Mobilisierungstechniken der Neuen Rechten gibt.
Die Aktionsgruppe Junge Tat (JT) prägt aktuell die rechtsextreme Szene in der Schweiz und erregte in den vergangenen Jahren immer wieder Aufsehen. Etwa mit Angriffen auf die Zürcher Pride oder die Kindervorlesestunden von Dragkünstler*innen. Früher waren die JT und ihre Vorgängerorganisation „Nationalistische Jugend Schweiz“ in der „Nationalen Aktionsfront“ (NAF) eingebettet. Diese pflegte Verbindungen zum Netzwerk „Blood & Honour“, das in Deutschland verbotenen ist. Bis heute ist die JT als Teil der Neuen Rechten gut mit rechtsextremen Gruppierungen in ganz Europa vernetzt und versteht sich als Teil der Identitären Bewegung.
Die Identitäre Bewegung (IB) ist ein völkisch-rassistisches Netzwerk, das in Österreich entstand und Ableger in ganz Europa hat. Ihre Exponenten bezeichnen sich als „Ethnopluralisten“: Sie vertreten die Auffassung, dass es verschiedene „Völker“ gäbe, die sich nicht vermischen dürfen. Die „europäische Identität“ sehen die Anhänger*innen der IB insbesondere durch eine angebliche „Islamisierung“ bedroht.
Teil ihres Verschwörungsglaubens ist, dass Medien und eine „Elite“ die weisse, christliche Bevölkerung gezielt durch Geflüchtete austauschen würden. Diese „Elite“ bezeichnen sie oft mit dem antisemitischen Begriff „Globalisten“, um sie so von der christlich-weissen Mehrheitsgesellschaft abzugrenzen. Anders als ältere rechtsextreme Bewegungen distanziert sich die IB öffentlich vom historischen Nationalsozialismus, um über das rechtsextreme Milieu hinaus Anschluss zu finden.
Wie die Junge Tat lässt sich auch „Juventus”, der Absender der verirrten E‑Mail, dem Universum der Identitären Bewegung zuordnen. Hinter seinem Namen steht „DO5”. So nennt sich eine Gruppe aus Wien, die aus der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) entstand. Die IBÖ und ihre Galionsfigur Martin Sellner sind in der europäischen Neuen Rechten tonangebend. In der Schweiz fiel Sellner zuletzt auf, als ihm im Oktober 2024 die Einreise verwehrt wurde. Und, als 2019 publik wurde, dass er Geldzahlungen vom rechtsextremen Attentäter von Christchurch erhalten hatte.
Nach den Terroranschlägen von Christchurch 2019 und den bekannt gewordenen Verbindungen des Täters zu Martin Sellner geriet die Identitäre Bewegung Österreich zunehmend unter Druck. Um den politischen Bedeutungsverlust auszugleichen, gründete Sellner die Gruppe “Die Österreicher”, die im Januar 2020 erstmals öffentlich auftrat. Ihr Ziel war es, auch ältere Bevölkerungsschichten anzusprechen. Die Abkürzung DO5 verweist auf die Widerstandsgruppe O5, deren Zeichen – ein Code für „Oe“, also Österreich, wobei die Ziffer 5 den fünften Buchstaben des Alphabets repräsentiert – die österreichische Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus während des Zweiten Weltkriegs verwendete.
Die Übernahme dieses Kürzels durch eine rechtsextreme Gruppierung verdeutlicht das Bestreben der organisierten Rechten, Begriffe in ihrer Bedeutung umzudrehen und neu zu besetzen. Ursprünglich in bürgerlich-konservativen Kreisen verwurzelt, knüpften “Die Österreicher” später Verbindungen zu Sozialdemokraten und Kommunisten. Die Themen der Gruppe entsprechen weitgehend denen der IBÖ, weshalb sie vielfach als Rebranding wahrgenommen wird.
Anders als in Österreich und Deutschland gelang es der Identitären Bewegung (IB) in der Schweiz nie, Fuss zu fassen. Die Website der IB Schweiz ist seit längerem offline. Umso überraschender sei es, dass die E‑Mail an die IB Schweiz adressiert wurde, findet Hans Stutz, Journalist und Beobachter der rechtsextremen Szene in der Schweiz. „Da hatte der Absender wohl wenig Ahnung über die rechten und rechtsextremen Strukturen in der Schweiz”.
Noch erstaunlicher ist jedoch: Warum war die linke Organisation aus Bern, die sich für eine offene Gesellschaft und gegen Rassismus einsetzt, auf der Empfängerliste des Dokuments der Rechtsextremen?
Der Irrtum
Die Organisation, die versehentlich zur Empfängerin der E‑Mail wurde, trägt einen bekannten Namen: Junge Alternative (JA!). Die linke Berner Jungpartei ist eine „Plattform für junge Menschen in der Stadt Bern”. „Juventus“ hat sie wohl mit einer Schweizer Version der wesentlich prominenteren Jungpartei der Alternative für Deutschland (AfD) verwechselt, die den gleichen Namen trägt. Die Jungpartei der AfD gilt laut dem deutschen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem und noch radikaler als die Mutterpartei. Die Rechtsextremismusexpertin und Politikwissenschaftlerin Anna-Sophie Heinze von der Amadeu-Antonio-Stiftung spricht von einem zentralen „Extremismustreiber“ und „Radikalisierungsmotor“ der Mutterpartei. Ende 2024 gab die AfD bekannt, sich von ihrer Jungpartei zu trennen und eine neue gründen zu wollen.
“Offensichtlich sind die Patrioten in der Verbreitung ihrer Unterlagen stümperhaft vorgegangen”.
Raed Hartmann, Mitglied JA!
Auf den Sozialen Medien würde die linke Jungpartei aus Bern JA! häufig mit Verwechslungen konfrontiert, erklärt Raed Hartmann, der seit 2021 Mitglied ist. „Wir sind schon seit mehr als 30 Jahren unter diesem Namen aktiv”, so Hartmann. Die junge AfD hingegen gründete sich erst 2013. „Wir haben zwar über ein Rebranding nachgedacht, uns dann aber dagegen entschieden”. Den Begriff der „Alternative” wolle man keinesfalls den Rechten überlassen. Die verirrte E‑Mail der Wiener Identitären sei sowohl „ein witziger Zufall” als auch beängstigend, da das Dokument die Anreize offenbare, mit denen Rechte ihre Mitglieder immer stärker in die Szene involvieren würden. „Offensichtlich sind die Patrioten in der Verbreitung ihrer Unterlagen aber stümperhaft vorgegangen”.
Das Dokument
Das interne Dokument der österreichischen Rechtsextremen listet in einer Tabelle ein Punktesystem für rechtsextreme Agitation auf: Für jede Handlung gibt es Punkte, die addiert die Stellung in der patriotischen Hierarchie bestimmen.
Zu Beginn des Dokuments ist angemerkt, dass „die Tabelle zur Berechnung des persönlichen jährlichen patriotischen Fussabdrucks” nicht alle Arbeiten der „patriotischen Führungseliten” enthalte, sondern lediglich dem „allgemeinen Patrioten” zur Orientierung diene. Tätigkeiten wie das Schreiben eines patriotischen Buches, das Organisieren einer patriotischen Demo und dergleichen fänden hier deshalb keine Erwähnung.
Für die Teilnahme an einer „patriotischen Demo” gibt es mit 100 Punkten die volle Punktzahl. Wer an einer „Werte-Demo” beziehungsweise „systemkritischen Demo” teilnimmt, erhält lediglich 80 Punkte. „Werte-Demos haben kulturkämpferische Absichten”, erklärt Hans Stutz. Damit könnten beispielsweise Veranstaltungen aus dem Milieu der Massnahmen-Gegner*innen oder der Massvoll-Bewegung gemeint sein, ebenso Anlässe von Abtreibungsgegner*innen. Beide haben gemeinsam, dass sie nicht explizit aus dem rechtsextremen Milieu entspringen, aber eine ideologische Nähe kultivieren. „Mit Kulturkampf versucht das rechte Milieu, alte gesellschaftliche Werte wieder durchzusetzen.“
Auch das Kleben eines patriotischen Stickers an einen „zulässigen Ort” wird mit einem Punkt belohnt.
Ebenfalls 100 Punkte erhält laut der Liste, wer eine öffentliche Rede hält oder in einem „patriotischen Video” sein „Gesicht zeigt”. Die Selbstverständlichkeit, mit der Rechtsextreme offen ihre Inhalte in den Sozialen Medien teilen, soll zur Normalisierung ihrer illiberalen Ideologien beitragen, erläutert Stutz.
Die volle Punktzahl erhält auch, wer bei „patriotischen Aktionen und der Arbeit im Bereich Alternativmedien” wie zum Beispiel der „Twitterreconquista” mitwirkt, also der Rückeroberung digitaler Räume. Die Vereinnahmung von Twitter ist gemäss der Einschätzung des Beobachters Stutz seit der Übernahme durch den rechtslibertären Multimilliardär Elon Musk bereits vollzogen. Auch auf TikTok trenden rechtsextreme Inhalte wie beispielsweise diejenigen der AfD, die durch ihre Präsenz auf der Plattform ihren Erfolg gerade bei jungen Wähler*innen deutlich steigern konnte.
Weitere 100 Punkte gibt es laut der Tabelle für die sogenannte Keilung einer Person. Die patriotischen Kämpfer sollen neue Mitstreiter*innen für ihre Anliegen gewinnen. 50 Punkte gibt’s für jedes Jahr oben drauf, in der die angeworbene Person aktiv bleibt. 100 Punkte erhält auch, wer eine Grossspende oder regelmässige Spende an eine patriotische Organisation vergibt, wobei weniger Geld weniger Punkte bedeuten. Ebenfalls 100 Punkte erhält laut der Tabelle, wer einen „Grossspender keilt“.
Lediglich 40 Punkte zahlt die Teilnahme an einer „halböffentlichen Kundgebung” aufs Patriotenkonto ein – etwa an einem „Bürgertreffpunkt” zwecks „Vernetzung”. Die Teilnahme an dieser Art Veranstaltungen verfolge denselben Zweck wie jene an den „Werte-Demos”: Rechtsextreme mischen sich strategisch unter rechtsbürgerliche Anlässe, um ihre Begriffe in die institutionalisierte Politik einzuführen, erläutert Stutz. Dies sei ihnen mit dem Begriff „Remigration“ auch gelungen. Autonome Rechtsextreme wie die Junge Tat oder die Identitäre Bewegung etablieren Narrative und Begrifflichkeiten, die wiederum von Parteien wie der SVP und AfD salonfähig gemacht werden, indem sie ihn offiziell in ihr Wahlprogramm aufnehmen und auf Wahlplakate schreiben.
“Patriotisch ist ein seit Jahrzehnten gebrauchter Ausdruck von Rechtsextremen, um das Wort rechtsextrem nicht zu benutzen.”
Hans Stutz, Rechtsextremismusbeobachter
Für das Verfassen eines Artikels für eine patriotische Zeitung gibt es nur 20 Punkte. Wer eine „patriotischen Idee” verbreitet, was nicht genauer definiert wird, darf sich zehn Punkte anrechnen. Das gleiche gilt für das „einmalige Überreden einer Person zu einer patriotischen Spende”. Es sei auffällig, so Stutz, wie häufig es laut der Tabelle um die Beschaffung von Spenden ginge.
Jeweils einen Punkt gibt es für das Verfassen eines Kommentars oder Leserbriefs sowie die Teilnahme an einer Umfrage „zwecks Beeinflussung der öffentlichen Meinung”. Auch das Kleben eines Stickers an einen „zulässigen Ort” wird mit einem Punkt belohnt. „All diese Strategien zielen darauf ab, den Kulturkampf zu Gunsten rechtsextremer Vorstellungen zu prägen”, sagt Stutz.
Und auch für’s Beten gibt es patriotische Punkte: Zehn, wenn das Gebet durch eine „zusätzliche Opferspende” – beispielsweise eine Kerze – begleitet wird, fünf Punkte pro „Gebet für die Heimat” in der Kirche und einen Punkt, wenn ausserhalb der Kirche gebetet wird. Laut Stutz sehnen sich Organisationen wie die Junge Tat nach alten Zeiten. „Der Kulturbegriff der Rechten verweist immer nach hinten, in die Vergangenheit”. Ausserdem seien viele Personen in der rechten bis rechtsextremen Szene fundamentalistische Christ*innen. „Im Umfeld der SVP gibt es einige davon; und unter den Abtreibungsgegner*innen sowieso.”
Auf die Punktetabelle folgt ein Ranking, mit dessen Hilfe die Patrioten ihren eigenen „Patriotischen Fussabdruck“ bewerten können. „Patriotisch ist ein seit Jahrzehnten gebrauchter Ausdruck von Rechtsextremen, um das Wort rechtsextrem nicht zu benutzen”, ordnet Stutz die Selbstbezeichnung ein. Jeder der zehn Stufen ist mit einem Zitat versehen: „Ich bewege nichts, solange ich mich nicht bewege”, steht in der untersten Stufe mit einem bis 50 Punkte. Danach geht es steil aufwärts: Vom „Patriotenanwärter” über den „aktiven Patrioten” bis hin zur fünften Stufe, in der man sich „nicht mehr aufhalten” lasse. Bereits auf Stufe sechs mit 450 bis 500 Punkten darf man laut Ranking von sich behaupten, mit „Stolz und Recht ein Patriot zu sein”. In der nächsten Stufe sei man dazu bereit, „ganz nach oben” zu gehen und in der siebten Stufe habe man die „unterste Stufe des patriotischen Heldenstatus” erreicht. Wer über tausend Punkte erzielt, gehöre zu den „Führungspersonen” und sei bereit „unser Land zurück zu holen”.

Laut Stutz zeige das interne Dokument die Vielfalt an Möglichkeiten, wie rechte Aktivist*innen versuchen, Politik zu machen, neue Leute zu gewinnen und bei der Stange zu halten. „Üblicherweise gewinnen rechte Strukturen über persönliche Kontakte Zuwachs.” In der Szene hiesse dies vor allem: von Mann zu Mann. Demonstrationen und Veranstaltungen seien beliebte Orte, um interessierte Personen näher in die Strukturen einzubinden.
Das Spiel der Rechtsextremen
Laut der Mail von „Juventus” dient das Dokument als Mittel zur Schulung des „patriotischen Nachwuchses”. Für Hans Stutz ist es eine Spielerei: „Es erinnert mich an Persönlichkeitstests in Klatschzeitschriften”. Die Neue Rechte bedient sich beim „Patriotischen Fussabdruck” Spielelementen wie der Rangliste und des Punktesystems, transferiert diese in spielfremde Kontexte und betreibt damit sogenannte Gamification.
Laut dem Verein ufuq, der sich der politischen Bildung widmet, sei das Ziel solcher Spielbausteine „die Motivation der Nutzer*innen zu steigern, um sie dazu zu bringen, bestimmte, zuvor definierte gewünschte Aktionen häufiger auszuführen”. Angetrieben durch den Wettbewerb würden sich Nutzer*innen länger oder häufiger engagieren. Der strategische Einsatz von Spielelementen durch extremistische Akteur*innen ist ein Beispiel für top down Gamification.
Statt von oben herab kann die Gamification aber auch organisch von unten (bottom up) aus den Communities selbst entstehen oder Radikalisierungsprozesse in Kleingruppen beeinflussen. So werden beispielsweise die „Erfolge” der Täter von Oslo oder Christchurch auf einer virtuellen Rangliste festgehalten, die in rechtsextremen Foren kursieren. Dort wird darüber diskutiert, wie man selbst einen neuen „Highscore“ an Opfern erreichen könne. Diese Spielstrategien kommen oft in digitalen Radikalisierungsprozessen zum Einsatz, zum Beispiel in Online-Communities wie dem Discord-Channel Reconquista Germanica. Dort koordinieren Rechtsextreme Aktionen, bei denen sie Kommentarspalten mit Hasskommentaren fluten.
Das Schulungsdokument „Patriotischer Fussabdruck” ist ein Beispiel für analoge Gamification: Initial funktioniert sie top down, da sie von etablierten Rechtsradikalen an ihren Nachwuchs gerichtet ist. Sie kann sich aber auch bottom up, innerhalb der neuen Generation entfalten und zu Höchstleistungen anregen.
Ob beim Punktesammeln durch das Schreiben von Hasskommentaren, beim Beten für die Heimat oder dem Überreden zu Grossspenden – stets gilt: Positive Verstärkung, Konkurrenzkampf, Unterhaltung und soziale Verbindungen sollen dabei helfen, menschenverachtende Inhalte mit positiven Gefühlen und Spass zu verknüpfen, um rechtsextreme Aktivist*innen zu Höchstleistungen zu motivieren.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 45 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2600 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1575 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 765 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?