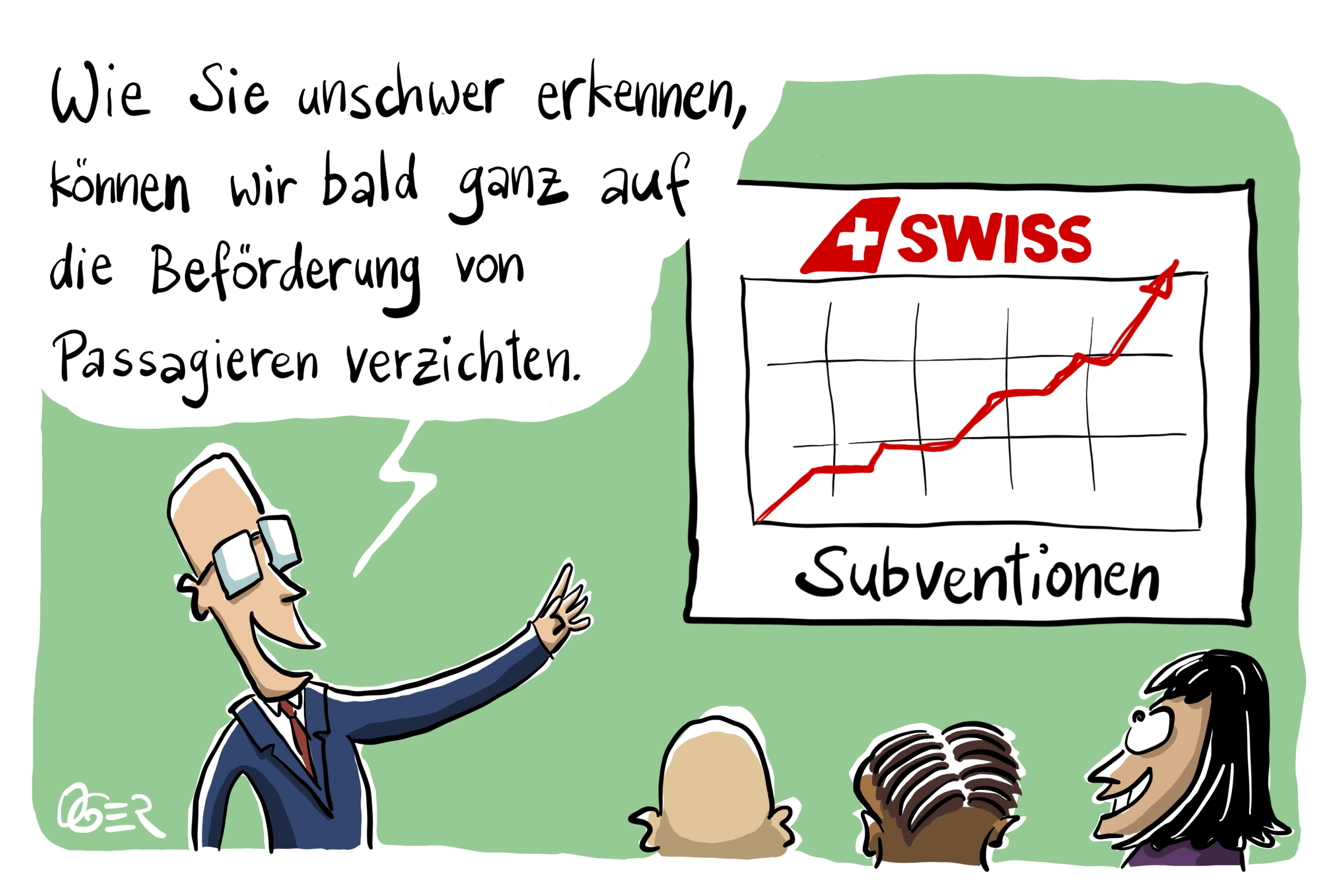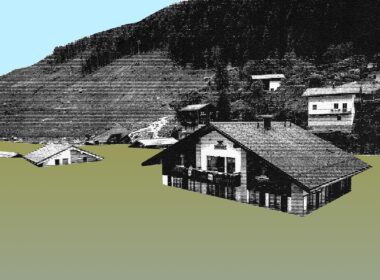Alles hat seinen Platz. Wenn es um Entsorgung und Abfall geht, nehme ich es so richtig genau. Ich reisse nicht nur bei den Brotverpackungen das Plastikteil in der Mitte raus, damit ich den Rest in die Papiersammlung geben kann. Ich bestehe auch darauf, dass wir die Weinkorken separat sammeln, weil man die bei gewissen Weinhandlungen zurückgeben kann. Als sich die Hausverwaltung unserer WG weigerte, eine Komposttonne hinzustellen, besorgte ich uns ein Kilo Rotwürmer, die seither unsere Rüeblischalen in einem sogenannten Wurmkomposter zu Erde und Dünger verarbeiten. Und wenn ich mit ein paar FreundInnen am See ein Bierchen trinke, nehme ich die leeren Dosen nach Hause, um sie richtig zu entsorgen.
Um richtig zu entsorgen, habe ich mich auch schon mit israelischen ZollbeamtInnen angelegt
Dem einen oder anderen wurde es auch schon zu dumm mit meinem Entsorgungswahn. Zum Beispiel dem Christopher, meinem Teamkollegen auf dem Tramprennen 2015. Ich sammelte nämlich in den ersten Tagen im Balkan, wo die Recyclingmöglichkeiten echt rar sind, in unserer Teamtasche sämtliche Kronkorken, die unser Bierkonsum hervorgebracht hatte. Alu in den Abfall schmeissen? Unmöglich für mich. Auch wenn ich sie einmal nach Nordalbanien und zurück tragen muss. Irgendwann hatte Christopher aber einfach genug und kippte die Dinger in den normalen Abfall.
Auch die israelischen ZollbeamtInnen waren von meinem Entsorgungswahn nicht gerade angetan. Auf meiner Überfahrt mit dem Frachtschiff von Italien nach Tel Aviv bunkerte ich nämlich eine Woche lang alle von mir leergetrunkenen PET-Flaschen und trug sie dann in meinem Rucksack von Bord, um sie in Israel korrekt zu entsorgen. Denn dem schiffseigenen, sehr improvisiert anmutenden Ofen, der sicherlich mit keinem einzigen Luftfilter ausgestattet war, wollte ich meine PET-Flaschen nicht überlassen.
Das brachte mir ein sehr langes Gespräch mit der israelischen Einreisebehörde ein, der ich nun erklären musste, wieso mein halber Rucksack mit PET-Flaschen vollgestopft war. Meine Einreise hat das nicht gerade erleichtert. Und auch wenn am Schluss alles gut ging, steht eins fest: Für diese ZollbeamtInnen war ich es ganz sicher: ein Freak.
Es ist einfach nicht geil, wenn man etwas nicht mehr findet
Ein Freund meinte einmal, ich erinnere ihn an seinen Werklehrer. Wenn man da nicht alles ganz genau an den richtigen Ort zurücklegte, wurde der richtig sauer. Da gab es eine ordentliche Standpauke. „Alles hat seinen Platz. Und da gehört es auch hin“, pflegte er dann zu sagen.
Ordnung muss sein. Genauso, wie das 120er-Schleifpapier nicht bei den 80er-Papieren versorgt werden soll, gehört die PET-Flasche in die PET-Sammlung, der Korken zurück zum Weinhändler und die Bierdose in die Alusammlung. Auch bei den gebrauchten Dingen brauchen wir nun mal eine Ordnung. Wieso? Die Antwort — und das mag überraschen -, ist genau die gleiche wie bei den Nägeln: weil wir sie sonst nicht mehr wiederfinden.
Werfe ich eine PET-Flasche in den Restmüll oder in die öffentlichen Mülleimer, dann versorge ich sie so richtig falsch. Denn in den meisten Gemeinden der Schweiz wird sie einfach verbrannt. Dadurch entschwinden die Kohlenstoffatome, aus denen die PET-Flasche besteht, als Kohlendioxidteilchen in die Luft. Und dort bleiben sie auch erst einmal eine Weile. Leider sind diese Kohlenstoffverbindungen in Form von atmosphärischem Kohlendioxid für uns nicht nur nutzlos, weil wir aus ihnen keine neuen PET-Flaschen herstellen können, sondern auch noch schädlich. Sie heizen das Klima an.
Nur wenn wir unsere Kohlenstoffatome aus der PET-Flasche eines Tages wieder in einer Erdölraffinerie finden, könnten wir sie erneut zu PET-Flaschen, Gurkenverpackungen oder Fleecejacken verarbeiten. Aber dieses „Kohlenstoffatom-Recycling” sei nicht so einfach, meint Helmut Jürg Weissert, bis Ende 2014 Professor für Sedimentgeologie und Spezialist für Kohlenstoffkreislauf-Geschichte an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich.
„Die Chance, dass diese PET-Kohlenstoffatome den Weg zurück finden werden in eine Ablagerung, die zu Erdöl wird, ist doch eher klein”, so Weissert. Zuerst einmal müssten sie über die Photosynthese wieder in eine Pflanze gelangen. Zum Beispiel in ein Blatt. Dann müsste dieses Blatt den Weg in den Ozean finden. Dazu müsste es im Herbst per Zufall statt auf den Boden in einen Bach fallen und über einen Fluss ins Meer transportiert werden.
Im Meer aber landeten die meisten Kohlenstoffatome in Kalkablagerungen auf dem Meeresboden, in sogenannten Karbonatsedimenten. Nur 1–2 Prozent der Kohlenstoffatome, die im Meer herumschwirren, gehörten laut Weissert zu den auserwählten Kohlenstoffen, die in eine Meeresalge eingebaut und per Zufall in einem Meeressediment abgelagert werden. Wenn dort dann noch genau der richtige Druck und die richtige Temperatur herrsche, dann könne es sein, dass wir die PET-Kohlenstoffe, die wir in einem unaufmerksamen Moment in einen öffentlichen Abfalleimer an der Zürcher Seepromenade geschmissen haben, nach ein paar Jahrmillionen in Form von Erdöl wiederfinden — und aus ihnen eine neue PET-Flasche herstellen können.
Ziemlich kompliziert. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass unser Kohlenstoffmolekül aus der verbrannten PET-Flasche als CO2 in der Luft bleibt und dort die Atmosphäre aufheizt. Vielleicht hätte man es besser erst gar nie aus den Erdöl-Reservoir raus geholt. Aber da wir das nunmal gemacht haben, sollte man es wenigstens dort versorgen, wo man es ohne eine Wartezeit von Jahrmillionen wiederfinden kann: in der PET-Sammlung.
Die Kehrichtsverbrennungsanlage ist oft der falsche Ort, um etwas zu versorgen
Auch für die Bierdose oder den Kronkorken ist die Kehrichtverbrennungsanlage — je nachdem, wo man sie in den Abfall schmeisst -, nicht die beste Option. Im Gegensatz zu den Kohlenstoffverbindungen aus der PET-Flasche verdünnisiert sich Aluminium aber nicht in die Luft, wenn man es verbrennt, sondern bleibt nach dem Verbrennungsvorgang in der Schlacke zurück und kommt je nach Anlage in die Deponie. Gut versorgt, wartete es dort auf bessere Zeiten. Ob diese verbuddelten Aluteilchen irgendeinmal den Weg zurück in die Bierdosenproduktion finden werden, steht in den Sternen. Für sie ist die Deponie auf nicht absehbare Zeit die Endstation. Dabei wäre es extrem viel schlauer gewesen, eine neue Dose daraus zu machen. Denn für das fehlende Alu muss nun neues Alu aus Bauxit hergestellt werden. Und das braucht sauviel Energie.
Zum Glück werden in modernen Kehrichtverbrennungsanlagen Aluminium und andere Metalle aus der Schlacke zurückgewonnen. Laut Michael Hügi vom Bundesamt für Umweltschutz holen 28 der 30 Schweizer Verbrennungsanlagen das Alu aus ihrer Schlacke raus, um es wiederzuverwerten. Wenn ich also weiss, dass ich mich gerade im Einzugsgebiet einer Verbrennungsanlage mit einer solchen Metallrückgewinnung befinde, könnte ich meine Dose auch ohne ein schlechtes Gewissen in den normalen Müll werfen, denn die Verbrennungsanlage sortiert für mich nach. Nur: Wer kennt schon die Grenzen der Sammelgebiete der 30 Schweizer Verbrennungsanlagen. Deshalb gehe ich lieber auf Nummer sicher und versorge die Dose in der Alusammlung. Zudem sei die Qualität der so zurück gewonnenen Metalle deutlich schlechter als wenn man sie separat sammelt, so Hügi. Alu gehöre deshalb, auch wenn die Kehrrichtsverbrennungsanlage mit diesen Rückgewinnungsverfahren eine gewisse Schadensbegrenzug betreibe, einfach nicht in der Müll.
Was für Alu und andere Metalle bei den meisten Verbrennungsanlagen in der Schweiz gilt, gilt aber bei weitem nicht für alle rezyklierbaren Rohstoffe. Ganz im Gegenteil: Das nachträgliche Rausfischen ist eher die Ausnahme. Laut Daniel Eberhard, dem stellvertretenden Mediensprecher von Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ), liege der Entscheid, was vom Abfall als Wertstoff gesammelt wird und was im Hauskehricht landet, bei den Stadtbewohnerinnen und ‑bewohnern. Das ERZ sortiere die Inhalte der Zürich-Säcke vor der Verbrennung nicht nach. Und das nicht nur in Zürich, sondern in der ganzen Schweiz, wie mir Hügi bestätigt:
„Das Recyclingsystem von Siedlungsabfällen wie Glas, Altpapier, PET, Alu etc. basiert auf der Trennung an der Quelle, d.h. durch die Konsument/innen, die dann das Sammelgut an die entsprechenden Sammlungsstellen in den Gemeinden oder Einkaufszentren selbst anliefern. […] Alle Abfälle, die mit dem Kehricht entsorgt werden, gelangen direkt in eine Kehrichtverbrennungsanlage, d.h. es gibt keine vorgängige Sortierung des Mülls nach verbleibenden Wertstoffen.„
Die Verantwortung, bei den gebrauchten Dingen Ordnung zu halten, liegt also trotz moderner Verbrennungsanlagen in erster Linie bei den Konsumenten und Konsumentinnen.
Ordnung hilft, die Menschheit zu retten
Mein Entsorgungsfieber hat sicherlich etwas Penetrantes. Genau wie die Standpauken des Werklehrers. Das ändert aber nichts daran, dass es Sinn macht, sowohl den Nagel als auch die PET-Flasche nicht an den falschen Platz zurückzulegen.
Manchmal wäre das vielleicht ein bisschen gemütlicher. Ginge schneller. Oder man müsste nicht so aufpassen. Aber alle, welche später kommen, haben halt das Nachsehen: Sie finden den Nagel nicht mehr oder sind darauf angewiesen, neues Erdöl aus dem Boden zu pumpen für ihre PET-Flaschen.
Vielleicht sind der Werklehrer und ich Freaks, wenn wir so penetrant auf die Ordnung der Dinge pochen. Aber alle, die nach uns kommen, werden dies zu schätzen wissen.
Tipp
Wer zu wenig Zeit oder Nerven hat, um sich selbst um die richtige Ordnung im eigenen Müll zu sorgen, dem empfehle ich ein Abo bei Mr. Green. Ab 17.- Franken pro Monat kümmert er sich für dich darum.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 24 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1508 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 840 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 408 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?