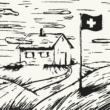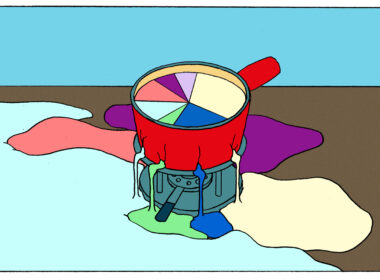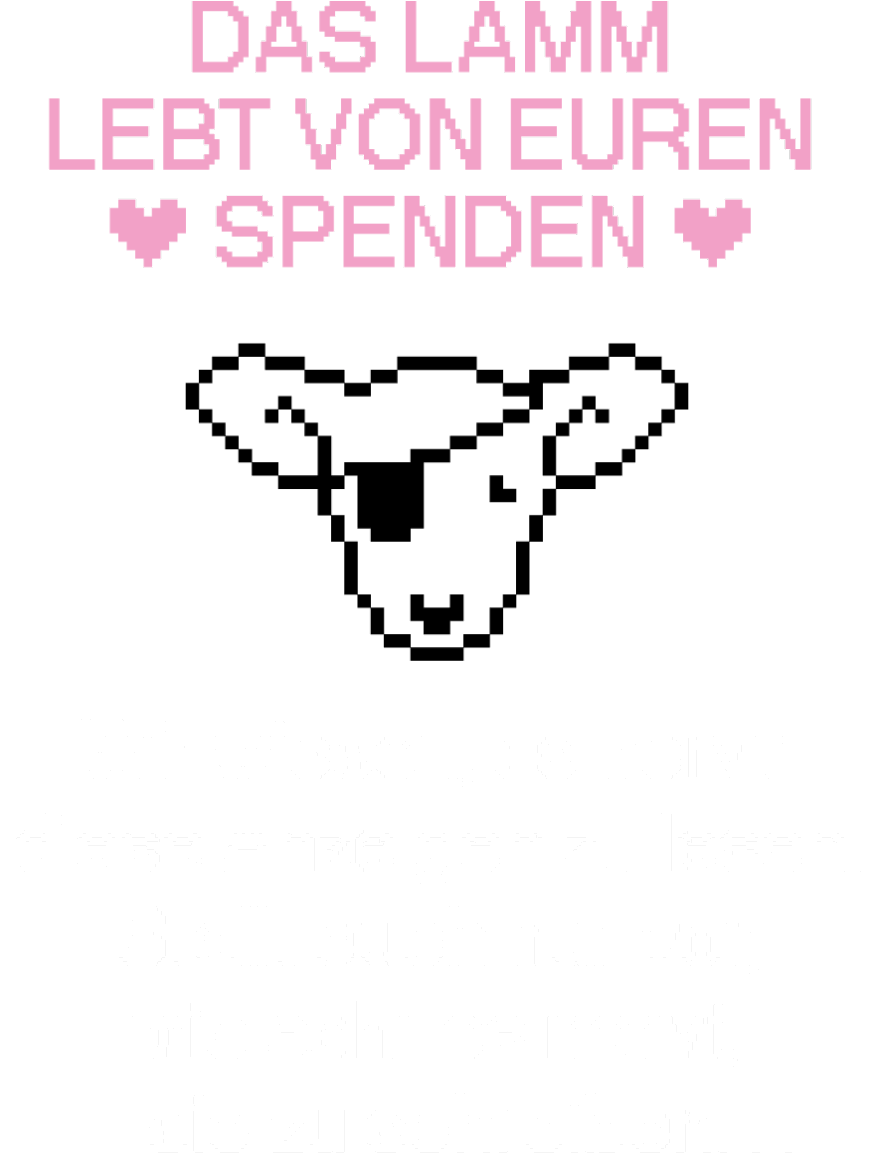Drei Milliarden Franken – so gross sei das Loch in der Bundeskasse. Schuld daran: die 13. AHV-Rente und die gestiegenen Militärausgaben. Also höchste Zeit, den Gürtel enger zu schnallen, verkündet die Schweizer Landesregierung. Deshalb hat der Bundesrat im Januar ein Gesetzespaket mit 59 Sparvorschlägen in die Vernehmlassung gegeben.
Die grössten Streichungsvorschläge betreffen den Klimaschutz, die Entwicklungszusammenarbeit und die Migration. So unterschiedlich diese Themen auch scheinen mögen– die vermeintliche Geldknappheit hat denselben Ursprung: Die Macht der Grosskonzerne.
Aber zuerst: Um was für Beträge geht es eigentlich?
Beim Klimaschutz will der Bundesrat insgesamt über 400 Millionen Franken weniger ausgeben pro Jahr. In der Entwicklungszusammenarbeit will er 2027 rund 100 Millionen streichen, 2028 sogar 170 Millionen. Auch bei der Migration setzt der Bundesrat den fetten Rotstift an – über 700 Millionen Franken will er bei der Integration von Geflüchteten und Menschen aus dem Globalen Süden sparen, die sich in der Schweiz ein neues Leben aufbauen möchten. Zudem hat das Parlament das Budget für die Entwicklungszusammenarbeit 2025 bereits um 110 Millionen Franken gekürzt. Je nach Jahr soll das sogenannte Entlastungspaket die Entwicklungszusammenarbeit und Migration also mit Kürzungen von 500 bis 1000 Millionen Franken belasten.
Diese Sparübungen könnte sich der Bund aber sparen – wenn er die Grosskonzerne fair zur Kasse beten würde.
OECD-Mindeststeuer: Mehreinnahmen falsch eingesetzt
Anstatt Ausgaben zu kürzen, könnte der Bund freilich die Einnahmen erhöhen – etwa durch zusätzliche Steuern. Das lehnt Finanzministerin Karin Keller-Sutter aber vehement ab. „Der Bundesrat verzichtet auf bedeutende einnahmenseitige Massnahmen, um die Bevölkerung und die Wirtschaft nicht noch weiter zu belasten”, ist im Bericht zum Sparpaket zu lesen. Und weiter: Die neue OECD-Mindeststeuer führe bereits zu Steuererhöhungen in Milliardenhöhe. Man rechne damit, dass die grössten Schweizer Konzerne dadurch 1.5 bis 3.5 Milliarden Franken mehr zahlen müssen.
Was sind das genau für Steuereinnahmen? „Es handelt sich um Gewinne von multinationalen Konzernen mit Sitz in der Schweiz, die einen Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro pro Jahr haben”, erklärt Dominik Gross, Steuerexperte bei Alliance Sud. Es geht also um die Gewinne von Firmen wie Roche, Nestlé, Holcim, Glencore oder ABB: die grössten Schweizer Rohstoffhändler, Pharmariesen, Schweizer Nahrungsmittel- und Industriekonzerne.
Die Kantone sind äusserts kreativ darin, Wege zu finden, das Geld an die besteuerten Konzerne zurückfliessen zu lassen.
Seit 2024 gilt die OECD-Mindeststeuer in der Schweiz. Über 130 Länder verhandelten ursprünglich über einen einheitlichen und weltweit gültigen Mindeststeuersatz, tatsächlich eingeführt haben ihn bislang erst 59 Länder. Wirklich gut voran kommt die Umsetzung also nicht.
Die Steuer beträgt 15 Prozent – im Vergleich mit dem globalen Schnitt von 24 Prozent Unternehmenssteuer also immer noch bescheiden, so Steuerexperte Gross. Trotzdem: Die gleichzeitige Einführung der Steuer in möglichst vielen Ländern soll verhindern, dass international tätige Firmen ihre Gewinne kaum versteuern, indem sie in Länder mit besonders tiefen Unternehmenssteuern flüchten. Also zum Beispiel in die Schweiz. Umso wichtiger ist es, dass die neue Mindeststeuer hierzulande griffig umgesetzt wird.
Nur: Der Grossteil dieses Geldes landet gar nicht beim Bund, sondern bei den Kantonen. Und diese sind äusserts kreativ darin, Wege zu finden, das Geld an die besteuerten Konzerne zurückfliessen zu lassen – sprich, die Steuer zu umgehen. Oder, wie es im Jargon der Standortförderung heisst: Den Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten.
In einem Tweet auf der Plattform X rechnete Professor Marius Brülhart von der Universität Lausanne jüngst vor, dass wegen dem inländischen Bankgeheimnis rund 500 Milliarden Franken an Vermögen nicht versteuert werden. Würden die Besitzer*innen auf diese Vermögen wie alle anderen Steuern bezahlen, brächte das der Schweiz jährlich mindestens 2.5 Milliarden Franken mehr ein, so Brülhart. Mit diesen Einnahmen brächte es keine Sparübungen.
Eindrücklich ist auch die Anzahl Steuersenkungen für Reiche und Unternehmen seit den 1990er Jahren. Die SP Schweiz nennt dies in einem Positionspapier eine „regelrechte Steuersenkungsorgie” und schätzt, dass dem Bund dadurch 7 bis 13 Milliarden Franken pro Jahr entgehen. Auch damit liesse sich das aktuelle Budgetloch leicht schliessen.
Ein Beispiel aus Basel-Stadt: Dort sollen die zusätzlichen OECD-Steuereinnahmen in einen Fonds fliessen. Die Summe ist gewaltig. Laut einer Recherche der WOZ werden jährlich bis zu 300 Millionen Franken zusammenkommen. Und was will der Kanton mit dem Geld machen? Künftig können Forschende in Basel-Stadt ihre Löhne aus diesem Steuertopf finanzieren lassen. Es ist gut möglich, dass der Kanton also in Zukunft die Personalkosten in den Forschungslabors von Novartis und Roche übernimmt. Dass das nicht dem eigentlichen Sinn dieser Mindeststeuer entspricht, dürfte klar sein.
Genauso fragwürdig ist, dass der Bund in seinem Sparprogramm die klimaschädlichsten Branchen weitgehend verschont.
„In der Debatte über die konkrete Einführung der Mindeststeuer haben wir gefordert, einen Drittel der Einnahmen für Projekte im Globalen Süden einzusetzen”, so Gross von Alliance Sud. Denn viele der Konzerne, die jetzt neu die OECD-Mindeststeuer bezahlen müssen, erwirtschaften einen erheblichen Teil ihres Gewinns in den Ländern des Globalen Südens, zahlen dort jedoch oft nur sehr wenig Steuern. Damit entgehen diesen Ländern wichtige Einnahmen.
Ein Drittel von 1.5 bis 3.5 Milliarden, das sind 500 bis 1200 Millionen Franken – also ungefähr gleich viel, wie nun bei Entwicklungszusammenarbeit und Migration eingespart werden soll.
Würden Grosskonzerne also nicht nur anständig besteuert, sondern die Einnahmen auch dort investiert, wo sie erwirtschaftet wurden, könnte man sich das Sparen getrost sparen. Dafür müsste der Bund einerseits alle Hintertürchen in der OECD-Besteuerung schliessen und andererseits sicherstellen, dass das Steuergeld nicht bei den reichen Standortkantonen der Konzerne hängenbleibt.
Grösste Klimaverschmutzer weiterhin verschont
Genauso fragwürdig ist, dass der Bund in seinem Sparprogramm die klimaschädlichsten Branchen weitgehend verschont – und zwar indem diese weiterhin keine CO2-Abgabe bezahlen müssen.
Anstatt die Abgabe von 120 Franken pro Tonne CO2 aus fossilen Brennstoffen zu zahlen, machen die grössten Emittenten der Schweiz – etwa der Zementhersteller Holcim, Chemie- und Pharmafirmen wie BASF, die Erdölraffinerie Varo oder der Stahlverarbeiter Steeltec – beim Emissionshandelssystem (EHS) mit. Diese EHS-Konzerne bezahlen, anders als viele KMUs und alle Privathaushalte, dadurch bis heute so gut wie nichts für ihre Emissionen.
Die Schweiz emittierte 2022 auf ihrem Territorium 42 Millionen Tonnen CO2. Fast die Hälfte davon fielen bei den Treibstoffen, den EHS-Firmen und den Firmen mit einer CO2-Zielvereinbarung an.
Die zweite Möglichkeit, wie sich Firmen von der CO2-Abgabe drücken können, ist die CO2-Zielvereinbarung. Dieses Instrument stand bis Ende 2024 nur Firmen aus besonders emissionsintensiven Branchen offen. Mit dem neuen CO2-Gesetz, das seit Anfang 2025 in Kraft ist, dürfen das nun alle Firmen machen. Unternehmen wie Nestlé, die Fleischverarbeiter Bell und Micarna, die Agrargenossenschaft Fenaco sowie die Ems-Chemie von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher haben beispielsweise eine solche CO2-Zielvereinbarung. Gemeinsam mit dem Bund legen sie in dieser Vereinbarung fest, welche Klimaschutzmassnahmen sie umsetzen müssen. Als Gegenleistung wird ihnen die CO2-Abgabe erlassen. Was genau in den Verträgen steht, weiss niemand, denn sie sind nicht öffentlich einsehbar.
Zudem gibt es in der Schweiz keine CO2-Abgabe auf Benzin oder Diesel. So zahlen die Unternehmen, die Strassentreibstoffe in die Schweiz importieren, diese Abgabe nicht. Zwar kostet auch das CO2 aus Treibstoffen etwas, weil die Importeure einen Teil kompensieren müssen, die Emissionstonne ist jedoch 5- bis 6‑mal weniger teuer als bei der CO2-Abgabe auf die Brennstoffe.
Ziehen wir also Bilanz: Die Schweiz emittierte 2022 auf ihrem Territorium 42 Millionen Tonnen CO2. Bei den Treibstoffen, den EHS-Firmen und den Firmen mit einer CO2-Zielvereinbarung fielen im selben Jahr rund 19 Millionen Tonnen CO2 an. Das ist fast die Hälfte aller auf Schweizer Boden ausgestossenen Treibhausgasen.
| Ausstoss [Tonnen CO2‑Ä] | Kosten, die via CO2-Abgabe anfallen würden [CHF] | |
| Emissionen aus Treibstoffen 2022 | 13.35 Mio (1) | 1602 Mio |
| Emissionen der EHS-Firmen 2022 | 4.35 Mio (2) | 522 Mio |
| Emissionen von Firmen mit einer CO2-Zielvereinbarung 2022 | 1.34 Mio (3) | 160 Mio |
| Total | 19.04 Mio | 2284 Mio |
Tabelle: Anfallende Emissionstonnen in den abgabebefreiten Sektoren und potentielle Staatseinnahmen, wenn die Firmen nicht von der CO2-Abgabe von 120 Franken pro Tonne befreit wären. Quellen: (1) Treibhausgasinventar der Schweiz, Stand April 2024. (2) Emissionshandelsregister, EHS Anlagenbetreiber, Abgabepflicht, Jahresberichte (oben rechts), 2022. (3) Überblick Verminderungsverpflichtung 2013–2022.
Würde die CO2-Abgabe nicht nur auf Brennstoffe, sondern auch auf Treibstoffe erhoben und wären die grössten Verschmutzer nicht von dieser Abgabe ausgenommen, könnte der Staat laut Berechnungen von das Lamm 2284 Millionen, also fast 2.3 Milliarden Franken mehr einnehmen. Davon würden unter den aktuellen Regeln zur CO2-Abgabe ein Drittel – also rund 760 Millionen Franken – für Klimainvestitionen eingesetzt.
Würden also wirklich alle die CO2-Abgabe zahlen, könnte man sich die Sparübungen auch im Klimabereich sparen.
Zu wenig sinnvolle Sparideen
Wer die Sparliste Punkt für Punkt durchgeht, entdeckt unter den 59 Vorschlägen vereinzelt auch sinnvolle Streichungen. So will der Bund grob geschätzt rund 100 Millionen Franken an klimaschädlichen Subventionen in der Fleischindustrie und der Luftfahrt streichen.
Der Bundesrat plant etwa, die sogenannte Absatzförderung für landwirtschaftliche Produkte um 10 Millionen Franken zu kürzen. Aus diesem Geldtopf fliessen unter anderem jedes Jahr mehrere Millionen an Proviande, die Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft, um Fleischwerbung zu finanzieren. Ob der Rotstift dann tatsächlich bei Proviande ansetzt, kann das zuständige Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung noch nicht sagen, da die Vernehmlassung noch laufe.
Eine andere Sparidee würde die Fleischindustrie jedoch mit Sicherheit treffen. Bis anhin beteiligt sich der Bund mit 48 Millionen pro Jahr an den Kosten, um Schlachtabfälle zu entsorgen. Diese Unterstützung soll nun wegfallen. Angesichts der Tatsache, dass die Fleischproduktion massgeblich für die Klimaerhitzung verantwortlich ist, ist es längst überfällig, diese versteckten Subventionen zu streichen. Zudem dürfen die Entsorgungsfirmen Tiermehl und Tierfett, das bei der Verarbeitung der Schlachtabfälle anfällt, teuer als CO2-neutral vermarkten – obwohl sie dafür fossile Brennstoffe einsetzen, wie das Lamm bereits vor zwei Jahren aufgedeckt hat.
Mit diesen Sparideen kriegt die Schweiz die Investitionen bei Klima, Entwicklungszusammenarbeit und Migration nicht gestemmt.
Auch die Luftfahrt soll mit dem neuen Sparpaket weniger Geld erhalten. Der Bund unterstützt die Regionalflughäfen derzeit mit 30 Millionen Franken jährlich für die Flugsicherung, was laut einer Recherche des Tagesanzeigers vor allem die Privatjet-Reisen von Superreichen verbilligt. Zudem übernimmt der Bund bei den Flughäfen Genf und Basel aktuell die Kosten für die Personenkontrollen am Zoll, während am Flughafen Kloten diese der Kanton Zürich trägt. Künftig sollen auch in Basel und Genf die Kantone zahlen, womit der Bund jährlich 22 Millionen Franken sparen würde.
Diese Beispiele zeigen: Über die Jahre haben sich einige Kuriositäten im Bundesbudget angesammelt. Nur: Mit diesen vereinzelt sinnvollen Sparideen kriegt die Schweiz die dringend notwendigen Investitionen bei Klima, Entwicklungszusammenarbeit und Migration nicht gestemmt – denn dort geht es nicht um Millionen, sondern um Milliarden.
Woher soll dieses Geld also kommen? Das Schweizer Recht hat eigentlich eine bestechend einfache Antwort parat: Das Verursacher*innenprinzip. Im Umweltbereich ist dieses Prinzip sogar auf höchster Ebene in der Verfassung verankert. Dort steht in Artikel 74: Die Verursacher*innen müssen die Kosten übernehmen, um Umweltschäden zu vermeiden oder zu beseitigen.
Dass die grössten Emittenten die Klimaprobleme massgeblich mitverursacht haben, ist klar. Umso höher sollte ihre finanzielle Beteiligung sein, wenn es um Klimaschutz geht – nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch im Globalen Süden. Dass globale Konzerne mit ihrer Steuerflucht zudem mitverantwortlich dafür sind, dass Länder des Globalen Südens nicht genug Staatseinnahmen haben, um Infrastruktur, Gesundheitswesen und Schulen so auszubauen, wie zu erwarten wäre, ebenso. Wo der Bundesrat also anklopfen müsste, um das Budget wieder ins Lot zu kriegen, liegt auf der Hand.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 39 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2288 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1365 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 663 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?