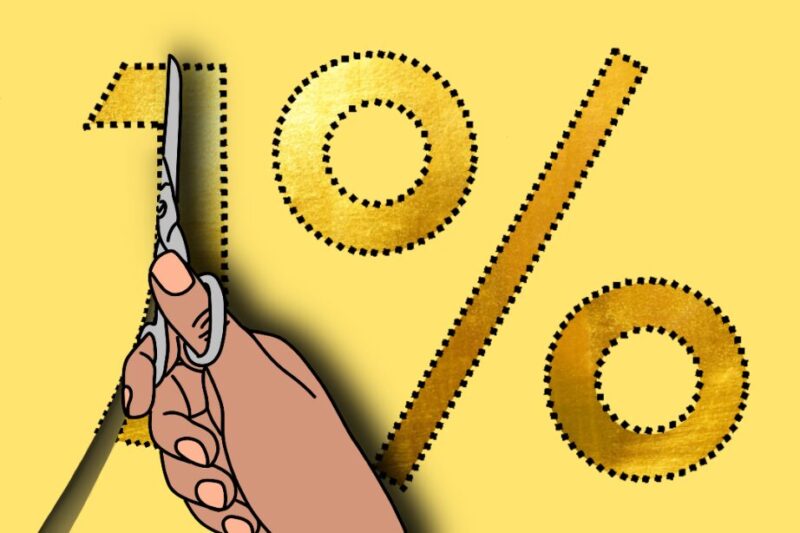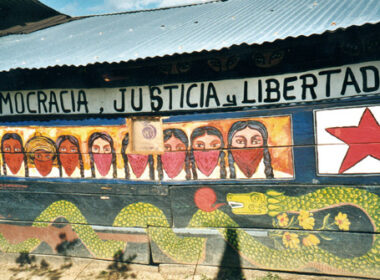Das Lamm: Sandino Scheidegger, Sie haben Folgendes ausgerechnet: Wenn ein Viertel aller Schweizer*innen ein Prozent ihres Einkommens abgibt, könnte der ganzen Bevölkerung in Sierra Leone ein Grundeinkommen von 30 Dollar pro Monat finanziert werden. Das klingt surreal.
Sandino Scheidegger: Die meisten Menschen sind bei dem Beispiel zuerst einmal überrascht. Doch diese einfache Rechnung hilft, sich die Dimensionen globaler Ungleichheit besser vorzustellen, zumal in Sierra Leone und der Schweiz ungefähr gleich viele Menschen leben.
Für 75 Personen in Sierra Leone finanziert das Projekt Social Income bereits ein Grundeinkommen. Wie kamen Sie zu dieser Idee?
Ich erhielt eines Tages einen Brief von meinem Arbeitgeber mit dem Angebot, 1.5 Prozent meines Lohnes steuerfrei in die zweite Säule einzuzahlen. Ich hielt das im ersten Moment für eine gute Idee. Je länger ich aber darüber nachdachte, desto absurder fand ich sie: Als Gutverdienender mit gesichertem Lohn würde ich einen ganz kleinen Betrag sparen, um in noch mehr Sicherheit zu leben, als mir bereits durch die AHV, die zweite Säule und meine Ersparnisse gewährleistet ist. In einem Land wie Sierra Leone hingegen kann ich mit 60 Schweizer Franken pro Monat direkt mehr bewirken. Und nicht erst in 35 Jahren, sondern bereits heute.
Und wieso genau ein Prozent?
Ein Prozent steht exemplarisch für Ungleichheit: Damit assoziiert wird das eine Prozent von Superreichen als Gegensatz zu den restlichen 99 Prozent.
Was dabei oft untergeht: Die meisten von uns gehören zum einen Prozent der Reichsten auf der Welt.
Das gilt besonders für die Schweiz, die mit ihrem Durchschnittseinkommen von 6’538 Franken pro Monat bereits deutlich über der Ein-Prozent-Marke von 4’000 Franken pro Monat liegt. Schaut man sich die Löhne von Vollzeitarbeitenden an, liegen in der Schweiz bereits 86 Prozent der Frauen und mehr als 95 Prozent der Männer über dieser Ein-Prozent-Marke.
Wie funktioniert Social Income?
Social Income verbindet drei Ansätze: die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens, direkte Bargeldtransfers für Menschen in Armut und die sich rasant ausbreitende Nutzung von Mobile Banking.
In westafrikanischen Ländern hat ein Grossteil der Bevölkerung zwar kein Bankkonto, aber 80 Prozent der Leute nutzen Mobile Money auf ihrem Handy. Man zahlt monatlich auf das Schweizer Konto von Social Income, das Geld wird auf ein Konto in Sierra Leone und von dort direkt auf die Telefone der Empfänger*innen überwiesen. 100 Prozent des gespendeten Betrages kommt bei den Empfänger*innen an. Die Administrations‑, Transaktions- und Fremdwährungskosten bezahlen wir mit Stiftungsgeldern.
Was ist das Ziel?
Unser langfristiges Ziel für die Schweiz ist es, dass ein Prozent der Bevölkerung ein Prozent ihres Einkommens an Social Income spendet. Das sind 80’000 Schweizer*innen, die einen Betrag von ungefähr fünf Millionen Franken pro Monat bereitstellen könnten. Damit könnten wir mehr als 160’000 Personen in Sierra Leone ein Grundeinkommen finanzieren. Das Ziel ist realistisch, weil ja bereits 500’000 Personen bei der Abstimmung zum Grundeinkommen die Idee in Grundzügen unterstützt haben. All diesen Personen muss die Idee gar nicht gross erklärt werden. Spenden kann man jedoch von überall. Es sind bereits Menschen aus zehn verschiedenen Ländern, die bei Social Income mitmachen.
Der Ansatz scheint sinnvoller als ein Grossteil der traditionelleren Entwicklungshilfeprojekte – er ist so einfach und günstig.
Sinnvoll ist, was wirkt. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass der Direkttransfer von Geld das effizienteste Mittel für Armutsbekämpfung ist. Die Forschung hat gezeigt, dass eben nicht nur diejenigen profitieren, die direkte finanzielle Hilfe erhalten, sondern ein viel grösserer Umkreis an Leuten, weil das Geld lokal investiert wird.
Und dann gibt es die Langzeitwirkung: Forschungsergebnisse zeigen, dass wer über eine längere Zeit Geld erhalten hat, auch später im Leben – ohne Geldtransfer – durchschnittlich mehr verdient. Diese Langfristigkeit ist massgeblich und immer mitzudenken. Social Income garantiert das Grundeinkommen für drei Jahre.
Wenn das so wirkungsvoll ist, weshalb wenden nicht mehr NGOs direkte Geldtransfers an?
Nicht alle Situationen können mit Bargeld gelöst werden. Wenn ein lokaler Markt oder die nötige Infrastruktur fehlt, sind andere Formen der Hilfe sinnvoller. Und natürlich ist es administrativ viel aufwändiger und teurer, etwa eine Schule zu bauen, als Geld auf Mobiltelefone zu versenden.
Mittlerweile werden aber bereits fast 20 Prozent des globalen humanitären Budgets mittels Cash-Projekten umgesetzt. Die Tendenz ist zum Glück steigend. Eine Pionierrolle kommt gerade der Schweiz zu. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) setzt seit 1998 Geldtransfers in der humanitären Hilfe ein, beispielsweise nach den Erdbeben in Albanien oder den Überschwemmungen in Nicaragua.
Täte die Schweiz nicht besser daran, Geldtransfers auch in der Armutsbekämpfung einzusetzen?
Die Schweiz setzt Cash-Programme vor allem in der humanitären Hilfe ein und kaum in der Entwicklungszusammenarbeit. Aber die Unterscheidung zwischen diesen Bereichen ist gar nicht mehr so trennscharf wie früher. Wir wissen jetzt schon, welche Personen in Zukunft am stärksten von kommenden Katastrophen betroffen sein werden, etwa Dürren oder dem steigenden Meeresspiegel. Personen, die bereits jetzt Geld erhalten, werden in einer besseren Lage sein, auf solche Katastrophen zu reagieren. Die Verbesserung der Resilienz rückt in der Entwicklungszusammenarbeit immer mehr in den Fokus, und Cashtransfers sind ein äusserst effizientes Mittel, um Resilienz zu stärken.
Aber trotzdem scheint in der Entwicklungszusammenarbeit die Akzeptanz von Geldtransfers nicht sehr gross. Oft wird die sogenannte Hilfe zur Selbsthilfe bevorzugt und Direktzahlungen mit Abhängigkeit gleichgesetzt.
Viele denken, wenn die Leute in einem Programm regelmässig Geld erhalten, seien sie enorm abhängig davon. Aber eigentlich trifft das Gegenteil zu: Sie können mit diesem Geld machen, was sie wollen, und wissen am besten, wie sie sich aus ihrer schwierigen Lage befreien können. Geldtransfers sind so gesehen die Hilfe zur Selbsthilfe, um der Armutsfalle zu entkommen.
Besteht in diesem Projekt aber nicht die Gefahr von White Saviorism, also dass weisse Menschen sich als Helfer*innen aufspielen, die mit ihrem verteilten Geld die Welt retten?
Die Idee unseres Projektes ist es ja genau, mit Geld Freiräume zu schaffen, anstatt zu sagen: „Wir wissen, was du brauchst.” Ich glaube also, diese Gefahr ist viel weniger gross als in anderen Projekten.
Wir haben auch bewusst kein Patenschaftsmodell gewählt, bei dem du die Person, die du unterstützt, kennen kannst. Damit fallen Erwartungen weg. Dazu kommt, dass auch Menschen aus Schwellenländern oder dem Globalen Süden ein Prozent ihres Einkommens für Social Income spenden.
Zudem ist ein Prozent ja so wenig. Eigentlich ist es eine Frechheit, dass es nur ein Prozent ist. Wegen des einen Prozents fühlt sich hoffentlich niemand als Retter*in.
Bei einem Einkommen von 4’000 Franken kann ein Prozent, also 40 Franken, aber bereits eine hohe monatliche Belastung sein.
Sicherlich gibt es in der Schweiz Situationen, wo eine Spende von einem Prozent des Monatslohns spürbar ist. Überrascht hat mich, dass bei Social Income gerade viele Leute mitmachen, die ein vergleichbar kleines Einkommen haben und teils auch noch in Ausbildung sind. Ich denke, es hat auch mit einem wachsenden Bewusstsein zu tun, dass die allermeisten Menschen in der Schweiz, auch bei einem geringeren Einkommen, systematisch bessere Chancen auf ein gutes Leben haben als Menschen anderswo auf der Welt.
Bei der Auswahl der Empfänger*innen wenden Sie das Kriterium an, dass sie aus Low-Income-Communities kommen müssen. Das widerspricht doch dem Grundgedanken vom bedingungslosen Grundeinkommen.
Das stimmt. Social Income ist insofern bedingungslos, weil die Personen das Geld ohne Bedingungen ausgeben können. Die Auswahl muss nach irgendwelchen Kriterien erfolgen und diese müssen nachvollziehbar und transparent sein.
Entwicklungszusammenarbeit ist hauptsächlich eine staatliche oder supranationale Aufgabe, wird also durch Steuergelder finanziert. Welche Bedeutung hat das Projekt im Hinblick darauf?
Wir sagen eben gerade nicht, Armutsbekämpfung sei nur Sache von staatlichen Institutionen oder internationalen Organisationen, sondern von uns allen. Globale Armut ist kein Schicksal, sondern ein menschengemachtes Problem und wir alle partizipieren zumindest zu einem kleinen Teil daran. Da ist es nicht zu viel verlangt, einen kleinen Beitrag von einem Prozent zu leisten.
Im Gegensatz zu staatlicher und supranationaler Entwicklungszusammenarbeit können wir viel freier agieren. Die traditionellere Entwicklungszusammenarbeit ist von grosser Bedeutung, aber diese Art der Hilfe ist sehr komplex und wird von unterschiedlichen Interessen oder diplomatischen Aspekten geleitet. Es ist kein Zufall, dass die Schweiz ihre Botschaft nicht in Freetown in Sierra Leone, sondern in Abidjan in der benachbarten Elfenbeinküste hat. Diese verfügt über grosse Kakaovorkommen und die Schweiz betreibt dort viel Handel.
Das Grundeinkommen wird auch auf supranationaler Ebene diskutiert. Die International Labour Organisation (ILO) etwa hat ausgerechnet, dass mit 0.7 Prozent des globalen Bruttoinlandprodukts – das wären drei Prozent des Betrags, den die G20-Regierungen 2009 zur Rettung des Finanzsektors angekündigt hatten – das Grundeinkommen für alle Menschen in einkommensschwachen Ländern mehr als 30 Mal bezahlt werden könnte.
Es gibt auch in der humanitären Hilfe bereits konkretere Ideen – etwa, dass das World Food Programme (WFP) künftig viel grossflächiger mit Geldtransfers arbeitet. Aber es passiert schlussendlich noch viel zu wenig. Auch neben der Finanzierung eines Grundeinkommens gibt es noch sehr viele praktische Hürden, gerade in Ländern, die keine funktionierenden Sozialsysteme haben. Bis wirklich etwas passiert, wird es noch lange dauern. Und bis dahin sollten wir uns nicht vor der Verantwortung drücken, auch individuell einen Beitrag für eine gerechtere Welt zu leisten.
Sie setzen dabei auf Freiwilligkeit. Glauben Sie daran, dass die „freiwillige Umverteilung von Wohlstand”, wie Sie schreiben, erreicht werden kann?
Wenn solche Projekte wachsen, können sie Aufmerksamkeit und politischen Druck erzeugen. Und ich glaube daran, dass auch wirtschaftliche Akteur*innen, denen soziale Gerechtigkeit etwas wert ist, bei unserem Projekt mitmachen werden. Zum Beispiel als Firma, die ein Prozent der Löhne der Mitarbeiter*innen an Social Income bezahlt. Vielleicht könnte dies in der Wirtschaft zu einer Selbstverständlichkeit werden.
Dies kann auch über einen finanziellen Beitrag hinausgehen. Wir sind als digitale Initiative auch immer angewiesen auf Entwickler*innen, die uns helfen, neue Ideen ins Digitale zu übertragen. Wir haben bereits Web- und App-Entwickler, die beispielsweise tagsüber bei Google und Apple arbeiten und abends für Social Income neue Features coden. Diese Zusammenarbeit möchten wir weiter ausbauen.
Kann es nicht problematisch werden, wenn sich Firmen dadurch einen sozialen Anstrich verleihen, während sich an den politischen Grundbedingungen, die globale Ungleichheiten immerzu verstärken, nichts ändert?
Ich sehe hier kein Entweder-oder. Solche Entwicklungen sollten parallel stattfinden. Viele Unternehmen sind sich der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und engagieren sich auf verschiedenste Weise. Klar, solche Engagements lassen sich prima mit Unternehmenswerten verbinden und werden entsprechend kommuniziert. Dies hilft aber auch potentiellen Kund*innen und Arbeitnehmenden bei der Orientierung. Sie sind es dann auch, die Erwartungen an die Firma stellen müssen, für bessere Grundbedingungen einzustehen, damit den Worten auch Taten folgen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 25 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1560 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 875 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 425 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?