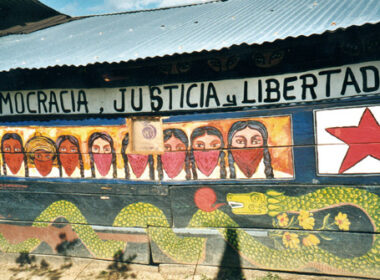Kerlys Culpa sitzt in einem neon-grünen Zelt unter einer Brücke. Es ist früher Morgen und via Handykamera zeigt sie ihr provisorisches Zuhause. Um sie herum stehen weitere Zelte, ein Mann lehnt an einem Zaun und raucht. Kinder spielen, neben ihrem Zelt steht Kerlys Rollstuhl.
Seit zwei Monaten lebt die 31-jährige Venezolanerin in Tuxtla Gutiérrez, Mexiko – zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern. Sie waren Teil einer Karawane, die sich Mitte Januar 2025 auf den Weg in die USA machte. Doch seit Trumps Amtsantritt stagniert die Reise.
Das Phänomen der Karawanen ist nicht neu. Seit Jahren prägen sie das Strassenbild im Süden Mexikos, denn als grosse Gruppe ist es weniger gefährlich, die 3’000 Kilometer durch das Land zurückzulegen.
Die Reise von Kerlys und ihrer Karawane zeigt, wie sehr Glück, Widerstandskraft und das richtige Timing über den Weg tausender Migrant*innen entscheiden und welchen Preis sie für ein bisschen Sicherheit und ein besseres Leben bereit sind, zu zahlen.
Einreise: Die Karawane formiert sich
„Ich wusste nicht, dass Trump gewonnen hatte, als ich Honduras verliess“, erinnert sich Leticia Isabel Albarado später. „Die Entscheidung zu gehen traf ich letzten Dezember.“ Die wirtschaftliche Lage in Honduras ist desaströs: Mehr als die Hälfte der Menschen lebt unter der Armutsgrenze, zwanzig Prozent sind unterernährt. Leticia arbeitete in einem Badeort für Tourist*innen. Trotzdem hatte sie oft tagelang nichts zu essen. Auf Facebook sah sie eine Anzeige für eine Karawane, in einer Whatsapp-Gruppe wurde später Datum und Treffpunkt bekannt gegeben. Ausgehend von San Pedro Sula in Honduras durchquerten sie in nur drei Tagen Guatemala, mit Bussen und Teilstrecken zu Fuss.
Wenige Tage nach ihrem Aufbruch findet Leticia sich in Tecún Umán wieder. Es ist der 10. Januar, noch zehn Tage bis zu Trumps Amtsantritt. Als sich der Morgendunst der kleinen guatemaltekischen Grenzstadt lichtet, versammeln sich die Mitglieder der Karawane. Auch Kerlys und ihre Familie schiessen sich der Karawane an.
Die meisten kommen wie Leticia aus Honduras, andere aus Nicaragua und El Salvador. Kerlys und junge Familien aus Venezuela haben schon einen längeren Weg hinter sich. Sie durchquerten den Darién-Regenwald zwischen Panama und Kolumbien, der als eine der riskantesten Migrationsrouten der Welt gilt. Neben der Kriminalität führen etwa auch Giftschlangen oder das Dengue-Fieber dazu, dass viele die Passage nicht überleben.

Als sich die Gruppe frühmorgens in einem Kreis versammelt, treten zwei Frauen hervor und geben letzte Anweisungen vor dem Übertritt nach Mexiko. Sie bestreiten diesen Weg nicht zum ersten Mal. Um nicht als Schmuggler*innen zu gelten und Repressalien zu riskieren, halten sie sich kurz: „Wir laufen so schnell wie die Langsamsten! Die alleinstehenden Männer helfen den Müttern mit ihren Kindern! Wir steigen in keine Fahrzeuge ein!“ Nur so kann verhindert werden, dass sich die Karawane zerstreut und damit angreifbar macht.
In einigen Regionen Mexikos haben kriminelle Banden sich darauf spezialisiert, Migrant*innen auszurauben oder zu kidnappen. Grosse Gruppen zu überfallen, ist dagegen nicht so einfach. Auch die mexikanischen Behörden haben es bei Festnahmen schwerer und benötigen mehr Personal und Koordination.
Ähnlich wie die EU betreiben die USA seit den 1990er Jahren eine Externalisierung ihrer Grenze gegen Süden – im Tausch gegen Handelsvorteile für Mexiko.
Nach der Zustimmung der Teilnehmer*innen zu den verkündeten Regeln beten alle gemeinsam. Danach geht es los zum Fluss.
Obwohl es ins mexikanische Ciudad Hidalgo einen offiziellen Grenzübergang über eine Brücke gibt, wählt auch die lokale Bevölkerung stets den Fluss, den man mit Flössen überqueren kann. Die Soldaten des in Sichtweite liegenden Grenzkontrollpostens interessieren sich nicht für das Treiben auf dem Wasser. Auch nicht, als die gesamte Karawane sanft auf aufgeblasenen Lkw-Schläuchen dem mexikanischen Ufer entgegentreibt.

Wieder an Land nehmen die Menschen ihren Weg auf. Am Grenzhäuschen stellt sich ihnen ein Beamter in den Weg, flankiert von Soldat*innen. Er erklärt, sie dürfen offiziell nur mit einer Registrierung in Mexiko bleiben – und selbst dann nur in Chiapas. Das interessiert die Karawane nicht, sie zieht weiter. „Wir lassen sie laufen“, sagt ein Soldat. „Ein paar Stunden unter dieser Sonne, dann kommen sie freiwillig mit.“ Die Beamten folgen der Karawane in einem Sprinter im Schritttempo. Noch 37 Kilometer bis zum heutigen Etappenziel Tapachula.
Über Stunden läuft die Gruppe entlang einer Schnellstrasse. Einige Kinder werden im Buggy geschoben, Kerly hält ihr Baby im Arm, ihr Mann schiebt die beiden. Die Sonne brennt, es gibt kaum Schatten auf dem Asphalt und die ersten Blasen machen sich bemerkbar. Als das Wasser knapp wird und die Kinder immer erschöpfter, kippt die Stimmung bei einigen. Der Konsens um das Tempo der Langsamsten löst sich Stück für Stück. Schliesslich akzeptieren vor allem die Familien mit kleinen Kindern das Transportangebot der Migrationsbehörde um den Preis ihrer Registrierung.
Mit der Militarisierung der Grenze ist in Chiapas 2021 ein bewaffneter Kampf von Kartellen um den Menschenschmuggel und die Transitrouten ausgebrochen.
Eine Mutter kann einen Busfahrer des Nahverkehrs überzeugen, sie mitzunehmen. Dieser bringt sich damit doppelt in Gefahr. Wird er von der Polizei erwischt, droht ihm eine Strafe als „Schlepper“. Schlimmer wäre es allerdings, wenn die lokale Gruppe der organisierten Kriminalität davon Wind bekäme. Sie kontrollieren die Route und das Geschäft mit der Migration. Wer sich – und sei es aus Menschlichkeit – in dieses Business einmischt, bringt sich in Lebensgefahr.
Durchreise: Gefährliches Chiapas
Die Migrant*innen durchqueren in Chiapas ein Gebiet, aus dem sogar die lokale Bevölkerung flüchtet. Ähnlich wie die EU betreiben die USA seit den 1990er Jahren eine Externalisierung ihrer Grenze gegen Süden – im Tausch gegen Handelsvorteile für Mexiko. Dabei gehen die Kontrolle des Drogenhandels und der Migration miteinander einher.
Mit der Militarisierung der Grenze ist in Chiapas 2021 ein bewaffneter Kampf von Kartellen um den Menschenschmuggel und die Transitrouten ausgebrochen, der auch die lokale, zu grossen Teilen indigene Bevölkerung bedroht. Ihnen drohen Schutzgelderpressungen und Zwangsrekrutierung. Das Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de Las Casas dokumentierte allein für die Jahre 2023 und 2024 über 16’000 Binnenvertriebe in Chiapas.
Auch die Menschen aus der Karawane sind auf der Flucht. Eine Mutter flüchtet mit ihrer Tochter, die Morddrohungen ihres Exfreundes erhielt. Marta Torres (Name geändert), die mit Leticia aus Honduras kommt, flüchtet vor ihrem Ehemann. Andere flüchten vor dem Abstieg in die Armut. Sie wollen, dass ihre Kinder die Chance auf eine Ausbildung erhalten, statt bei den „Maras“, den kriminellen Jugendbanden Zentralamerikas, oder unschuldig im Gefängnis zu landen. Für die meisten sind es würdige Gründe, die sie auf einen unwürdigen Weg treiben.

Die Nacht ist schon hereingebrochen, als die letzten am ersten mexikanischen Etappenziel in Tapachula ankommen. Die Hälfte der Karawane ist die Strecke komplett gelaufen. Andere werden gegen Mitternacht von der Migrationsbehörde am Stadtrand von Tapachula auf die Strasse gesetzt. Da sie einen Teil der Strecke mit dem Kleinbus der Behörde gefahren sind, mussten sie sich registrieren lassen. Werden sie in Zukunft von der Polizei irgendwo in Mexiko aufgegriffen, wird man sie immer wieder nach Chiapas zurückschieben.
Obwohl es in Tapachula mehrere Migrant*innenherbergen gibt, schlafen die meisten in Parks oder in billigen Unterkünften. Aus Sicherheitsgründen schliessen die Herbergen ihre Tore am späten Nachmittag – zu gross ist die Gefahr, dass zu später Stunde bewaffnete Banden oder auch die Polizei zur allgemeinen Schikane gegen die ehrenamtlichen Strukturen in die Herbergen dringen.
Wer einmal einen Asylantragstermin bekam, der*dem stand die Tür in die USA so gut wie offen.
Von Tapachula aus startet die Karawane erst am nächsten Nachmittag und zieht über Nacht weiter – die Sonne ist schlimmer als die Angst vor nächtlichen Überfällen. So machen sie es von hier an jeden Tag, jede Nacht, bis Etappenziel Nummer 6: Pijijiapan. Die Karawane ist mittlerweile zweihundert Kilometer gelaufen, hat den Bundesstaat gerade erst zur Hälfte durchquert. Noch fünf Tage bis zu Trumps Amtsantritt.
Vor Pijijiapan stoppen das Militär und die Migrationsbehörde die Gruppe. Einige, besonders die Alleinreisenden, können fliehen und die Kontrolle umgehen. Andere werden festgenommen. Ein Bus bringt Leticia und Kerly in die chiapanekische Landeshauptstadt Tuxtla Gutiérrez, eine andere Gruppe wird nach Oaxaca gefahren. Jene die flüchten konnten, bilden eine neue Karawane. Angewachsen auf 250 Menschen passiert diese am 23. Januar die Grenze zwischen den mexikanischen Bundesstaaten Chiapas und Oaxaca. Doch Trump machte auch ihren Plänen einen Strich durch die Rechnung.
Stillstand: Zerbrochene Hoffnung auf einen Asyltermin
In Tuxtla Gutiérrez werden Kerly und ihre Familie von der Migrationsbehörde registriert und danach wieder auf freien Fuss gesetzt. Seither sind sie auf der Strasse, leben vom Betteln und wohnen zusammen mit anderen Migrat*innen im Zelt. Beim Betreten Mexikos hatte sich Kerlys online auf der App CBP One für einen Asylantragstermin angemeldet. Für Menschen mit Papieren war dies seit der Biden-Adminstration der sicherste Weg in die USA. Wer einmal einen Termin in einem der US-Einwanderungsbüros in den verschiedenen Bundesstaaten Mexikos bekam, der*dem stand die Tür in die USA so gut wie offen.
„Je mehr die Migration eingedämmt und die Grenzen durchgesetzt werden, desto höher sind die Kosten.“
Ledón Pereyra, NGO Voces Mesoamericanas
Über 930’000 Menschen erhielten so seit Januar 2023 legale Aufenthaltspapiere für die USA. Einzige Ungewissheit blieb, wann man diesen Termin bekam. Viele Menschen warteten Monate auf die gute Nachricht. Kerlys hat Glück und wartet nur wenige Tage. Ihr Termin fällt auf den 21. Januar. Einen Tag vorher, zu Trumps Amtsantritt, macht sie sich mit ihrer ganzen Familie erneut auf den Weg nach Tapachula, wo die Vorladung stattfinden soll. „Als wir aus dem Bus stiegen, war die App plötzlich inaktiv. Später bekamen wir eine E‑Mail. Alle Termine wurden abgesagt.“

Allein im Dezember 2024 überquerten noch rund 300’000 Menschen auf legalen sowie illegalisierten Wegen die Grenze. Doch mit Trumps Amtsantritt hat sich nicht nur für Kerlys vieles geändert. „Wir erleben eine vollständige Umgestaltung dessen, was wir als Migrationssystem kennen,“ sagt Aldo Ledón Pereyra von der südmexikanischen NGO Voces Mesoamericanas. Die Organisation, die sich heute stärker der Arbeit mit rückkehrenden mexikanischen Migrant*innen widmet, hat über Jahre hinweg die Karawanen begleitet und Menschenrechtsverletzungen dokumentiert. Obwohl die Zahl täglicher Abschiebungen mit 600, niedriger ist als der Durchschnitt von 750 unter Biden, sind es vor allem der aggressive Ton und die rassistischen Praktiken der neuen Administration, die die USA in kürzester Zeit in einen feindlichen Ort verwandelten.
„Trump steht für Rassismus, Diskriminierung, Hassrede und Rechtsextremismus, und viele Menschen identifizieren sich mit diesen Elementen seiner Agenda.“ Die Ungewissheit lässt Menschen auf dem Weg in die USA zweifeln, ob die lange Reise sich lohnt und wie hoch der Preis ist, den sie bereit sind zu zahlen. „Je mehr die Migration eingedämmt und die Grenzen durchgesetzt werden, desto höher sind die Kosten“, berichtet Ledón Pereyra.
Nach dem Ende der CBP One App ist die Migration in die USA wieder zu 100 Prozent illegalisiert.
Für die Schleppernetzwerke zahlte man in den letzten Jahren 8’000 bis 10’000 Dollar für die Route. Auch wer ohne Schlepper reist, muss immer wieder Geld für Unterkünfte, Wegzoll und punktuelles Schutzgeld an lokale Gruppen zahlen. Der Menschenrechtsverteidiger Ledón Pereyra schätzt, dass die Kosten bald die 20’000 Dollar-Marke knacken werden. Und nicht nur die finanziellen Kosten sind ausschlaggebend. Nach dem Ende der CBP One App ist die Migration in die USA wieder zu 100 Prozent illegalisiert. Da es keine sicheren Fluchtrouten gibt, sind die physischen und psychischen Belastungen für die Menschen immens.
Neustart: Zurück auf Los
Nachdem Militär und Migrationsbehörde die Karawane im Süden von Chiapas aufgelöst hatten, entschieden sich Leticia und ihre Freundin Marta für die Route der „Bestie“ durch den Bundesstaat Veracruz. Der Güterzug, auf dessen Waggondächer die Migrant*innen gegen Norden reisen, trägt seinen Namen nicht umsonst. Da er über Tage nicht hält, müssen die „blinden Passagiere“ bei voller Fahrt auf- und abspringen. Das ist nicht ungefährlich, vor allem wenn man das Gebiet nicht kennt, und sowohl kriminelle Banden als auch die Polizei Jagd auf die Migrant*innen machen. „Irgendwann mussten wir runter, aber einer sprang nach vorne,“ erzählt Leticia. Der Jugendliche verlor sein Bein unter den Rädern des Zuges. „Aber da mich die Soldaten verfolgten, konnte ich nicht sehen, ob ich den Jungen kannte oder nicht. Ich wurde einfach mitgenommen.“
Die Migrationsbehörde brachte sie daraufhin wieder hunderte Kilometer zurück in den Süden Mexikos nach Villahermosa. Die mexikanische Migrationspolitik gleicht einem Monopoly-Spiel: Zurück auf Los.

Nach diesem Erlebnis entscheiden Leticia und Marta, nach Honduras zurückzukehren. Marta hatte Drohungen von verschiedenen Marabanden erhalten, war schon innerhalb von Honduras mehrmals umgezogen, und litt zuletzt unter der Gewalt ihres Ehemannes. Nun ist sie zurück bei eben jenem gewaltvollen Mann, in einem Land, das die höchste Rate an Feminiziden in ganz Lateinamerika hat.
Andere Mitglieder der Karawane hatten mehr Glück. Eine junge Familie schaffe es ohne grössere Zwischenfälle bis in den Norden Mexikos. In Monterrey arbeiten sie nun in einem Restaurant. Wenn die Grenze nicht bald öffne, wollen sie ihre Kinder in Mexiko in die Schule schicken. Ein junger Mann aus El Salvador entschied sich, in Oaxaca zu bleiben. Er eröffnete mit neuen Freunden aus der Karawane eine Motorradwerkstatt. Auf Whatsapp postet er täglich Bilder von seltenen Ersatzteilen.
Die migrationsfeindliche Politik Trumps hat dazu geführt, dass sich die Wege der Migration verändern. Doch unterbinden können die USA die Flucht von Menschen über Kontinente hinweg nicht. Auch Kerlys bleibt zuversichtlich. „Die USA ist mir nicht wichtig, langfristig wollen wir sowieso nach Kanada,“ sagt die junge Frau lächelnd, in ihrem Zelt sitzend. „Ich weiss nicht, wie ich es sagen soll, aber ich weiss einfach, dass wir es schaffen werden.“ Kerlys hat mit ihrer Familie und im Rollstuhl sitzend über 4.000 Kilometer auf dem Landweg zurückgelegt. Wer diesen Weg bezwungen hat, für die ist eine Trump-Administration keine Hürde mehr.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 54 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 3068 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1890 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 918 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?