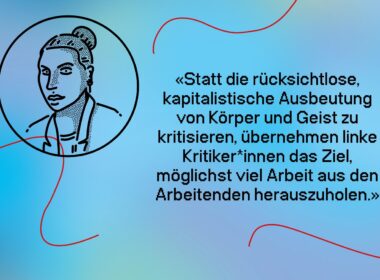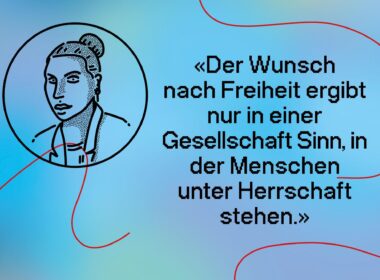David gegen Goliath, das heisst klein gegen gross, Knechtschaft gegen Herrschaft, unten gegen oben. Gegen die Goliaths unserer Gesellschaft zu schreiben, setzt voraus, zu wissen, warum man das tut. Es bedeutet, immer wieder zurückzugehen, an den Anfangspunkt, in den Alltag und zu den Lebensbedingungen der Menschen. Worunter leiden sie? Was sind ihre Strategien der Gegenwehr? Was ihre Formen und Ästhetiken des Widerstands?
In meinem Essayband „Von der namenlosen Menge” beschäftige ich mich mit denjenigen, die unten geblieben sind. Egal ob sie prekär arbeiten, hinter Knastgittern sitzen, die Dächer der Stadt besteigen oder um einen Umgang mit dem Tod der Partnerin ringen: Für die Recherche zum Buch habe ich Menschen aus meiner Familie und aus meinem Umfeld in ihrem Alltag begleitet.
Nur ein Bruchteil von dem gesammelten Material ist im Essayband gelandet. Diese Gesprächsprotokolle sollen eine Ergänzung darstellen. Im Stil der Protokollliteratur sprechen meine Tante, ein alter Bekannter, der längere Zeit wegen des Sprengens von Geldautomaten im Gefängnis sass, und ein Writer aus Hamburg-Altona, dem Viertel, aus dem auch ich stamme, über Leben, Leiden und Lieben in unserer Gesellschaft. Die Interviews wurden zwischen 2022 und 2023 geführt.
Anne, 62 Jahre
Ich bin in Billstedt aufgewachsen, da leben viele vom Sozialamt, meine Eltern damals nicht, aber wir hatten trotzdem nicht viel Geld. Als Kind habe ich mit den Rom*nja- und Sinti*zze-Kindern aus dem Viertel gespielt. Wenn ich Ärger mit irgendwelchen Schnöseln hatte, kamen meine Freund*innen – und die anderen Kinder sind weggelaufen.
Als ich mal bei meinen Freund*innen zu Hause war, haben mir die alten Opas und Omas ihre Nummern vom Konzentrationslager gezeigt. Damit wusste ich damals noch nichts anzufangen, dafür war ich noch zu jung. Durch die Kinder habe ich auch das Klauen gelernt. Die sind immer in den Edeka-Laden gegenüber der Wohnung, wo meine Mutter später gewohnt hat, mit sechs Leuten rein, haben sich die Taschen vollgemacht und sind wieder rausgegangen. Das habe ich mitgekriegt und fand es faszinierend.
„Ich habe mich immer an die Leute gehalten, die so waren wie ich. Also an diejenigen, die auch gewalttätige Väter hatten, die ohne Geld waren, die Underdogs.”
Anne, 62 Jahre
Ich glaube, ich war schon immer so. Ich wusste, dass ich nicht mithalten kann mit der Gesellschaft. Ich habe mich immer an die Leute gehalten, die so waren wie ich. Also an diejenigen, die auch gewalttätige Väter hatten, die ohne Geld waren, die Underdogs. Das habe ich immer so gemacht, auch später.
Letztendlich hatte ich keine Mutter und keinen Vater im klassischen Sinne, also musste ich immer Wege suchen, wie ich am Leben bleibe. Diese Familie war eigentlich ein Todesurteil für mich. Da gab es nichts: keine Liebe, keine Fürsorge. Da gab es niemanden, der für eine*n da war, wenn man mal was brauchte.
Ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich mich politisiert habe, weil ich immer wusste, dass ich anders bin als andere. Ich wollte nicht werden wie meine Mutter, und wie mein Vater schon mal gar nicht. Ich wollte aus Billstedt raus, in dem Stadtteil fand ich alles zum Kotzen. Ich wusste, dass ich nie so werden will, wie die Leute da. Die Alternativen waren ja nicht so gross. Und ich wusste, dass ich keine Karriere machen will.
Mit fünfzehn bin ich mit dem Hauptschulabschluss von der Schule abgegangen und habe dann angefangen, in einer Druckerei zu arbeiten. Die machten damals Fotokopien und Grossdrucke. Da habe ich drei Jahre gearbeitet, von fünfzehn bis achtzehn und dann bin ich ausgezogen von zu Hause. Ich hatte gar nichts, nur Klamotten und Bettzeug habe ich mitgenommen, was ich aber hatte, waren soziale Kontakte.
„David gegen Goliath” ist hier Programm: Olivier David gegen die Goliaths dieser Welt. Anstatt nach unten wird nach oben getreten. Es geht um die Lage und den Facettenreichtum der unteren Klasse. Die Kolumne dient als Ort, um Aspekte der Armut, Prekarität und Gegenkultur zu reflektieren, zu besprechen, einzuordnen. „David gegen Goliath“ ist der Versuch eines Schreibens mit Klassenstandpunkt, damit aus der Klasse an sich eine Klasse für sich wird. Die Kolumne erscheint ebenfalls als Newsletter.
Als Jugendliche habe ich mit Kiffen angefangen, dann habe ich Packungsweise Ephedrin gefressen, die kosteten nur zwei oder drei Mark, das war mega billig. Dann ging es mit Trips weiter. Gekokst habe ich komischerweise nie, dafür bin ich relativ schnell zu Heroin und Opium gekommen und ja … Ich war ein Mensch, der Abenteuer gesucht hat. Ich hatte ein hohes Aggressionspotenzial, das musste irgendwo hin. Bei den Drogen habe ich das gegen mich selbst angewendet. Irgendwann aber musste ich eine Entscheidung treffen, weil meine Freundin M. sagte, sie würde unsere Beziehung beenden, wenn ich weiter Drogen nehme. Also habe ich mit zwanzig aufgehört.
Am Anfang war es sehr schwer vom Heroin wegzukommen, das habe ich gemacht, indem ich jeden Tag zwei Flaschen Wodka getrunken habe. Ich war beim Entzug nicht betrunken. Ich konnte zwei Flaschen Wodka trinken und blieb nüchtern.
M. und ich hatten eine sehr freie Beziehung. Das hat auch dazu geführt, dass wir so viele Jahrzehnte zusammen waren, weil wir uns den Raum gegeben haben. Und wir konnten uns auf aufeinander verlassen. Als Kind und Jugendliche hatte M. zwei Herzoperationen, was sie damals körperlich total ausgeknockt hat. M. war körperlich nie stabil, sie war oft krank mit Grippe und allem möglichen. Ich denke, dass sie innerlich wusste, dass sie sich wen suchen muss, der das hat, was ihr fehlt. M. hat ja auch alles dafür getan, dass es mir gut geht. Wir haben uns gegenseitig gerettet. Wenn etwas Schlimmes passiert ist, habe ich immer gedacht: Ich habe ja M., ist alles gar nicht so schlimm. Das ist jetzt so schwer, weil ich das nicht mehr habe. Diese Umstellung allein zu sein, M. war ja meine Familie. Sie wusste alles von mir und ich wusste alles von ihr. Das macht Familie aus, dass man keine Geheimnisse hat, dass man offen ist, dass man zusammenschmilzt auf ’ne Art. Das hat uns Sicherheit gegeben. Das fällt mir jetzt auf die Füsse.
Ich habe einen knallharten Überlebenswillen. Das ist, denke ich, der Grund, warum ich immer gut durchgekommen bin. Ich hatte ja auch immer mal wieder schlimme Phasen, es ging mir nicht immer gut. Ich hatte Angst, als M. gestorben ist, schon davor, als es klar war, dass es dem Ende zugeht, dass ich in Depressionen versacke, wenn sie Tod ist. Dass ich mich ins Bett lege und nicht mehr aufstehe. Aber es ist nicht passiert. Manchmal wundere ich mich über mich selber. Und dann denke ich, es passiert noch.
Michael (Name geändert), 30 Jahre
Vor der Haft war es das Warten auf die Ermittlungen, dann den Haftbefehl, dann die Verurteilung und Inhaftierung. Das waren die Faktoren, die für meine erste grosse Depression gesorgt haben. Der ganze Prozess von den ersten Ermittlungen, bis es dann das Urteil gab, hat sich Jahre hingezogen, bis es dann hiess, ich muss für vier Jahre rein.
Bei meiner aktuellen depressiven Phase war die Ungewissheit dieses Mal grösser als beim ersten Mal, weil ich nicht wusste, wohin ich dieses Mal steuere – und auch mein Versagen war gefühlt grösser. Die Intensität war stärker. Beim ersten Mal hatte ich keine Todessehnsüchte, das war in den vergangenen Monaten anders.
Ich kam raus mit dem Gedanken, dass ich die ganze Zeit Angst haben muss, entwickelte eine starke Depression, weil ich nicht weiss, wie meine Zukunft aussieht, und ich mich vor dem fürchte, was kommt. Vorher war ich fünf Tage die Woche tagsüber draussen arbeiten, hab meine Sachen gemacht, bin übers Wochenende mal aufs Boot oder zu meinem Bruder gefahren. Nur abends unter der Woche war ich im Knast.
Deswegen habe ich mich riesig darauf gefreut, rauszukommen. Dass ist ja auch der Vorteil der sozialtherapeutischen Anstalt, die Möglichkeit, sechs Monate vor der Zweidrittelhaft entlassen zu werden.
„Ich komme aus der Haft und es wird nichts besser – ganz im Gegenteil, ich rudere. Ich sitze auf ’nem halbfertigen Boot und ich suche ’ne Wohnung.”
Michael, 30 Jahre
Einen Monat nach der Entlassung, würde ich sagen, war ich schon depressiv und nach einem weiteren Monat war ich schwerst depressiv. Ich habe mein Leben gehasst und bin nicht gut klargekommen. Ich hatte mehr Fortschritt bei den Arbeiten an meinem Boot im Kopf. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich mit mehr Leuten Kontakt haben würde. Und nichts davon hat sich bewahrheitet: Ich komme aus der Haft und es wird nichts besser – ganz im Gegenteil, es kommen mehr Herausforderungen auf mich zu, und ich rudere. Ich sitze auf ’nem halbfertigen Boot und ich suche ’ne Wohnung. Dann habe ich eine Wohnung, aber ich ziehe da nicht ein, sondern lebe weiter auf einem halbfertigen Boot, mache meine Arbeit, habe wenig soziale Kontakte – vielleicht sogar weniger als in Haft, das war furchtbar für mich.
Und dieses Mal ging es immer weiter bergab, am Anfang habe ich ja noch einiges hinbekommen, aber am Schluss hat es sich soweit gesteigert, dass ich es nicht mehr geschafft habe, am Unterricht teilzunehmen. Ich bin nur noch selten arbeiten gegangen und war viel krank. Ich hätte mein Leben nicht beenden können, aber ich habe mir täglich gewünscht, dass ich hops gehe. Ich habe es nicht provoziert, aber ich hätte mich gefreut.
Es ist mehr dem Zufall zu verdanken, dass ich da wieder rausgekommen bin. Ein bisschen auch meiner Eigenleistung, klar. Beides.
Einmal habe ich ein Mädel nach einem Date gefragt, das war auch noch in meiner schwer depressiven Phase. Wir haben uns dann erst einmal getroffen, danach ein zweites Mal. Beim zweiten Mal hatten wir Sex, davor hatte ich Ewigkeiten kein Sex – nur zwischendurch mit ’ner Prostituierten, aber das zählt nicht, finde ich, da fehlt die Bestätigung als Mann. Um mich überhaupt aufs Date einzulassen, habe ich zwei, drei Tage vorher angefangen, Sport zu machen, um mich halbwegs gut zu fühlen, halbwegs menschlich, um der in die Augen zu gucken und mich dabei nicht wie der grösste Loser der Weltgeschichte zu fühlen. Das war die erste gute Woche nach einem halben Jahr, und nach dem Date lief es dann halbwegs gut weiter. Das war Ende November.
Und zu meiner Situation jetzt: Ich kann keine Privatinsolvenz beantragen. Schulden aus Straftaten sind nicht insolvenzfähig, das wäre schön. Insofern werde ich die Schulden behalten, bis ich sie abgezahlt habe oder man macht eine Einigung. Einen Teil meiner Schulden, die Prozesskosten, zahle ich schon in geringen Raten zurück. Meine Hoffnung ist, dass ich irgendwann Geld verdiene und sagen kann, jetzt fange ich richtig an zu zahlen. Wobei, ich kann ja auch mit den Schulden leben. Dann darf ich halt nie über 1’100 Euro verdienen oder knapp 1’200, der Rest geht dann in die Schuldenregulierung.
Yaso, ** Jahre
Bevor ich den Namen das erste Mal gesprüht habe, habe ich ihn davor ein bisschen gescetcht. Mit Yaso gehe ich jetzt ins 14. Jahr, das heisst nächstes Jahr wird gross gefeiert. Ich hatte immer mal so Abwandlungen mit meinem Namen. YA ich bin SO – oder wenn man das Wort zusammenschieben würde: Ich bin YASO oder manchmal habe ich: Das muss YA SO sein oder YA das ist SO. Das waren einfach Wortspiele, um das nicht ganz so langweilig zu machen. Ich male halt nur meinen Namen. Manchmal eben noch Only YASO. Vom Gefühl her passt es schon mit dem Only Yaso, denn ich denke, bevor jemand anderes dahingeht, muss ich die Stelle machen. Wenn dann ein Rooftopspot ist, dann muss ich das machen, das ist meine Aufgabe, das zu machen, das gestehe ich den anderen nicht zu.
Ich bin dafür bekannt über diese ganzen Roll Ups in der zweiten Reihe zu malen und halt auch Rooftops. Ich finde Rooftops noch ein bisschen spannender. Weil der Blick halt nach oben geht, und dann ist man noch mal ’ne Nummer höher. Wenn ich losgehe, mag ich das ganze drumherum. Du kletterst wo drauf, du bist oben, du hast einen Blick auf die Stadt, den man sonst nicht hat. Du bist allein, du hörst das Möwengeschrei, du hörst die Leute, wie sie sich unterhalten, du guckst runter, keine*r sieht dich. In dem Moment ist es einfach mein Platz, an dem ich für mich bin, in dem ich mich austobe.
Sich auf die Dachkante zu lehnen, den Arm runterhängen zu lassen und die Dachkante zu streichen ist nicht das Ungefährlichste und wenn dann noch ’ne blöde Schrecksituation entsteht oder man sogar fliehen muss und man nicht ganz fokussiert ist, dann kann da schon was passieren. Es reicht ja schon, dass du auf die Strasse rennst und da ein Auto kommt. Oder auf die Gleise. Wenn du aus dem dritten Stock abstürzt, dann kann man schon fast hoffen, dass du so auf den Kopf fällst, dass es vorbei ist. Querschnittsgelähmt zu sein, das ist immer noch ’n Leben, aber wäre für mich jetzt nicht so geil.
„Ich gehe dahin, wo ich möchte, und rotze meinen Namen hin. Egal, was die Leute sagen. Egal, wie sie es finden, da bin ich jetzt. Damit müsst ihr jetzt leben.”
Yaso, ** Jahre
Es wissen nicht so viele Leute, wer oder was ich bin. Aber es ist so, dass ich da viel Zeit und Energie hineinstecke und mir für mein Verständnis auch einen guten Platz erarbeitet habe.
Ich nehme mir die Freiheit und den Raum, das zu tun, worauf ich Lust habe. Ich gehe dahin, wo ich möchte, mehr oder weniger in dem Rahmen, der mir möglich ist und rotze meinen Namen hin. Egal, was die Leute sagen. Egal, wie sie es finden, da bin ich jetzt. Damit müsst ihr jetzt leben.
Wenn ich zwei Monate nicht malen gehe, dann ist das erste Mal einfach schön. Selbst wenn man dann nur zwei kleine Dinger gemacht hat – man ist aufgestanden, ist rausgegangen und hat sich die ganze Nachtatmosphäre gegeben. Nachts ist es jedenfalls ruhiger, nicht ganz so hektisch wie am Tag. Es hat so ein bisschen etwas Spielerisches, aber leicht Verruchtes. Ich gucke dann genau, welche Fenster auf Kipp stehen, wo das Licht an ist. Ich checke ab, ob noch jemand rausgegangen ist, mit dem Hund. Kommt der wieder oder nicht? Oh ne, ich denke, der dreht nur ’ne ganz kleine Runde, dann warte ich noch kurz. Es ist ein sehr begrenzter Kreis an Leuten, der unterwegs ist. Dann kannst du schon ganz gut abschätzen, wenn ein paar Autos fahren, ob das eine ruhige Stelle oder eine bisschen schnellere Stelle ist. Da kommt dann die Atmosphäre auf.
Während eineinhalb Jahren schrieb der Autor Olivier David an dieser Stelle jeden Monat über die untere Klasse und den vermeintlichen Aufstieg. Dies ist seine letzte Lamm-Kolumne. Wir bedanken uns herzlich bei Olivier für seine Texte. Hier kannst du alle „David gegen Goliath”-Kolumnen nachlesen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 28 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1716 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 980 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 476 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?