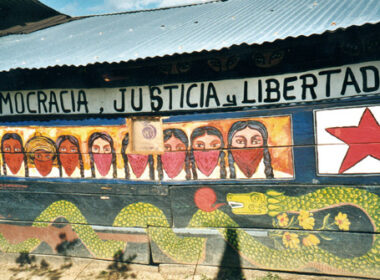Es wurde zum erfolgreichsten Volksbegehren der bayerischen Geschichte: Bis Mitte Februar konnten Wahlberechtigte in Bayern ihre Zustimmung zu einem neuen Gesetzesentwurf zum Naturschutz erklären. Die Berichterstattung in den Medien lief heiss, vor den Rathäusern bildeten sich lange Schlangen. Das Volksbegehren trug den Titel „Rettet die Bienen“. Insgesamt 1’754’383 Menschen unterschrieben. Das sind 18,4 Prozent der bayerischen Wahlberechtigten.
Den Initiator*innen des Volksbegehrens ging es nicht – wie der Titel vermuten lässt – allein um die Rettung der Bienen, sondern um das Artensterben von Flora und Fauna generell. Dabei wurde auch die Förderung der Bio-Landwirtschaft zum Thema und zum grossen Streitpunkt. Das Volksbegehren fordert, bis zum Jahr 2030 die landwirtschaftlichen Flächen, die ökologisch bewirtschaftet werden, von 10 auf 30 Prozent zu erhöhen.
Die Initiative für das Volksbegehren kam von der Kleinstpartei ÖDP, die Grünen und die SPD unterstützten das Vorhaben nach kurzer Zeit. Die Gegnerinnen der Idee: die Regierungsparteien CSU und Freie Wähler. Besonders stark gegen das Volksbegehren engagierte sich der Bayerische Bauernverband.
Ein Volksbegehren ist ein direktdemokratisches Instrument, das mit der Schweizer Volksinitiative vergleichbar ist. Wenn innerhalb einer vorgegebenen Frist eine bestimmte Anzahl Wahlberechtigter mit einer Unterschrift ihre Zustimmung erklärt, muss der Gesetzesentwurf im Parlament diskutiert werden. Lehnt das Parlament das Begehren ab, können die Bürger*innen sodann verlangen, dass eine Volksabstimmung durchgeführt wird.
Während der Sammelphase hangelten sich die Vertreter*innen beider Seiten an einer Konfliktlinie entlang, die in Diskussionen um Umwelt- und Klimaschutz eine der bedeutendsten ist, auch in der Schweiz: diejenige zwischen den Landwirt*innen und den Umweltschützer*innen, zwischen freiwilligem Engagement und gesetzlichen Vorgaben für die Landwirtschaft.
Vier Punkte, bei denen die beiden Interessengruppen scheinbar aneinander vorbeireden. Und in welche Dilemmata die Politik eingreifen könnte.
1. Die Gretchenfrage: Wer ist schuld am Artensterben?
Eines der beliebtesten Argumente des Bayerischen Bauernverbandes zur Diskussion um das Volksbegehren war vielmehr eine Gegenfrage. So formulierte der Präsident des Verbandes, Walter Heidl, in einem offenen Brief an die Initiator*innen des Volksbegehrens: „Wo bleiben im Zusammenhang mit dem Volksbegehren Faktoren wie Flächenversiegelung, Einsatz von Mährobotern und Steinen in Hausgärten, die zunehmende Lichtverschmutzung, steigende Freizeitnutzung in sensiblen Bereichen etc. und deren Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt?“
Kurz gesagt: Nicht die Landwirtschaft ist schuld am Artensterben, sondern wir alle. Das Argument ist richtig, die genannten Punkte stellen eine Bedrohung für Pflanzen- und Insektenarten dar. Kern dieses Argumentes – und im Übrigen der ganzen Diskussion um das bayerische Volksbegehren – ist aber ein anderer: Während der Garten als sehr privater Bereich angesehen wird, gibt es im Bereich der Landwirtschaft einen Umschwung, der zum Streitpunkt wird. Die Gesellschaft sieht sich immer mehr in der Verantwortung für den allgemeinen Umweltschutz – und dementsprechend auch für den Umgang mit grossen, landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die Nutzung von Pestiziden, der Gewässerschutz, der Zyklus der Bewirtschaftung: All das sind Faktoren, die hier entscheidend sind und ins öffentliche Interesse rücken. Für Landwirt*innen ist der Acker wie der eigene Garten, sie sind seit Generationen Expert*innen auf diesem Gebiet. Das Volksbegehren sendet das Signal, dass die Gesellschaft mehr Mitbestimmung einfordert und damit weiter in den Privatbereich der einzelnen Landwirt*innen eindringt.
An dieser Stelle muss die Politik vermitteln. Denn: Im Endeffekt geht es nicht um die Frage, wer schuld ist – sondern darum, wer etwas unternehmen kann.

2. Angebot vs. Nachfrage Bio-Landwirtschaft
Das Volksbegehren möchte den Anteil von Bio-Landwirtschaft in Bayern von 10 auf 30 Prozent bis zum Jahr 2030 erhöhen. Der Bayerische Bauernverband argumentiert, die Nachfrage für Bio-Ware sei nicht hoch genug, um das umsetzen zu können.
Es gibt allerdings gegenteilige Beobachtungen: Laut dem aktuellen Jahresbericht der Bio-Branche steigt der Umsatz der ökologischen Produkte, allein 2016 gaben die Europäer*innen rund 11 Prozent mehr Geld für Bio-Ware aus. Die Schweiz liegt in der Auswertung weit vorne: Mit einem Bio-Marktanteil von 8,4 Prozent lag sie direkt hinter den Spitzenreitern Dänemark (9,7 Prozent) und Luxemburg (8,6 Prozent). Europaweit geben die Schweizer*innen im Übrigen pro Jahr am meisten Geld für Bio-Produkte aus, Deutschland steht auf Platz sieben.
Die Nachfrage der Verbraucher*innen ist entscheidend für den Umsatz der Bio-Produkte und damit auch für die Produktion der Landwirtschaft. Wird die Förderung von Bio-Produkten stärker auf die politische Agenda gesetzt, könnte das Thema deutlicher in den öffentlichen Fokus gerückt werden – und davon letztendlich auch die Landwirtschaft profitieren.
3. Freiwilligkeit
In einer Stellungnahme des Bayerischen Bauernverbandes verweist Präsident Heidl auf freiwillige Massnahmen zum Umwelt- und Naturschutz. Jede*r zweite Landwirt*in in Bayern hätte sich bereits schriftlich dazu verpflichtet, aktiv zum Umweltschutz beizutragen. Mit der Neugestaltung des Naturschutzgesetzes wird eine feste Quote für die Bio-Landwirtschaft angestrebt. Die Landwirtschaftsvertreter*innen fragen: Wieso braucht es diese strikten Vorgaben?
Auf der anderen Seite heisst es: Wieso eigentlich nicht? Wenn Landwirtschaft und Gemeinschaft dasselbe Ziel haben, kann eine gesetzliche Quote hilfreich sein, so die befürwortende Seite. Auch in Zukunft wird niemand dazu gezwungen werden, auf Bio umzustellen. Aber: Die Anreize könnten steigen, die Subventionen nach den Erwartungen der Gemeinschaft verteilt werden. Hier braucht es offene Diskussionen und Kompromissbereitschaft.
4. Emotionalisierung der Debatte
Die Diskussionen um das Volksbegehren in Bayern haben auch gezeigt, dass diese Debatte viel emotionaler ist, als vielleicht vermutet. Vertreter*innen der Landwirtschaft sprechen davon, dass manche unter ihnen „persönlich verletzt“ seien über den Ausgang der Abstimmung. Der Vertreter des oberbayerischen Bauernverbandes, Anton Kreitmair, warf den Unterstützer*innen „Populismus“ vor. Regionale Bauernverbände wollen jetzt zeigen, wie sie sich bereits für den Umweltschutz einsetzen. Sie vermissen die Wertschätzung für ihren Beruf. Auch der Schweizer Bauernverband wirbt aktuell mit einer entsprechenden Kampagne: Die Plakate der neuen Werbelinie stellen Bäuerinnen und Bauern ins Zentrum und erklären, was diese für die Schweizer Gesellschaft leisten.
Auf der anderen Seite rückt für die breite Bevölkerung der Umweltschutz immer mehr in das öffentliche Bewusstsein. Zusätzlich sieht diese die hohen Subventionen, die in die Landwirtschaft fliessen, in Deutschland zählen hierzu auch die zusätzlichen EU-Agrarförderungen. Macht das ein höheres Mitbestimmungsrecht nicht legitim?
Die Landwirtschaft stellt einen wichtigen Markt dar, sowohl in Bayern als auch in der Schweiz. Dafür gebührt ihm eine hohe Wertschätzung und gewichtiges Mitspracherecht. Trotzdem muss es der Politik und der Mehrheit der Gesellschaft überlassen werden können, die Rahmenbedingungen der Wirtschaft zu setzen – insbesondere, wenn es um allgemeine Güter, Ressourcen und den Schutz unserer Umwelt geht.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 11 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 832 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 385 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 187 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?