Ist es sexistisch, Frauenhass bei Frauen verletzender und abstossender zu finden als bei Männern? So zumindest verteidigen Anhängerinnen – das generische Femininum drängt sich hier auf – frauenfeindlicher Ikonen häufig ihre Vorbilder.
Wieso sollten Frauen höheren moralischen Ansprüchen genügen als Männer? Wieso sollte man von Frauen verlangen, dass sie einander unterstützen, „allein” aufgrund ihres Geschlechts? Währenddessen wird Männern nicht nur die Konkurrenz untereinander, sondern auch fehlender Feminismus und häufig sogar Frauenhass verziehen.
Es ist nur dann logisch, Frauen keine besondere Solidarität abzuverlangen, um Gleichstellung zu fördern, wenn man übersieht, dass der Status quo mit seiner sexistischen Struktur für Frauen gefährlicher ist – weil Männer sich im Patriarchat weniger selbst gefährden.
Es ist sicherlich auffällig, wie viel mediale Aufmerksamkeit die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling oder AfD-Politikerin Alice Weidel im Vergleich zu männlichen Kollegen für ihre reaktionären und antifeministischen Handlungen erhalten. Andererseits schlagen beide erhebliches Kapital aus der Aufmerksamkeit. Ob sexistisch oder nicht, fahrlässig darf man es wohl nennen, wenn Frauen sich dem Ziel verschreiben, die Unterdrückung, Ausbeutung und Diskriminierung von Frauen voranzutreiben.
Selbstgewählte Abgrenzung
Antifeministinnen streiten es ab, gegen das Wohl der eigenen sozialen Gruppe zu agieren. Sie distanzieren sich entschieden von denen, für deren Entmenschlichung sie sich einsetzen.
Etwa indem Weidel erklärt, sie sei nicht queer, lediglich mit einer Frau verheiratet. Als ginge es sie dadurch nichts an, dass ihre Partei die Abschaffung der gleichgeschlechtlichen Ehe forderte. Oder wenn Rowling ihre eigene Unsicherheit über ihre Geschlechtsidentität ins Feld führt, um trans Personen als krank und gefährlich darzustellen. Weidel wie Rowling scheinen anzunehmen, diese selbstgewählte Abgrenzung werde sie vor den Konsequenzen ihres Handelns schützen.
Vor Kurzem sorgte die milliardenschwere Rowling für Schlagzeilen, als sie ein Urteil des Obersten Gerichts des Vereinigten Königreichs als persönliche Errungenschaft feierte. „Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht”, kommentierte die Autorin das Bild, aufgenommen auf ihrer Yacht, in einer reich geschmückten Hand eine Zigarre, in der anderen einen eisgekühlten Drink.
Weidel und Rowling interpretieren jede Kritik an sich als frauenfeindlich, in völliger Leugnung der eigenen Machtstellungen als Politikerin und Milliardärin.
Rowlings Plan fordert, trans Frauen den Zugang zu Frauenhäusern, Frauentoiletten, Umkleiden und anderen geschlechtsspezifischen Ressourcen zu verwehren. Mit dem Urteil Mitte April wurde beschlossen, dass sich britische Gesetze zur Gleichstellung der Geschlechter allein auf biologisches Geschlecht beziehen. Also haben trans Frauen keinen Anspruch auf Dienstleistungen und Schutzmechanismen für Frauen.
Rowlings Rolle in diesem desaströsen Rückschlag beschränkt sich nicht auf ihre schier unermüdliche Aufwiegelung gegen trans Frauen via Social Media, sondern liegt vor allem in der Finanzierung der Kampagne: Die Gruppe, welche die Klage bis ans Oberste Gericht zerrte, erhielt allein für das offizielle Crowdfunding zu diesem Zweck 70’000 Pfund von Rowling.
Doch damit nicht genug; Ende Mai kündigte die Milliardärin an, mit einem eigens kreierten Fond weitere Klagen zu finanzieren, um trans Frauen aus dem öffentlichen Leben zu verbannen und ihnen Zugang zu staatlichen Ressourcen zu verweigern.
Antifeminismus als Karriere
Rowling und Weidel sind bei weitem nicht die ersten und auch aktuell nicht die einzigen weiblichen Galionsfiguren des Antifeminismus.
Ab den 1960ern wurde die studierte Juristin Phyllis Schlafly in den USA zu einer Ikone der Bewegung. Sie verteilte Brote und Marmelade an Politiker – versehen mit Zettelchen, die Botschaften enthielten wie: „Würdige diejenige, die den Haushalt führt, sonst wirst du es am Ende selbst tun müssen”, um sich gegen die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau einzusetzen.
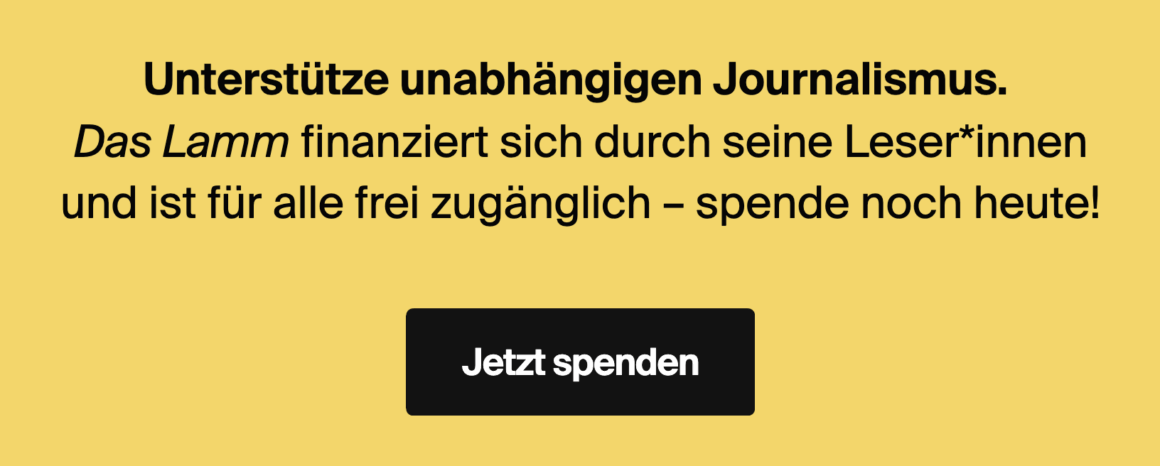
Anfang der 2000er war es kein Mann, der sich mit Alice Schwarzer im öffentlichen Fernsehen über die Verschiedenheit von Mann und Frau stritt, sondern die ehemalige Schönheitskönigin und spätere Fernsehmoderatorin und Werbeikone Verona Pooth. „Aber ich bin doch das Weibchen!”, entgegnete Pooth, nachdem Schwarzer deren klischeehaftes Verhalten anprangerte. Der Ausspruch erntete Applaus und Schlagzeilen, wie es eine vergleichbare Äusserung eines Mannes wohl kaum geschafft hätte.
Antifeministinnen erledigen die Drecksarbeit für Männer, die sich nicht exponieren wollen. Sie geraten ins Kreuzfeuer von misogynem Hass und feministischer Kritik. Als Ausgleich erhalten sie Zugang zu Macht und Einfluss, der anderen verwehrt bleibt. Wird ihnen das zum Vorwurf gemacht, drehen sie den Spiess um. Sie interpretieren jede Kritik an sich als frauenfeindlich, in völliger Leugnung der eigenen Machtstellung. Wer Weidel und Rowling kritisiert, so die Logik, attackiere keine transfeindliche Milliardärin und rechtsextreme queerfeindliche Politikerin, sondern eine einst alleinerziehende Mutter, die von häuslicher Gewalt betroffen war. Respektive eine lesbische Frau, die es an die Spitze einer Partei geschafft hat.
Gerade aktuell ist es gefährlich, traditionelle Geschlechterrollen zu verherrlichen.
Im Umkehrschluss heisst das: Wenn andere Feminist*innen die marginalisierten Frauen, als die sie sich inszenieren, nicht vorbehaltlos unterstützen, schulden sie – Rowling und Weidel – auch niemandem Solidarität.
Nicht zuletzt zahlt sich der antifeministische Grift als Karriere aus. Umgangssprachlich bezeichnet man Personen als „grifter” (zu Deutsch: Gauner*innen/Schwindler*innen), die sich mit extremen ideologischen Positionen öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen – hinter denen sie nicht mal unbedingt stehen müssen – um daraus Profit zu schlagen.
Phyllis Schlafly und Verona Pooth führten entgegen ihrer öffentlichen Persona keineswegs häusliche Leben, sondern legten enorm erfolgreiche Karrieren im öffentlichen Leben hin. Analog dazu sind auch viele Influencerinnen auf Social Media alles andere als Heimchen am Herd – und treiben die Verklärung und Romantisierung eines vermeintlich traditionellen Frauenbilds in immer absurdere Extreme, ohne es selbst tatsächlich zu leben.
Nara Smith und Co.
Natürlich würde diese Masche nicht funktionieren, gäbe es keinen Absatzmarkt für antifeministische Inhalte.
Hochkonjunktur hat aktuell besonders der „Trad Wife”-Trend (Kurzform von traditional wife, traditionelle Ehefrau). Gemeint sind Influencerinnen, die so tun, als würden sie eine christlich-konservative Geschlechterrolle erfüllen und dem Publikum weismachen wollen, dieses Leben habe sie von den Zwängen einer modernen Leistungsgesellschaft befreit.
Nara Smith, eine der bekanntesten Vertreterinnen des Trends, zeigt ihren über 11 Millionen Tiktok-Follower*innen keineswegs realistische Alltagssituationen einer dreifachen Mutter, sondern aufwendig hergestellte, durchgestylte Videos. Follower*innen können ihr dabei zusehen, wie sie in Designerkleidung gewandet Marshmallows selbst herstellt oder eigens Käse produziert, um ihren Kleinkindern einen Käsetoast als Snack zuzubereiten. In der Inszenierung des häuslichen Idylls zeigen sich die Frauen tiefenentspannt, anstatt sich neben der Lohnarbeit die Zeit und Energie für Kind und Kegel aus den Rippen schneiden zu müssen.
An sich ist diese Reaktion verständlich. Weil nach wie vor erschwingliche Kinderbetreuung fehlt, eine gerechtere Verteilung von Care-Arbeit in heteronormativen Haushalten nur schleppend vorangeht und die Lohnarbeitsbedingungen oft unattraktiv und unflexibel sind. Für Mütter ist es nur unter grossen persönlichen Opfern möglich, Lohnarbeit mit dem Privatleben zu vereinbaren. Viele wünschen sich einen Ausweg aus dieser ernüchternden Sackgasse, ohne sich selbst in dem verzweifelten Versuch, alles unter einen Hut zu kriegen, völlig zu verausgaben
Niemand ist dem Zentrum patriarchaler Macht so nahe wie weisse, heterosexuelle cis Frauen.
Eine Rückkehr zu einer vermeintlich traditionellen Ehe als Ausweg zu sehen, ist eine gefährliche Illusion. Altbekannte Risiken sind der Verzicht auf ein unabhängiges Einkommen und die starke finanzielle Abhängigkeit vom Ehemann – gerade in Sachen Altersvorsorge. Zudem wird aber auch der Schutz, den dieses Lebensmodell bieten sollte, immer stärker abgebaut, so dass Frauen nach einer Trennung trotz Jahren unentgeltlicher Kinderbetreuung nicht mehr grundsätzlich auf Unterhaltszahlungen zählen dürfen.
Tarnmantel Männerhass
Aber auch andere antifeministische Strategien zeigen Wirkung – und bedrohen damit feministische Anliegen.
Häufig treten die reaktionären Forderungen unter dem Deckmantel von Männerhass auf. Narrative um eine unabänderliche männliche Triebhaftigkeit und sexuelle Übergriffigkeit implizieren, dass Männer sich nicht ändern können, für ihre Handlungen nicht verantwortlich sind und sexualisierte Gewalt damit normal und nicht zu verhindern ist.
Mit solchen Argumenten setzten sich Aktivistinnen wie Schlafly gegen die Rechte von schwulen Männern ein. Und transfeindliche Personen wie Rowling lobbyieren unerbittlich dafür, trans Frauen aufgrund ihrer angeborenen Verdorbenheit Schutz und Gleichstellung zu verwehren. Sie übernehmen damit die Vorstellung, dass geschlechtsspezifisches Verhalten nicht zu verändern ist und untergraben damit Jahrhunderte feministischer Arbeit.
Was Antifeministinnen eint
Was auch immer die privaten Überzeugungen von antifeministischen Frauen sein mögen, die Sachzwänge sind leichter nachzuvollziehen. Niemand ist dem Zentrum patriarchaler Macht so nahe wie weisse, heterosexuelle cis Frauen.
Und trotzdem müssen sie sich Macht und Einfluss mit harten Bandagen erkämpfen. An der Spitze kann sich nur halten, wer andere Frauen und Männer unterdrückt und sich damit Freiheiten und Bequemlichkeiten erschleicht.
Antifeministinnen glauben nicht an eine Zukunft, in der sich ihre Lage als Frauen erheblich verbessern würde.
Auch das ist nicht neu.
Wie die Historikerin Stephanie Jones-Rogers aufzeigt, waren es gerade Sklavenhalterinnen, die mit aussergewöhnlicher Grausamkeit und Verbissenheit ihr Recht, Menschen zu besitzen, verteidigt haben. Durch den Besitz von versklavten Personen – besonders Frauen –, konnten sie sich vom Stillen und allen damit einhergehenden gesundheitlichen Risiken, von der Aufzucht der eigenen Kinder und häufig auch vom Sex mit ihrem eigenen Mann, freikaufen. Diese Freiheit und der Reichtum erlaubten ihnen einen für Frauen zu der Zeit kaum denkbaren Lebensstandard. Der Preis, den sie dafür zu zahlen bereit waren, lag in der quälenden Entmenschlichung der Männer und Frauen, über die sie verfügen konnten.
Damals wie heute ist es vielen Männern gleichgültig, ob sich ihre Ehefrau oder jemand anderes um Kinder, Haushalt und andere Formen der Care- und Reproduktionsarbeit kümmert, solange es ihre eigenen Freiheiten nicht tangiert. Frauen, die diesen Männern nacheifern, „müssen” diese Arbeiten also an andere Frauen auslagern – möglichst billig. Deshalb haben sie oft wenig Interesse daran, die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen, Nannys, Putzkräften, Kindergärtnerinnen zu verbessern.
Was Antifeministinnen eint: Sie alle glauben nicht an eine Zukunft, in der sich ihre Lage erheblich verbessern würde.
Manche sind enttäuscht über die Behäbigkeit der Realpolitik, welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf propagiert, dabei aber die Verantwortung auf Einzelne abwälzt und gleichzeitig soziale Unterstützung streicht. Andere glauben nicht daran, dass sich Männer und Frauen je wirklich gleichberechtigt begegnen können. Ernüchtert von unzähligen privaten Enttäuschungen, die sie sich als Konsequenz biologischer Unterschiede erklären müssen, um sich mit der scheinbaren Unausweichlichkeit ihrer Unterdrückung abzufinden.
Und wieder andere wissen nur zu genau: Eine gerechtere Welt, in der sich Frauen ihren Aufstieg nicht mehr durch die Unterdrückung und Ausbeutung anderer erkaufen könnten, wäre weitaus weniger komfortabel für sie als die jetzige.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 25 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1560 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 875 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 425 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?










