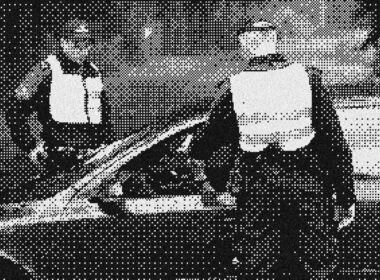Die radikale, ausserparlamentarische Linke, allen voran die Klimabewegung, hat sich in den letzten Jahren vor allem auf zwei Arten von politischen Aktionen fokussiert, die sich gegenseitig stützen und ergänzen: Auf der einen Seite gab es zivilen Ungehorsam wie das Besetzen von Kohlegruben, auf der anderen die Mobilisierung von grossen Demonstrationen gegen die Klimakrise.
Lützerath ist ein kleines Dorf in Deutschland, das zur Stadt Erkelenz in Nordrhein-Westfahlen gehört. Alle Gebäude und Grundstücke wurden von dem Energiekonzern RWE aufgekauft. Neben dem Dorf befindet sich ein riesiger Braunkohletagebau. Auch dort, wo das Dorf liegt, soll die Braunkohle aus dem Boden geholt werden, weshalb alle Bewohner*innen das Dorf verlassen mussten. Klimaaktivisten wollen nun das weitere Abbaggern der klimaschädlichen Braunkohle verhindern. In den letzten Wochen und Monaten kam es zu enormen Protestaktionen. Lützerath steht unter anderem für die Einhaltung der 1.5 Grad Grenze der Klimaerwärmung.
Durch die gemeinsamen Aktionen von Ende Gelände, die seit 2015 regelmässig Massenaktionen zivilen Ungehorsams in den deutschen Braunkohlerevieren organisieren, und ihren eher bürgerlichen Partnern wie Fridays for Future oder „Alle Dörfer bleiben“ wurde die mediale Aufmerksamkeit erstmals in grossem Stil auf die Zerstörung des Klimas durch die deutsche Braunkohle gerichtet. Das war dringend nötig, denn das Bewusstsein über die Zerstörung des Klimas ist eine zentrale Voraussetzung, um sich überhaupt dagegen organisieren zu können.
Aber was genau war jetzt eigentlich der Unterschied von Lützerath zu den Aktionen von Ende Gelände und Co?
Vom symbolischen zum militanten Ungehorsam
Im Kampf um Lützerath vereinten die Aktivist*innen viele ihrer Aktionsformen, erprobten aber auch neuere, um sich möglichst effektiv gegen den fossilen Kapitalismus zu organisieren. So wurden die etablierten Mobilisierungen und der zivile Ungehorsam der letzten Jahre durch eine neue Form der Militanz ergänzt.
Dabei orientierten sich die Aktivist*innen noch immer stark an den Grundprinzipien des zivilen Ungehorsams. Dieser beabsichtigt durch symbolträchtiges Überschreiten der gesetzlichen Normen die öffentliche Aufmerksamkeit auf einen Missstand zu lenken.
Das Hinausgehen über die symbolische Handlung einer Sitzblockade hin zu gut befestigten, besetzten Strukturen, die man verteidigen kann – wie den Tunnel beispielsweise – ist der Übergang vom Ungehorsam zum militanten Protest.
Da gab es zum Beispiel den über fünfzehn Meter langen Tunnel, der durch monatelange Arbeit entstand. Das Ziel des Tunnels war es, die Räumung für die Polizei möglichst schwierig zu machen und lange herauszuzögern – was auch gelang. Diese Aktion lässt die Grenze zwischen militantem Aktivismus und zivilem Ungehorsam verschwimmen, da der Tunnel durch diverse Sicherheitssysteme wie dicke Betontüren und sogenannte Lock-Ons gegen Räumungen geschützt war.
Mittels Lock-Ons können sich Aktivist*innen an Objekten und eigenen Konstruktionen befestigen, um ihren Abtransport durch die Polizei zu verhindern. Zur Verteidigung von Lützerath stellten sich die Aktivist*innen – nicht nur symbolisch – der Räumung mit ihren eigenen Körpern entgegen.
Das Hinausgehen über die symbolische Handlung einer Sitzblockade hin zu gut befestigten, besetzten Strukturen, die man verteidigen kann – wie den Tunnel beispielsweise – ist der Übergang vom Ungehorsam zum militanten Protest. Diese Art des „militanten Ungehorsams” ist zwar in Deutschland erst durch die Besetzungen gegen RWE bekannt geworden, gehört jedoch für die Klimabewegung im Vereinigten Königreich und Frankreich schon seit Langem zum widerständigen Repertoire.
Eine weitere Strategie, die man im Kampf rund um Lützerath beobachten konnte, waren die erfolgreichen Versuche von einzelnen Demonstrant*innen aus der Grossdemonstration, die in der Nähe von Lützerath stattfand, auszubrechen, um nah an das besetzte Dorf heranzukommen.
Diese Taktik, die sich ebenfalls zwischen Militanz und reinem Ungehorsam bewegt, hat seit den Protesten gegen die Startbahn West, ein Peak der Klimaproteste in den 70er-Jahren in Deutschland, kaum mehr eine Rolle gespielt. Auch im Hambacher Forst, dessen Verteidigung 2018 die letzte grosse Aktion der deutschen Klimaproteste war, gab es keine vergleichbaren Aktionen, was die Dimension der Vorbereitung, Durchführung und Militanz betrifft.
Repression und Radikalisierung
In den Aktionen rund um Lützerath wurde also viel Kreativität und Mut bewiesen. Dass der Widerstand die Räumung nicht noch länger herauszögern konnte, lag deshalb nicht etwa an den Aktivist*innen selbst, sondern daran, dass die Polizei mit allen Mitteln Angst bei den Verteidiger*innen des kleinen Dorfs verbreitete. Um diese Angst zu befeuern, wurde zum Beispiel rund um die Uhr geräumt. Den Aktivist*innen blieb so kaum eine ruhige Minute, um Kräfte zu sammeln oder sich mental zu entspannen.
Genau deshalb wird es bei den Klimaprotesten nicht bei dieser hybriden Militanz bleiben: Während Aktivist*innen durch die brutalen und lebensgefährlichen repressiven Massnahmen der Polizei zwar schnell geräumt werden können, gilt das nicht für Sabotagen und Konstruktionen.
Zudem wurden unzählige Sicherungskabel von der Polizei gekappt, die dazu dienen, mit Stahlseil befestigte Strukturen wie etwa Hochsitze in Höhen bis zu 15 Metern zu stabilisieren. Dadurch wurde das Leben der Besetzer*innen leichtfertig aufs Spiel gesetzt – in der Hoffnung, dass diese ihre Besetzungen freiwillig aufgeben.
Auch Baumhäuser wurden mit Kettensägen attackiert, während sich Menschen darin befanden. Dies markiert eine neue Eskalation der Polizeigewalt, gegen die die radikale Linke neue Mittel finden muss. Sich nur mit den eigenen Körpern der Zerstörung entgegenzustellen, ist eine unkalkulierbare Gefahr, was die massive Zahl an verletzten Aktivist*innen bestätigt.
Genau deshalb wird es bei den Klimaprotesten nicht bei dieser hybriden Militanz bleiben: Während Aktivist*innen durch die brutalen und lebensgefährlichen repressiven Massnahmen der Polizei zwar schnell geräumt werden können, gilt das nicht für Sabotagen und Konstruktionen. Ein sabotiertes Kohleförderband beispielsweise wird nicht auf einmal wieder in den Regelbetrieb übergehen können, nur weil ein paar Aktivist*innen nicht mehr darauf sitzen. Auch ein mit Zucker gefüllter Tank wird durch Polizeigewalt nicht magischerweise wieder funktionieren. In solchen Aktionen könnte also die Zukunft der Klimaproteste liegen.
Solange junge Menschen im Angesicht eines brennenden Planeten, einer ausbeuterischen Wirtschaft und eines freidrehenden Polizeiapparats aufwachsen, wird es militante Aktionen im Namen der sozialen Revolte geben.
Um diese Entwicklung der Radikalisierung der Klimabewegung durch Polizeiwillkür und Gewalterfahrungen zu beobachten, reicht ein Blick nach Frankreich, wo Sabotagen und militante Massenaktionen den Druck auf die Herrschenden massiv erhöht haben.
Ein gutes Beispiel waren die Aktionen gegen das Wasserreservoir in Sainte-Soline, welches das sowieso schon knappe Wasser speichern soll, um als zuverlässige Wasserquelle für Agrargrossbetriebe zu dienen. Bei den Protesten rund um das Reservoir konnten sich Klimaaktivist*innen Zugang zur Baustelle verschaffen und diese sabotieren, was den Bau wenigstens für kurze Zeit hinauszögern konnte.
Gut möglich also, dass es auch im deutschsprachigen Raum an der Zeit ist, vermehrt auf diese Aktionsformen zurückzugreifen.
Gefahren und Strategien
Doch die gesteigerte Militanz sollte nicht zum reinen Selbstzweck verkommen. Denn damit riskiert die ausserparlamentarische Linke, sowohl bürgerliche Bündnispartner*innen als auch die mediale Deutungshoheit zu verlieren.
Zuletzt konnte man dies bei den Protesten gegen die G20 in Hamburg im Jahr 2017 beobachten: Durch eine fehlende aktionsübergreifende Strategie sowie einen fehlenden Aktionskonsens der verschiedenen Gruppierungen wurde verunmöglicht, dass man das Gipfeltreffen hätte verhindern können. Der zivile Ungehorsam einiger Gruppe wurde dabei durch nicht zielgerichtete militante Aktionen anderer untergraben.
Die Folge? Viel Unverständnis in der Bevölkerung. Denn es ist enorm schwierig, Arbeiter*innen zu erklären, dass man auf ihrer Seite steht, während ihr Zuhause gerade zum Schauplatz der totalen Verwüstung wird.
Und wie kann man Militanz anwenden und gleichzeitig für eine breite Öffentlichkeit nachvollziehbar bleiben?
Es ist für die Militanzdebatte aber auch nicht zwangsläufig entscheidend, ob man militante Aktionsformen im eigenen moralischen Kompass vertreten kann. Wichtig ist viel mehr, sich zu fragen, wie man sie organisiert und vor allem, in welchen Kontext sie gesetzt werden.
Solange junge Menschen im Angesicht eines brennenden Planeten, einer ausbeuterischen Wirtschaft und eines freidrehenden Polizeiapparats aufwachsen, wird es militante Aktionen im Namen der sozialen Revolte geben. Die Frage ist nur: Wie werden sie durchgeführt und mit anderen Aktionen zusammengedacht? Wie finanziert? Und wie kann man Militanz anwenden und gleichzeitig für eine breite Öffentlichkeit nachvollziehbar bleiben?
Die neue Militanzdebatte rund um die Klimaproteste muss sich also die Frage stellen, wie die radikale Linke militante Aspekte und Taktiken in die eigene widerständige Strategie einbinden kann – und nicht, ob sie es überhaupt will. Denn diese Entscheidung hat die Repression von Polizei und Staat schon längst für uns getroffen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 21 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1352 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 735 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 357 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?