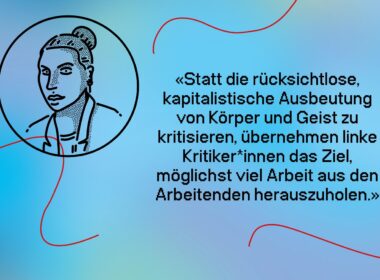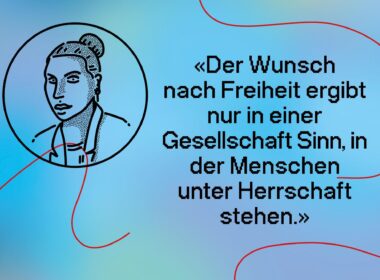Wie fühlt es sich an, mit dem eigenen Körper und der eigenen Gesundheit den Wohlstand höherer Klassen zu bezahlen? Was bedeutet es, unten zu bleiben, damit die oberen ihren Status, ihre Macht, ihre Privilegien behalten können? Wie soll Geschichte weitergegeben werden, wenn es kein kollektives Gedächtnis armer Menschen gibt?
Während sich die meiste Literatur über soziale Herkunft und die untere Klasse dem Aufstiegsnarrativ bedient, schreibt Olivier David in seiner Neuerscheinung über diejenigen die unten geblieben sind. Der Essayband ist ein Archiv seiner sozialen Wut.
Ein Vorabdruck aus dem Buch, das am 16. Mai 2024 im Haymon Verlag erscheint.
Von der namenlosen Menge
Ein später Nachmittag am letzten Tag des alten Jahrtausends. Um dem Gefühl des Alleinseins zu entfliehen, schnüre ich meine Schuhe, ich rufe meiner Mutter ein paar Worte zu und verlasse die Wohnung. Meine Stimmung passt zu diesem nasskalten Dezembertag, sie passt zum taubengrauen Himmel, sie passt nicht zum Tag der Tage, für den ich zu wenig enge Freunde habe, zu pleite und zu hobbylos bin.
Ich bin elf Jahre alt, ich bin draussen auf der Strasse unterwegs, streife durch die Stadt, mit einer Handvoll Böller.
Die Dämmerung bricht langsam herein, als ich beschliesse, mich auf den Rückweg zu machen. Vorbei an den Stufen, die an die Außenmauer des Karstadtgebäudes angrenzen, vorbei an der Post nahe der grossen Bergstrasse. Am Schaufenster des Klamottenladens Hundertmark bleibt mein Blick an der dunkelbraunen Lederjacke für 699 Mark kleben.
Mehr Freizeit, weniger Lohnarbeit: Das war die ganze Zukunftsvision.
Kurz hellt sich meine Stimmung auf, als ich mir vorstelle, diese schwere, edle Lederjacke eines Tages zu besitzen. Nach ein paar Sekunden reisse ich mich los. Es gibt die Welt hinter der Auslage, und es gibt meine Welt, und dazwischen gibt es die Sicherheitsscheibe, die unüberwindbar zwischen meinen Tagträumen und der Realität steht. Das hinter der Scheibe, das bin nicht ich, das werde ich nie sein.
Die Kälte zieht mich wie an einer Schnur zurück nach Hause. Allein Böller auf die Strasse zu werfen, so wie ich es bis vor wenigen Minuten gemacht habe, erzeugt keine Freude in mir. Es ist eher etwas, das ich pflichtbewusst erledige, weil alle Jungs in meinem Umfeld vernarrt darin sind, etwas in die Luft zu jagen. Die letzten zwei D‑Böller stecke ich zurück in die Tasche.

Am Ende der grossen Bergstrasse explodiert plötzlich etwas unmittelbar vor meinen Füßen. Die Detonation ist heftig, sie reisst mich aus meiner Lethargie. Ich sehe ein paar übermütige Jugendliche, die sich mit Böllern beschmeißen, und hoffe, dass sie nicht auf mich zielen. Der Schock, den die Explosion in mir auslöst, wird verstärkt durch die empfundene Isolation von der Welt, die mich schon umgeben hat, lange bevor ich das Haus verlassen habe.
Eine Isolation, die genau genommen ein Teil von mir ist. Eine Isolation, die gleichzeitig auch ein Trugschluss ist, denn ich bin nicht allein, meine Mutter wartet zu Hause, auch ihr geht es nicht gut, auch sie ist allein. Genau genommen ist es kein isoliertes Alleinsein, wir sind jeder für sich nebeneinander allein. Es ist das Alleinsein des versprengten Rests einer Familie aus der unteren Klasse.
Vor einiger Zeit habe ich online einer Podiumsdiskussion über soziale Herkunft und Klassenwechsel zugesehen, und in den Wochen und Monaten danach ploppte der Titel der Veranstaltung immer wieder in meinem Inneren auf: „Die Klasse, die es nicht gibt.” Die Formulierung zeigte mir eine Realität auf, die sich meinem Bewusstsein bisher entzogen hatte, obgleich ich ihre Wahrheit körperlich spürte.
Mir kommt kein Gefühl in den Sinn, das gleichzeitig ehrlicher und ernüchternder zugleich ist als jenes, das beim Vorgang spürbar wird, sich der Realität zu stellen, in der es für die meisten so wenig zu gewinnen gibt. Dieselbe Wahrheit besagt, dass ich alleine von dieser Erde gehen werde. Eine Wahrheit, in der geschrieben steht, dass ich in Einsamkeit und Armut sterben muss, zu früh sterben muss, weil diese Phänomene einer Gesetzmässigkeit folgen.
~
Der Junge mit den Böllern in der Hand verwandelte sich in einen spätpubertierenden Jugendlichen, aus der Jahrtausendwende wurde 2007.
Hätte mich damals jemand gefragt, wer die Hintermänner von 9/11 seien, ich hätte, mit einem Lächeln auf den Lippen, das Überlegenheit ausstellen sollte, aber von Verbitterung geprägt war, gesagt, es sei ein Insidejob gewesen – was denn sonst? Das war keine rein private Meinung, es war so etwas wie die kollektive Wahrheit meines Milieus. Wir alle wussten, nachdem wir die Dokumentation „Loose Change” gesehen hatten, einen Amateurfilm, der Verschwörungserzählungen über die einstürzenden Twin-Towers verbreitete, was wahr und was gelogen war.
Die Amis haben die Flugzeuge in die Türme gelenkt, um den Irakkrieg zu starten wegen Öl.
Es war ein gutes, ein überlegenes Gefühl, einer der Wissenden zu sein. Mitte 2008 begann ich zweiunddreissig Stunden die Woche in einem Supermarkt zu arbeiten. Irgendwann in dieser Zeit fing ich schon vor der Schicht zu kiffen an, ab dem Nachmittag oder Abend trank ich Bier, ein paar Mal die Woche dazu Schnaps.
Durch mein Schreiben erweckte ich die sozialen Bedingungen, durch die ich meine wesentliche Prägung erfuhr, zum Leben.
Die Arbeitskollegen und Freunde, mit denen ich mich umgab, waren wie ich, zumindest fühlte ich mich ihnen gleich. Sie zogen Speed vor der Frühschicht, malten in ihrer Freizeit Wände und Züge, dealten und kifften oder tranken zu viel. Niemand glaubte an das eigene Vorankommen. Keiner gab sich der Illusion hin, dass die Welt für einen von uns etwas anderes zu bieten hatte.
Man kämpfte dafür, es im Rahmen seines Alltags etwas weniger schlecht zu haben. Mehr Freizeit, weniger Lohnarbeit: Das war die ganze Zukunftsvision.
Das schöne Leben, das wir uns ausmalten, war von dem Wunsch nach „weniger” gekennzeichnet, weniger Probleme zu haben, anstatt nach Verbesserungen, von denen wir nicht zu träumen wagten. Vorankommen bedeutete aufzuhören, die Regeln der oberen Klassen zu befolgen, so sehr hatte sich die Hoffnungslosigkeit in vielen von uns breitgemacht.
Vor Kurzem las ich bei erneuter Lektüre von Didier Eribons „Rückkehr nach Reims” folgende Sätze, in denen ich mich wiederfinde: „Dass es anderswo anders zugeht, dass andere Leute andere Ziele und Möglichkeiten haben, weiss man sehr wohl, aber dieses Anderswo liegt in einem so unerreichbaren, separaten Universum, dass man sich weder ausgeschlossen noch benachteiligt fühlt, wenn einem der Zugang zu den Selbstverständlichkeiten der anderen verwehrt bleibt. So ist die Welt geordnet, Punkt. Warum, weiss man nicht. Dazu müsste man sich selbst von aussen betrachten, bräuchte einen Überblick über das eigene Leben und das Leben der anderen.”
In verschiedenen Momenten meines Lebens habe ich mich als Teil von etwas gefühlt, das ich heute im Nachgang als Klasse oder Klassenfraktion bezeichne. Im Stadion, wenn ich mit einem Lied verschmolz und die Gedanken, die sonst unaufhörlich ratterten, endlich verstummten. Wenn ich mit Freunden auf dem Skateboard durch die Stadt fuhr und die Trennung zwischen mir und der Welt überwand. Wenn ich mit Nachbarn und Bekannten gegen einen Klamottenladen aus der rechtsextremen Szene demonstrierte, dessen Mitarbeiter und Kunden im Stadtteil Präsenz zeigten. Wenn ich sah, dass eine linke Partei irgendwo auf der Welt eine Wahl gewann.
Die Not, mich selbst verstehen zu wollen, brachte die Suche nach der eigenen Position ins Rollen.
Ich denke: Mit dem Klassenbewusstsein ist es wie mit dem Glück; es schaut mal kurz vorbei, es streift den Geist, wärmt ihn, aber dieses Gefühl zu konservieren, wollte mir weder als Kind und Jugendlichem gelingen noch zu der Zeit, in der ich körperlicher Arbeit nachging. Das veränderte sich, sobald ich mit dem Schreiben begann.
In „Denken in einer schlechten Welt” beschreibt der Philosoph Geoffroy de Lagasnerie, wie die Produktion von Kunst, Literatur und Wissen mit einer Verantwortung zum Engagement einhergeht. Im Augenblick des Schreibens „haben wir uns folglich entschieden, uns zu engagieren. Wir sind in etwas engagiert. Und damit können wir die politische Dimension unseres Handelns nicht länger verdrängen und bestreiten.”
An dieses Engagement glaube ich. Mein Schreiben ist ein Versuch, diesem Anspruch an das eigene Engagiertsein gerecht zu werden. Durch mein Schreiben erweckte ich die sozialen Bedingungen, durch die ich meine wesentliche Prägung erfuhr, zum Leben. Oder besser: Ich gewann ein Verständnis davon, welche Machtdynamiken in mir wirkten.
Die Not, mich selbst verstehen zu wollen, brachte die Suche nach der eigenen Position ins Rollen, sie bildete den Ausgangspunkt einer Beschäftigung mit den Geschichten meiner Eltern. Ich wollte meine Geschichte aufschreiben und die Geschichten meiner Familie. Dabei ist es nicht geblieben.
Der Essayband „Von der namenlosen Menge” erscheint am 16. Mai 2024 im Haymon Verlag. Hier könnt ihr ihn bestellen.
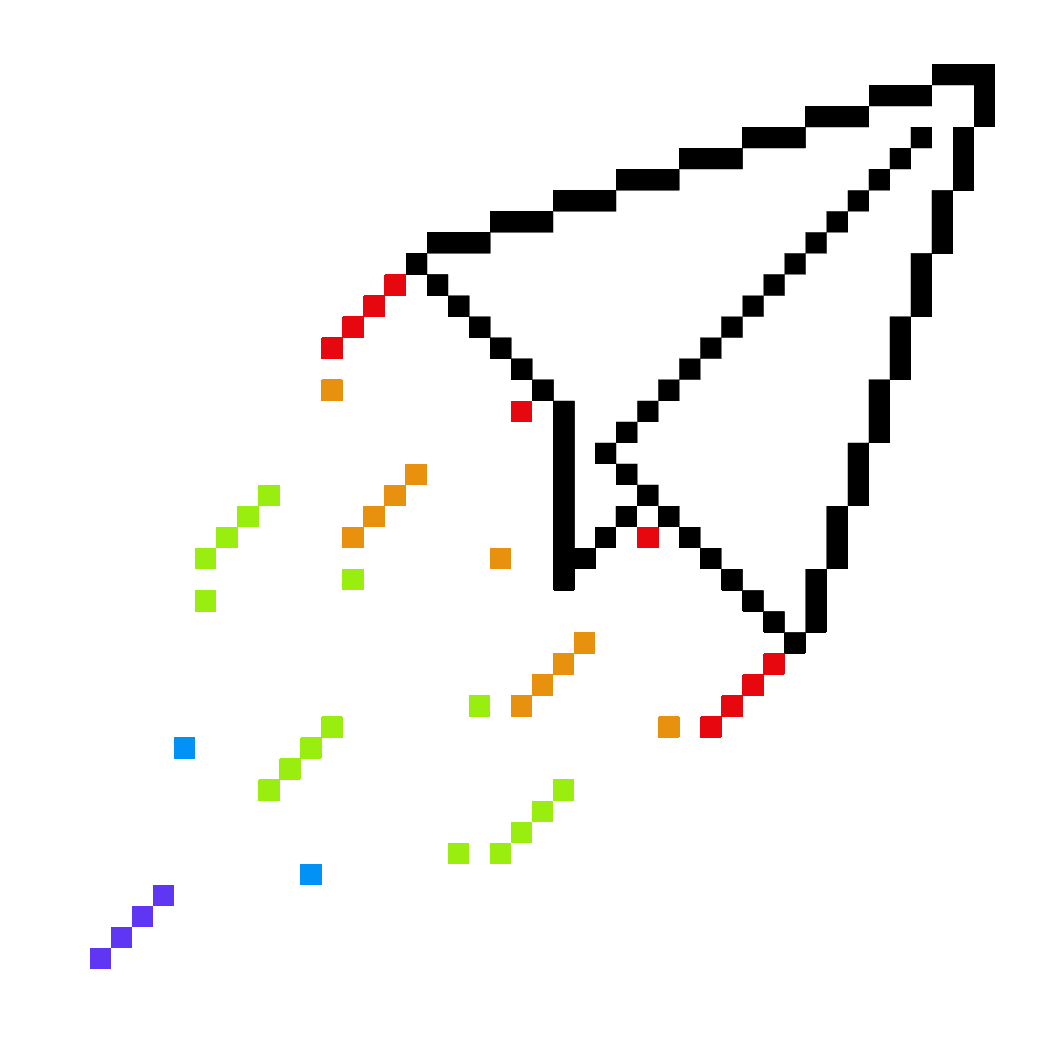
Telegram-Kanal
All unsere frisch publizierten Artikel landen direkt in unserem Telegram-Kanal. Kostenlos, ohne Werbung – so wie Du es von uns kennst. Hier geht’s zum Kanal.
Newsletter
Kein Spam, keine Hinweise auf Sonderangebote, sondern ganz einfach: Zweimal im Monat alle Artikel von das Lamm in deiner Mailbox!