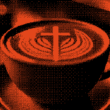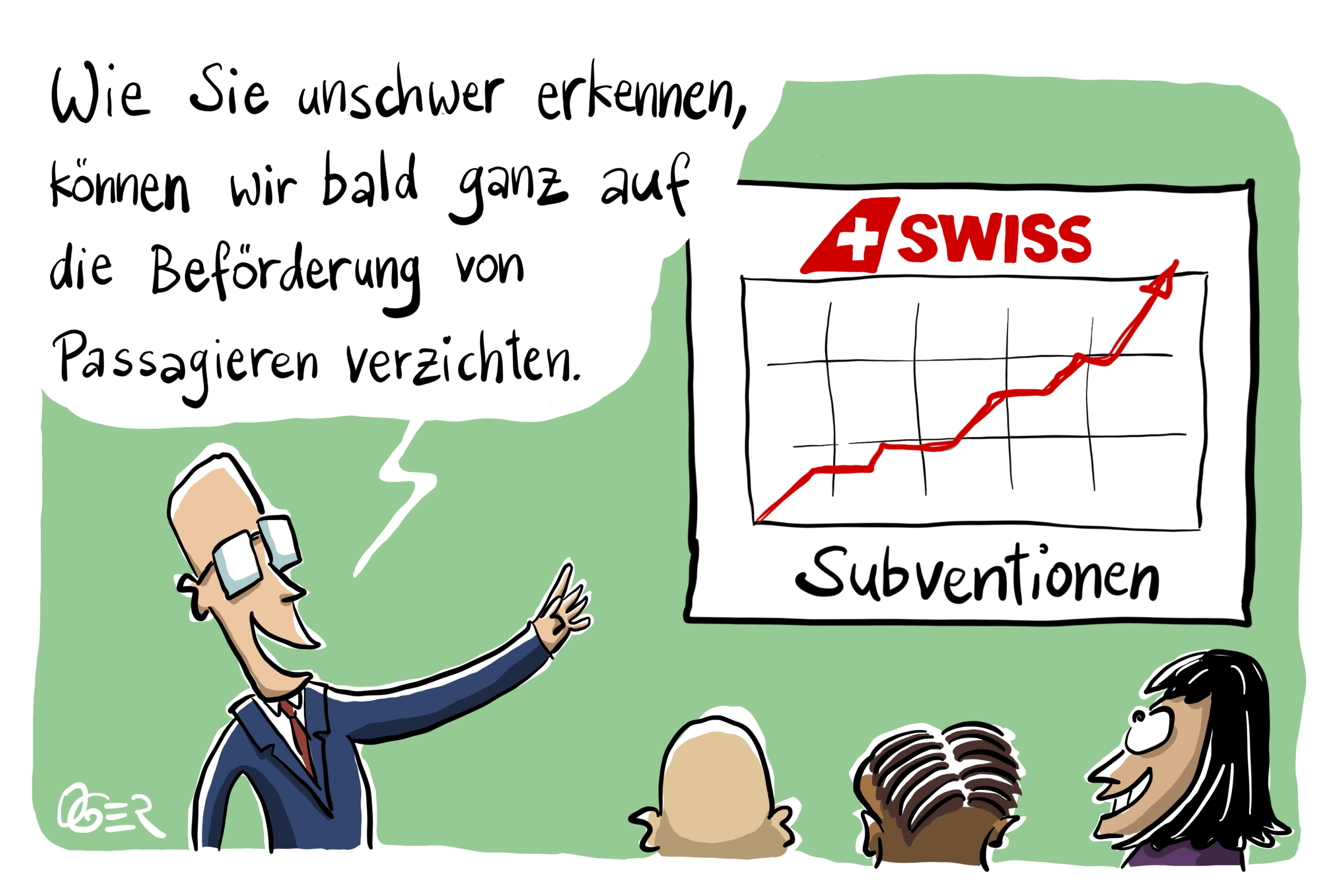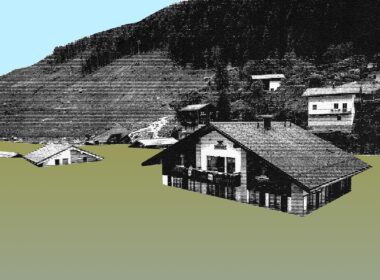Sommerzeit ist Reisezeit – und es wird wieder richtig viel geflogen. Alle Schweizer Flughäfen verzeichnen Rekordflugzahlen.
Hört man sich in der Ferienzeit an Schweizer Bars und Stammtischen um, kriegt man den Eindruck, es sei das normalste der Welt, dreimal pro Jahr in den Urlaub zu fliegen – ist es aber nicht. Laut dem WWF Schweiz sass die grosse Mehrheit der Weltbevölkerung, nämlich 80 Prozent, noch nie in einem Flugzeug.
Davon merkt man hierzulande nichts. Auch weil das Fliegen unschlagbar billig ist. Für gerade mal 55 Franken bietet Easy Jet beispielsweise ein Flugticket von Zürich nach Berlin an. Die gleiche Strecke kostet bei der Deutschen Bahn – wenn man früh genug bucht – rund 70 Franken. Dauert aber den ganzen Tag.
Auch wenn diese Zugreise eigentlich recht günstig ist: Fliegen ist noch billiger. Und das ist ein Problem.
2021 sagte das Stimmvolk knapp nein zur Revision des CO2-Gesetzes und damit auch zu einer Flugticketabgabe, die das Fliegen verteuert hätte. Eine repräsentative Umfrage ergab jedoch, dass eine Flugticketabgabe für sich alleine mehrheitsfähig gewesen wäre.
Doch anstatt Fliegen teurer zu machen, haben Politik und Verwaltung in den vergangenen Monaten nicht nur einmal, sondern gleich zweimal entschieden, den Airlines neue versteckte Subventionen zukommen zu lassen.
Emissionsgutscheine für ein paar Prozent Nachhaltigkeit
Die erste dieser Subventionen: Der Bund will Airlines in Zukunft entschädigen, wenn sie dem fossilen Kerosin eine gewisse Menge erneuerbare oder emissionsarme Treibstoffe – sogenannte Sustainable Aviation Fuels (SAFs) – beimischen. Diese werden teils elektrisch, teils aus biogenem Restmaterial wie gebrauchtem Speiseöl und tierischen Abfallfetten hergestellt. Allen gemein ist, dass ihr Energiegehalt nicht aus einer fossilen Quelle stammt. Doch da SAFs teurer sind als fossiles Kerosin, war der Absatz bis anhin klein – und die Produktion entsprechend gering.
Dass der Bund das Beimischen der SAFs nun fördern will, klingt eigentlich ganz gut. Nur: Die Airlines müssen diese Beimischung so oder so vornehmen, denn sie sind gesetzlich dazu verpflichtet – in der Schweiz voraussichtlich ab 2026, in der EU bereits seit diesem Jahr. Die Airlines nehmen die Förderung natürlich gerne an, aber beimischen müssten sie auch ohne diese Unterstützung.
«Diese Belohnung von etwas gesetzlich Vorgeschriebenem finde ich stossend und völlig falsch.»
Gabriela Suter, SP-Nationalrätin
Der Weg auf dem die Airlines entschädigt werden sollen, ist speziell. Der Bund plant, die Förderung über die Preisdifferenz zwischen dem fossilen Kerosin und den SAFs zu regeln. Diese Differenz will er den Fluggesellschaften teilweise zurückerstatten – so sieht es die neuste Überarbeitung der CO2-Verordnung vor, die in den letzten Monaten in der Vernehmlassung war. Die Airlines werden aber kein Geld, sondern sogenannte Emissionsrechte erhalten.
Mit diesen Gratisrechten können die Fluggesellschaften im Emissionshandelssystem für ihren CO2-Ausstoss bezahlen. Pro Tonne Treibhausgas müssen sie dort ein Emissionsrecht abgegeben, das sie dann berechtigt, die Luft mit einer Tonne CO2 zu belasten. Müssen die Airlines die Emissionsrechte stattdessen kaufen, kostet das aktuell rund 70 Euro pro Tonne CO2.
Während private Haushalte auf ihre Heizemissionen für jede Tonne 120 Franken CO2-Abgabe bezahlen, bekommen die Airlines die Emissionsrechte hier also um einiges billiger oder sogar gratis.
Bereits in den vergangenen Jahren erhielten die Airlines teils grosse Mengen von diesen Gratisrechten. Bis und mit 2021 bekam die Swiss gar mehr Gratisrechte, als sie für den eigenen CO2-Ausstoss brauchte. Diese grosszügigen Zuteilungen wurden jedoch in den letzten Jahren immer stärker reduziert und eigentlich war geplant, sie ganz abzuschaffen. Doch während die regulären Gratisrechte auf 2026 nun tatsächlich auslaufen, macht sich mit den neuen SAF-Gratisrechten die nächste Hintertüre für solche Emissionsgeschenke auf.
«Diese Belohnung von etwas gesetzlich Vorgeschriebenem finde ich stossend und völlig falsch», schreibt SP-Nationalrätin Gabriela Suter auf Anfrage von das Lamm. Das Parlament habe zwar bei den Gratisrechten für die SAFs eine Ausnahme beschlossen und davon mache der Bund jetzt Gebrauch. «Aber ich glaube nicht, dass in der Detailberatung je zur Sprache kam, man wolle diejenigen, die lediglich die gesetzliche SAF-Pflicht erfüllen, zusätzlich belohnen.»
Die neue Beimischpflicht hätte eigentlich dazu führen können, dass der Flug nach Berlin nicht mehr billiger zu haben ist als ein Zugticket von Genf nach St. Gallen. Denn die Swiss und Co. hätten die Mehrkosten wahrscheinlich auf die Flugtickets abgewälzt.
Daraus wird nun aber nichts.
Auf Kosten der Nachtzüge
Auch die zweite der kürzlich eingeführten Subventionen betrifft die SAFs. Die Politik will nicht nur den Airlines beim Kauf unter die Arme greifen, sondern auch die SAF-Produktion fördern. Und zwar auf Kosten der Nachtzüge.
Wie kann das sein? Was den Airlines nach der Zuteilung der Gratisrechte an Emissionsbewilligungen fehlt, müssen sie bei Auktionen ersteigern, die das Bundesamt für Umwelt BAFU organisiert. Das bringt dem Staat Einnahmen, die er klimawirksam einsetzen kann. Anfang 2024 beschloss das Parlament bei der Überarbeitung des CO2-Gesetzes, diese Einnahmen für zwei Zwecke zu nutzen: Erstens, um Nachtzugverbindungen auszubauen. Zweitens, um die Produktion von SAFs anzukurbeln.
Für die Nachtzüge waren 30 Millionen vorgesehen. Fliessen werden nun aber lediglich 10 Millionen. Wieso? Ende 2024 brach in der Schweiz das Sparfieber aus, denn in der Bundeskasse drohe ein Loch. Mit einer Reihe von Gesetzesanpassungen will der Bundesrat ab 2027 rund drei Milliarden Franken einsparen – über 400 Millionen davon im Klimaschutz, auch beim internationalen Schienenverkehr.
Unklar ist, ob dem Parlament überhaupt bewusst war, dass es der Luftfahrt hier ein Subventionsgeschenk beschert hat.
Im vorauseilenden Gehorsam beschloss das Parlament Ende 2024 bei den Nachtzügen nicht erst 2027, sondern bereits 2025 den Rotstift anzusetzen und strich die eigentlich geplanten 30 Millionen Franken auf 10 Millionen zusammen.
Nur wird dieses Manöver der Bundeskasse gar keine Entlastung bringen. Denn alles Geld, das nicht zu den Nachtzügen geht, landet laut dem Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL bei den SAFs.
Der entsprechende Artikel im CO2-Gesetz enthalte nur zwei Verwendungszwecke, so das BAZL. Der erste für den internationalen Schienenverkehr sei auf maximal 30 Millionen Franken pro Jahr beschränkt. «Gelder, die gemäss Entscheid des Parlaments zum Budget 2025 nicht diesem Verwendungszweck zukommen, fallen automatisch dem zweiten Verwendungszweck zu», schreibt das BAZL auf Anfrage. Weder eine Rückstellung für eine spätere Zuteilung zugunsten des internationalen Schienenverkehrs noch eine Umleitung in die Bundeskasse sei gemäss aktuell geltendem CO2-Gesetz möglich.
Man könnte meinen, die SBB sei darüber nicht gerade erfreut. Doch auf die Frage, ob sie sich gegen diesen Entscheid wehre, erklären die Bundesbahnen lediglich, dass sie sich nicht zu politischen Prozessen äussern. Und dies, obwohl in der Schweiz noch nie so viel geflogen wurde wie im Sommer 2025. Anscheinend läuft das Geschäft bei den Airlines und an den Flughäfen also ganz gut. Stellt sich die Frage: Braucht die Luftfahrt diese Subventionen überhaupt?
Wurde das Parlament an der Nase herumgeführt?
Unklar ist auch, ob dem Parlament überhaupt bewusst war, dass es der Luftfahrt hier ein Subventionsgeschenk beschert hat. Denn in der gesamten Debatte rund um die Nachtzuggelder wies kein einziges Ratsmitglied darauf hin, dass eine Kürzung bei den Nachtzügen lediglich der Luftfahrt zugutekommt – und nicht etwa der Bundeskasse.
Zudem verkauft Finanzministerin Karin Keller-Sutter dem Parlament die Kürzung der Nachtzuggelder ziemlich direkt als eine Entlastung des Bundeshaushaltes – man könne durch die Streichung bei den Nachtzügen zusätzlichen Handlungsspielraum schaffen, gibt sie in einem Votum zu bedenken.
Unterstütze unabhängigen Journalismus.
Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!
Doch wie genau entsteht dieser Handlungsspielraum, wenn die Nachtzuggelder automatisch im Topf für die SAFs landen? Das Lamm hat bei der eidgenössischen Finanzverwaltung nachgefragt: «Der Handlungsspielraum entsteht, wenn im Budget die Ausgaben für den grenzüberschreitenden Personenschienenverkehr reduziert werden, für Massnahmen im Luftverkehr aber keine entsprechenden Mehrausgaben beschlossen werden.»
Was heisst das konkret? Mit dem Entscheid, bei den Nachtzügen zu kürzen, sind die 20 Millionen zwar definitiv in den Topf für die SAF-Produktion geflossen. Dieses Geld darf jedoch im laufenden Jahr noch nicht ausgegeben werden, da ein weiterer Parlamentsentscheid für die Mehrausgaben bei den SAFs fehlt. Das Geld ist also bei der SAF-Förderung parkiert, kann aber noch nicht fliessen. «Entsprechend können diese 20 Millionen ein Jahr lang zwischenzeitlich für etwas anderes ausgegeben werden», so die Finanzverwaltung weiter. Was wie von Bundesrätin Keller-Sutter erwähnt, einen gewissen Handlungsspielraum schaffe – allerdings nur für ein Jahr und nur auf Pump. Die meisten Parlamentsmitglieder dürften unter diesem «Handlungsspielraum» jedoch etwas anderes verstanden haben.
Ganz viel Unwissen
In einer kürzlich in der WOZ erschienenen Recherche räumten Ratsmitglieder aus verschiedensten Parteien ein, dass ihnen nicht klar war, dass ein Runter bei den Nachtzügen einfach zu einem Rauf bei den SAFs führt. «Das war für die allermeisten Räte wohl tatsächlich nicht Sinn der ganzen Übung», schreibt zum Beispiel Christian Imark, SVP-Parlamentarier und Präsident der nationalrätlichen Umweltkommission. Offenbar gingen die meisten National- und Ständerät*innen davon aus, mit der Streichung bei den Nachtzügen die Bundeskasse um 20 Millionen zu entlasten.
Auch Imark argumentierte in einer ersten Antwort auf eine Medienanfrage, die das Lamm vorliegt, die Nachtzugstreichungen würden sehr wohl zu einer Entlastung des Bundesbudgets führen. Das habe ihm das Sekretariat der Umweltkommission so bestätigt. In diesem Sekretariat sitzen jene Leute, die die Kommissionsmitglieder in Sachfragen beraten – also eigentlich die Expert*innen.
Erst nach erneutem Nachfragen und nachdem sich das Sekretariat nochmals mit dem für die EHS-Erlöse zuständigen BAFU kurzgeschlossen hatte, kommen auch das Sekretariat und Imark zum Schluss, dass das Manöver nicht mehr Geld in die Bundeskasse spült. Die erste Antwort sei auf der Basis einer «unvollständige Auskunft» entstanden. Zu seiner Verteidigung fügt Imark hinzu: «Wenn selbst Profis nicht genau wissen, was Sache ist, wie soll es dann ein Milizparlament korrekt verstehen?»
Damit hat er nicht unrecht. Die über Jahre gewachsene Schweizer Klimagesetzgebung ist tatsächlich ziemlich komplex. Trotzdem: Die Verantwortung, sich für oder gegen etwas zu entscheiden, liegt schlussendlich bei der gewählten Volksvertretung. Allerdings sollte man erwarten können, dass diese Volksvertretung von der Regierung nicht an der Nase herumgeführt wird und alle Informationen hat, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 39 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2288 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1365 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 663 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?