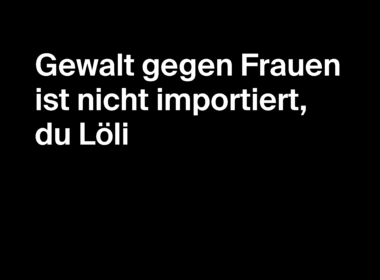Ni Una Menos. Nicht eine weniger. Mit diesem Aufruf ziehen Aktivist*innen weltweit durch die Strassen. Sie kämpfen dagegen, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden. Angefangen haben die Proteste 2015 in Argentinien, nachdem die 14-jährige Chiara Paez von ihrem Freund getötet wurde, weil sie nicht abtreiben wollte.
Seit August 2019 existiert auch ein Zürcher Kollektiv. Wir haben zwei Aktivistinnen getroffen und mit ihnen darüber geredet, was sich in den letzten fünf Jahren verändert hat und was es braucht, damit Feminizide endlich aufhören. Sie haben sich entschieden, in diesem Interview nur mit Vornamen und ohne Bild zu erscheinen, um nicht als Einzelpersonen, sondern als Kollektiv aufzutreten.
Das Lamm: Stine und Nekane, ihr kämpft seit fünf Jahren gegen Feminizide. Doch sowohl die Zahlen des Bundes als auch jene von Stop Feminizid zeigen: Tötungen an Frauen nehmen nicht ab. Was löst das bei euch aus?
Stine: Wut. Aber es motiviert mich vor allem, weiterzukämpfen.
Nekane: Bei mir ist es ähnlich. Nach jedem weiteren Feminizid denke ich: jetzt umso mehr und umso lauter.
„Die Pandemie hat uns separiert und alltägliche Organisationsstrukturen durchbrochen.”
Nekane, Aktivistin bei Ni Una Menos Zürich
Trotzdem scheint die Aufbruchstimmung seit 2019 etwas abgeflacht. Woran liegt das?
Nekane: 2019 war wie eine Vision. Weltweit gab es eine feministische Welle und in der Schweiz fand der grosse feministische Streik statt. Man hat sich vernetzt und es entstanden viele neue Gruppierungen. Dann kam die Pandemie. Sie hat uns separiert und alltägliche Organisationsstrukturen durchbrochen. Seither versuchen wir, diese Kraft wieder zu aktivieren.
Im selben Jahr wie der grosse feministische Streik 2019 wurde auch das Schweizer Kollektiv von Ni Una Menos gegründet. Wie kam es dazu?
Nekane: Viele von uns kannten die Bewegung bereits aus Lateinamerika. Im Vorfeld zum Streik haben wir in Zürich die Statuen mit Ni-Una-Menos-Bannern verschönert, um auch hier auf die Problematik aufmerksam zu machen. Dabei wurden wir von der Polizei kontrolliert, teils sexistisch beleidigt und eine von uns kam sogar vor Gericht. Das wollten wir nicht tolerieren. Deshalb sind wir am Prozesstag auf den Helvetiaplatz gezogen und haben ihn zum Ni-Una-Menos-Platz umbenannt.
Mit welcher Botschaft?
Nekane: Wir wollten zeigen: Wir sind hier und wir lassen uns nicht einschüchtern. Feminizide gehen uns alle an. Wir verschliessen die Augen nicht, sondern organisieren unsere Wut.

Statt „Femizid” verwendet ihr den spanischen Begriff „Feminizid”. Was ist der Unterschied?
Nekane: Femizid ist dasselbe wie Homizid. Sprich, ein Mann tötet eine Frau, weil sie eine Frau ist. Der Fokus bleibt dabei sehr stark auf Täter und Opfer. Dadurch werden die Tötungen zu Einzelfällen oder als Privatsache dargestellt. Der Begriff Feminizid hingegen geht weiter, er zieht die Rolle des Staats, der Gesellschaft und aller Institutionen mit ein.
„Der Staat, wie er heute funktioniert, schützt uns nicht.”
Nekane, Aktivistin bei Ni Una Menos Zürich
Inwiefern?
Nekane: Feminizide passieren, weil wir in einer patriarchalen, frauen- und queerfeindlichen Gesellschaft leben. Deshalb wäre es eigentlich die Verantwortung des Staats, diese Morde zu verhindern. Somit trägt er bei jedem Feminizid eine Mitschuld.
Ist es nicht ein Widerspruch zu glauben, dass der Staat uns schützt, wenn auch von diesem Gewalt ausgeht?
Nekane: Nein. Nur der Staat, wie er heute funktioniert, schützt uns nicht. Stattdessen übt er selbst Gewalt aus. So werden zum Beispiel Opfer sexualisierter Gewalt von der patriarchalen Justiz infrage gestellt, anstatt dass ihnen geglaubt wird.
Viele Frauen werden zudem wegen ihres migrantischen und ökonomischen Status gezwungen, bei ihren gewalttätigen Ehemännern zu bleiben. Von einem solch patriarchalen, rassistischen und neoliberalen Staat können wir keinen Schutz erwarten. Deswegen organisieren wir uns und kämpfen gegen dieses System.
Stine, du kamst etwas später zu Ni Una Menos. Wie bist du dazugestossen?
Stine: Im Lockdown habe ich mit einer Freundin für eine Aktion von Ni Una Menos Flyer mit Anlaufstellen zu häuslicher Gewalt an Haustüren gehängt. Dabei wurden wir verhaftet. Ich habe das als einen sehr sexistischen und gewaltvollen Moment erlebt. Danach gingen wir zu einem Treffen von Ni Una Menos und haben über den Vorfall gesprochen. Durch das Kollektiv habe ich grosse Solidarität gespürt und realisiert, welche Rolle der Staat in der Thematik spielt.
Was war der Grund für die Verhaftung?
Stine: Es gab keinen. Die Polizei liess danach alle Vorwürfe fallen.
Eure Anfänge sind nun fünf Jahre her. Was hat sich seither getan?
Stine: Ich denke, das gesellschaftliche Bewusstsein ist sicher gestiegen und auch die Medien nutzen den Begriff „Feminizid” öfters.
Woran macht ihr das fest?
Nekane: Es ist schwierig für die gesamte Gesellschaft zu sprechen. Aber wenn wir irgendwo präsent waren, sind auch schon Leute auf uns zugekommen und haben sich für unsere Arbeit bedankt. Oder es haben uns Menschen auf Social Media kontaktiert, die Unterstützung brauchten. Viele haben sich zudem dieses Jahr am feministischen Streik an unserem Schrei gegen Feminizide beteiligt.
„Die Schweizer Medien blenden aus, dass wir in Strukturen leben, die patriarchal und frauenverachtend sind.”
Stine, Aktivistin bei Ni Una Menos Zürich
Skeptischer bin ich bei den Medien: Feminizide werden verharmlost und nicht strukturell eingeordnet. Es gibt Momente, wo wir denken, unsere Botschaft ist angekommen, weil bewusster berichtet wird. Doch dann in der nächsten Woche werden wieder Begriffe wie Familiendrama, erweiterter Suizid, Ehrenmord oder Mord verwendet.
Stine: Das stimmt, wie zum Beispiel im Fall von Basel. Die Medien haben über alle möglichen Verantwortlichkeiten geredet, ohne jemals den Begriff Feminizid in Betracht zu ziehen.
Als ein verurteilter Mörder während eines unbegleiteten Hafturlaubs im Basler Breite-Quartier eine Frau tötete?
Stine: Die Medien haben darüber geschrieben, als wäre es ein Einzelfall. Es wird ausgeblendet, dass wir in Strukturen leben, die so patriarchal und frauenverachtend sind, dass diese auch bei einem psychisch Kranken durchschlagen.
Nekane: Zusätzlich zur Tatsache, dass die Medien in der Schweiz die Feminizide nicht benennen, sehe ich ein weiteres Problem: Die ermordeten Frauen haben keine Namen.
Zum Schutz der betroffenen Familien.
Nekane: In der Schweiz wird Privatsphäre sehr hochgehalten. So verschiebt man aber das Problem in den familiären, privaten Raum. In anderen Ländern haben die ermordeten Frauen einen Namen und eine Geschichte. Dadurch können Aktivist*innen mit Familienangehörigen in Kontakt treten und ein kollektives Bewusstsein herstellen.
Weltweit sieht die Lage jedoch leider nicht besser aus. Laut dem letzten UNO-Bericht wurden 2022 insgesamt 89’000 Frauen und Mädchen absichtlich getötet. So viele wie seit 20 Jahren nicht mehr.
Nekane: Die Zahlen bestätigen nur, was wir schon wissen: In politischen Konflikten oder Kriegssituationen, wie sie derzeit vielerorts herrschen, gibt es immer auch sexualisierte Gewalt als Waffe. Es gibt zudem in vielen Ländern einen Rechtsrutsch und das akzentuiert die Gewalt gegen FLINTAs (Frauen, Lesben, inter, trans und agender Personen). Das liegt auch daran, dass wir uns wehren und für unsere Rechte kämpfen. Dadurch fühlen sich viele bedroht.
Trotzdem macht ihr weniger Kundgebungen als früher. Woran liegt das?
Stine: Früher sind wir nach jedem Feminizid auf die Strasse gegangen. Da es allein in der Schweiz bis zu 26 Morde pro Jahr gab, sind wir jedoch an unsere Grenzen gestossen. Wir haben zudem bemerkt, dass die Kundgebungen den Leuten oft zu spontan waren. Deshalb machen wir jetzt nur noch eine pro Monat, immer am letzten Samstag.
„Es reicht nicht, wenn wir einmal im Jahr an den feministischen Streik gehen.”
Nekane, Aktivistin bei Ni Una Menos Zürich
Wie könnte Widerstand noch aussehen?
Nekane: Für mich heisst Widerstand, da zu kämpfen, wo man ist, mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Damit meine ich: Es reicht nicht, wenn wir einmal im Jahr an den feministischen Streik gehen. Wir müssen auch im Alltag unbequem sein und dürfen nicht schweigen, wenn wir etwas sehen oder erleben, das nicht in Ordnung ist.

Ein stetiger Kampf kostet viel Kraft.
Nekane: Das ist so und man macht sich damit auch nicht beliebt. Ich erwarte jedoch nicht von jedem*jeder, dass er*sie dieselbe Haltung einnimmt wie ich. Wichtig ist nur, dass man versucht, in dem Rahmen Widerstand zu leisten, wo es möglich ist.
Stine: Es hilft, sich zu verbünden. Wir haben uns in den letzten Jahren mit vielen anderen Gruppen vernetzt. Es kann aber auch im Kleinen sein, indem man sich zum Beispiel im Arbeitsumfeld jemanden sucht, mit dem man sich austauschen kann.
Was muss passieren, damit wir nicht in fünf Jahren wieder hier stehen und über dieselben Zahlen sprechen?
Nekane: Das liegt aktuell leider nicht in unserer Hand. Der Staat hätte die Mittel, das zu ändern, aber die meisten Politiker*innen halten das patriarchale System aufrecht.
Steht ihr mit Politiker*innen in Kontakt?
Nekane: Nein. Für uns sind sie Teil des Problems, weil sie in diesem System agieren. Unser Fokus liegt auf der Strasse. Nur wenn wir genügend Kräfte mobilisieren, bringen wir sie dazu, ihre Entscheide und Strukturen zu ändern. Es braucht eine feministische Revolution.
Glaubt ihr, dass es irgendwann keine Feminizide mehr gibt?
Stine: Ja, wenn das Patriarchat abgeschafft wird.
Nekane: Sonst würden wir nicht kämpfen. Und wir hören nicht auf, bis es so weit ist.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 21 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1352 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 735 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 357 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?