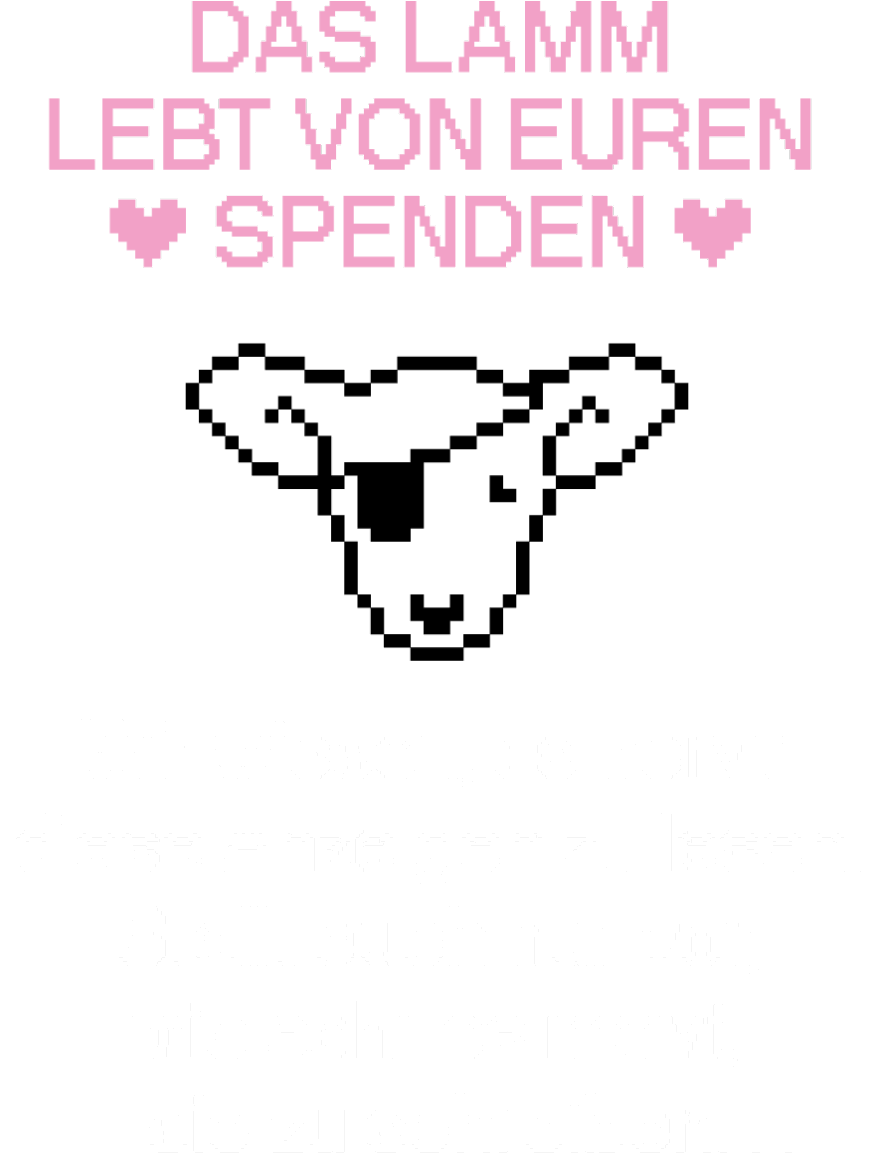Ja!
Simon Muster
Die Illusion der anständigen Schweiz ist ein dünner Schleier, der leicht verrückt. Manchmal reichen ein Schopf blondierter Haare und ein paar protzige Sportwagen, und eine Nation überbeisst.
Was der Nationalmannschaft in den letzten Wochen an unverhohlenem Rassismus aus der Schweizer Mehrheitsgesellschaft entgegengeschlagen ist, sollte empören. Doch wer sich mit der jüngeren Geschichte dieses Teams auseinandersetzt, kann nicht wirklich überrascht sein. Egal, ob die ewige Diskussion über die Nationalhymne, den Doppeladler oder eingeflogene Coiffeur:innen: Die Elf um Xhaka wird schon länger als abgehoben beschrieben – als Multimillionäre, die den Bezug zur einfachen Schweizer Bevölkerung verloren hätten, weil einige davon beim Trainingslager in Bad Ragaz mit teuren Sportwagen vorgefahren sind.
Dieselbe Schweizer Bevölkerung fährt übrigens, wie Sportjournalist Florian Renz angemerkt hat, proportional am meisten SUVs in Europa. Und währenddessen baut sich Nationalheld Roger Federer in Rapperswil eine 16’000 Quadratmeter Villa direkt an den Zürichsee. Womit sich Herr und Frau Schweizer halt noch identifizieren können.
Vorgeschoben wird bei der neusten Kritik an Shaqiri und Co. das Leistungsargument: Das Spiel gegen Italien sei grottenschlecht gewesen, die Spieler nicht engagiert bei der Sache. Als würde ein schlechter Arbeitstag das Trommelfeuer der rassistischen Kritik legitimieren.
Profisport ist wie jeder gesellschaftliche Raum eminent politisch – und Männerfussball ist der grösste und einflussreichste Sport der Welt. Wer genau hinschaut, findet hier alle gesellschaftlich relevanten Diskussionen gespiegelt. Natürlich war die Regenbogendiskussion rund um das Spiel der Deutschen gegen Ungarn symbolisch und die Anbiederung von Unternehmen und Politiker:innen lächerlich – aber wie viele der grölenden Männerfussballfans hätten ohne die Armbinde von Manuel Neuer von der politischen Homophobie in Ungarn erfahren?
Der tragische Suizid eines Nachwuchsspielers in Grossbritannien haben erst kürzlich zu einer öffentlichen Diskussion über psychische Gesundheit und toxische Männlichkeit bei Fussballern geführt. Die ständigen rassistischen Anfeindungen, die POC-Fussballer tagtäglich erleben, hat zu einer anhaltenden Solidaritätsbewegung unter den Spielern geführt – eine Bewegung, die die Premier League und die UEFA eifrig versuchen zu entpolitisieren.
All diese Diskussionen sind wichtig – und die politische Linke wäre gut beraten, sich gegen die Entpolitisierung von Männerfussball einzusetzen. Kaum ein anderes öffentliches Phänomen wird von so vielen Menschen aus den unterschiedlichsten politischen Lagern und sozioökonomischen Schichten verfolgt. Auch wenn der einst proletarische Breitensport heute komplett vom Kapital vereinnahmt ist – bei den Spielen fiebern immer noch Menschen mit, nicht Aktien.
Deswegen: Wer im Männerfussball die Deutungshoheit hat, hat auch politische Macht. Diese liegt heute bei den Konzernen: Profifussball ist ein freier Markt, auf dem Fussballer ohne nennenswerten Arbeiter:innenschutz gehandelt werden und Fankultur als Mittel zur Vermarktung instrumentalisiert wird. Ein linker, politischer Fussball hingegen verstaatlicht die Fussballvereine und überführt sie an Fans und Community; er bricht die unsinnige Geschlechtertrennung auf und löst sich aus der Gängelung von Fussballverbänden. Gerade die Schweiz, als Hauptsitz von UEFA (Nyon) und FIFA (Zürich), wäre ein guter Ausgangspunkt für Veränderungen.
Stattdessen werden während grossen Turnieren wie der EM immer die gleichen Argumente von Links gegen den Nationalismus bei Länderspielen, patriarchale Männerbilder und das kapitalistische Wesen der Sportverbände und Vereine laut. Diese Kritik ist berechtigt. Sie wirkt aber platt und selbstgerecht, wenn man nicht versucht, etwas zu ändern. Die Stimmen innerhalb des Sports, die für eine bessere Fussballwelt arbeiten, sind da, doch sie sind auf sich allein gestellt. Das Feld wird lieber jenen überlassen, die Geld an den von links kritisierten Strukturen verdienen.
Natürlich sind die Schweizer Fahnen an jeder Ecke peinlich und niemand muss beim Spiel heute Abend mitfiebern. Sich nicht für Männerfussball zu interessieren ist das Normalste der Welt. Wenn sich allerdings der Schleier verschiebt und der rassistische Diskurs über Zugehörigkeit und Legitimität an der Schweizer Nationalmannschaft kristallisiert, ist die linke Pauschalverweigerung fatal. Solidarität mit Mitmenschen kann nicht dort aufhören, wo wir uns nicht unterhalten fühlen.
Es gibt genug «Patriot:innen» in diesem Land, die mit ihren rassistischen Ressentiments nur darauf warten, dass Frankreich Akanji und Seferović heute hochkant nach Hause schicken. Deswegen: Sich heute über eine gute Leistung der Schweiz zu freuen, ist ironischerweise eine antipatriotische Handlung.
Nein!
Jonas Frey
Fussball scheint eine grosse Sache zu sein, wirft man dieser Tage einen Blick auf die Titelseiten von Schweizer Tageszeitungen. Elf Männer der Schweizer Nationalmannschaft treten heute Abend gegen elf Männer aus Frankreich an. Im Vorfeld des Achtelfinalspiels der Europameisterschaft äussern sich die Schweizer Kicker zu ihren Chancen, sprechen über Taktik und Mentalität, über Leidenschaft und Härte.
Es geht um Sport. Um Sieg oder Niederlage. Und es geht um Männer.
Es geht um Sport. Um Sieg oder Niederlage. Und es geht um Männer.
Die Erkenntnis, dass es im Sport darüber hinaus um Politik geht, ist so banal und offensichtlich wie die Tatsache, dass Patriarchat und Marktliberalismus unser Leben schlechter machen. Und trotzdem herrscht im Profifussball die Devise: Hier darf Politik keine Rolle spielen.
So durfte die Münchner Allianz-Arena beim Europameisterschaftsspiel zwischen Deutschland und Ungarn letzte Woche nicht in den Regenbogenfarben leuchten, wie der Europäische Fussballverband UEFA entschied. Dies, nachdem die Stadt München einen Antrag bei der UEFA stellte, um gegen ein vom ungarischen Parlament vorletzte Woche verabschiedetes homo- und transfeindliches Gesetz zu protestieren.
In einem Statement schrieb die UEFA, das diesbezügliche Anliegen der Stadt München sei hinsichtlich des Ungarn-Kontextes «politisch». Der Regenbogen hingegen sei «kein politisches Symbol, sondern ein Zeichen für unser Engagement für eine diversere und inklusivere Gesellschaft.»
Die in der Folge durch zahlreiche Spieler angestossene Kritik gegen die menschenfeindliche Politik Viktor Orbáns und die Empörung über den Entscheid der UEFA mögen löblich sein. Dass die Kritik jedoch in einem Rahmen aufflammt, der laut Akteur:innen und Organisator:innen des Fussballs nicht politisch sein sollte, lässt sie zur Farce verkommen.
Wenn eine Organisation mit dem Einfluss einer UEFA den Regenbogen aus seinem politischen Kontext reisst, ihn in einen Freiraum für Männlichkeit, Nationalismus und Kommerz integriert, so verwässert dies die Dringlichkeit des Anliegens.
Denn am Ende steht ausschliesslich das Grätschen und Kicken im Vordergrund. Der Sport. Sieg oder Niederlage. Die Männer.
Wenn der Männerfussball etwas nicht kann, dann gesellschaftliche Veränderungen anstossen. Er ist das Produkt einer patriarchal-kapitalistischen Gesellschaft, der Männlichkeitskult und die Identifikation damit fördert. Alle politischen Anliegen, die an ihn herangetragen werden, werden abgestumpft durch seinen Anspruch, nicht politisch zu sein und durch die Tatsache, dass es nur Männer sind, die Anliegen einbringen und thematisieren.
Der Anspruch des Männerfussballs, politikfrei zu sein, bietet dem männlichen, kommerziellen und nationalistischen Status Quo die idealen Überlebenschancen. Alle darin enthaltenen Anzeichen von Politik gehen unter im Unterhaltungswert des Spiels. Fussball bleibt Fussball, Politik bleibt Politik.
So geschah auch nach der Aktionswelle um das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn auf politischer Ebene nichts.
So geschah auch nach der Aktionswelle um das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn auf politischer Ebene nichts. Ungarn ist weder aus der EM ausgeschlossen worden, noch wird sich die EU zu einer restriktiveren Politik gegen Orbán durchringen. Eine grosse Mehrheit der europäischen Staatschef:innen bleibt ihrer marktliberalen Politik verpflichtet. Auf dem Rasen der Fussballplätze der Europameisterschaft grätschen weiterhin ausschliesslich Männer, die ihre öffentliche Reichweite für die Inszenierung von Normschönheit statt für den Kampf gegen Geschlechterungerechtigkeit nutzen.
Sollte also der Torhüter der Schweiz Yann Sommer beim heutigen Spiel gegen Frankreich hin- und her hechtend das Weiterkommen der Nationalmannschaft sichern, im Interview nach dem Spiel von Stolz und Stärke sprechen und morgen auf den Titelseiten der Schweizer Tageszeitungen zum Helden der Nation stilisiert werden, wird einmal mehr deutlich, was der Männerfussball ist: eine reaktionäre Sportart, bei der Männer für Männer gewinnen, die nichts zur Überwindung der vorherrschenden Strukturen beitragen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 8 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 676 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 280 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 136 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?