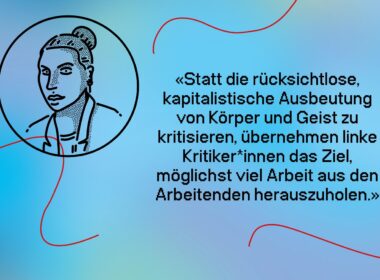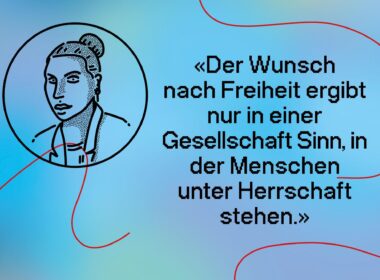In einem Interview über die ungleiche Verteilung von Vermögen mit der Ökonomin Irene Becker stolpere ich über eine Aussage, deren Wahrheit mir körperliche Schmerzen bereitet – vielleicht, weil sie gleichermassen schlicht und wahr ist.
„ZEIT ONLINE: Wäre es denn wünschenswert, mehr reiche Menschen in dieser Gesellschaft zu haben?
Becker: Nein. Wenn es mehr reiche Menschen gäbe, ohne dass andere Gruppen darunter leiden, wäre das kein Problem. Aber das passiert nicht. Reichtum geht meistens zulasten der Menschen, die in Armut oder im Prekariat leben. Das macht ihn so problematisch.”
Der Reichtum des einen geht zulasten des anderen. Boom, da steht es. Heute weiss ich, dass das stimmt. Doch das war nicht immer so. Die Armut, in der ich bis zu meinem dreissigsten Lebensjahr mehrheitlich gelebt habe, war die Bedingung für den Reichtum derer, die mich und meine Familie ausgebeutet haben. Das eine geht nicht ohne das andere.
Ich muss fünfunddreissig und ein halbes Jahr alt werden, damit in mir diese zwei Dinge verknüpft wurden: das intellektuelle Verstehen vom Wirkmechanismus des Reichtums, das schon vor Jahren eingesetzt hat, und die verkörperte Wahrheit dieser Aussage in meinem eigenen Leben.
Ich musste die meiste Zeit meines Lebens in Armut leben, damit ein Reicher (es sind meist Männer) irgendwo auf der Welt eine gute Zeit hat.
Auf der einen Seite stand das mühsam erlernte theoretische Wissen darum, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist und wie die Gesetze des Neoliberalismus funktionieren, unter deren Knute wir leben. Auf der anderen Seite war da ein praktisches Wissen, das sich in Form von Verletzungen und Narben, die mir die körperliche Arbeit zufügte, in meinen Körper eingeschrieben hatte.
Reiche als Feindbild
Meine sechs Zentimeter lange und 0.5 Zentimeter breite Narbe ist die Bedingung für die Erlebnisse gleichaltriger Kinder von Reichen.
Denn: Sie können reiten, weil ich es bin, dem die Narbe zugefügt wird.
Meine These lautet: Der Reichtum einiger ist die Voraussetzung für die Armut vieler. Oder eine Nummer persönlicher: Ich musste die meiste Zeit meines Lebens in Armut leben, damit ein Reicher (es sind meist Männer) irgendwo auf der Welt eine gute Zeit hat.
Wenn wir über Reiche reden – über Parolen wie eat the rich oder das etwas kompatiblere tax the rich – dann sind reiche Menschen für die allermeisten das abstrakte Gegenüber, dass wir zu kennen glauben, ohne dass wir es wirklich kennen. Das macht es uns so einfach, derartige Sprüche in den sozialen Medien zu teilen oder sie auf Demos zu rufen.
In einem Text bringen die Autorinnen Ann Kristin Tlusty und Vanessa Lara Ullrich den performativen Charakter vom eat the rich-Topos auf den Punkt. Superreiche, schreiben sie, würden ein Feindbild bieten, mit deren Hilfe man sich auf der richtigen Seite wähne.
Eine Kritik am Reichtum, die seine Entstehung nicht problematisiert, bleibt notwendigerweise performativ.
Ich teile das Unwohlsein mit der populär zur Schau gestellten Wut auf Reiche und Superreiche. Denn Kapitalismus besteht laut den Autorinnen nicht im „Kampf der bösen Superreichen gegen die guten Lohnabhängigen – sondern darin, dass jene, die nicht mehr zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft, denen gegenübertreten, die über die Produktionsmittel verfügen.”
Eine Kritik am Reichtum, die seine Entstehung nicht problematisiert, bleibt notwendigerweise performativ. Will die Erzählung von eat the rich also tatsächlich etwas verändern, muss die Kritik an der abstrakten Akkumulation von Mehrwert mit der persönlichen Ebene der Mangelerfahrung im eigenen Leben verbunden werden.
Die Wut auf Reiche birgt deswegen trotzdem revolutionäres Potenzial. Sie braucht nur eine materielle Analyse.
„David gegen Goliath” ist hier Programm: Olivier David gegen die Goliaths dieser Welt. Anstatt nach unten wird nach oben getreten. Es geht um die Lage und den Facettenreichtum der unteren Klasse. Die Kolumne dient als Ort, um Aspekte der Armut, Prekarität und Gegenkultur zu reflektieren, zu besprechen, einzuordnen. „David gegen Goliath” ist der Versuch eines Schreibens mit Klassenstandpunkt, damit aus der Klasse an sich eine Klasse für sich wird. Die Kolumne erscheint ebenfalls als Newsletter.
Und eine Spurensuche im eigenen Leben: Wo war ich den Bedingungen des Reichtums unterworfen? Wo hat sich die Ungleichheit in Form des Mindestlohns, der Frust der Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankungen und mangelhafte medizinische Versorgung in den eigenen Lebenslauf eingeschrieben?
Und: Kann man zwischen Selbsterlebtem und dem Reichtum der Menschen in unmittelbarer Umgebung eine Verbindung herstellen? Wenn ja, wie sieht sie aus?
Blut im Schuh und Champagner im Überfluss
Ich starte den Versuch am eigenen Leib. Ein alter Theaterspruch besagt: „Den König spielen die anderen.” Dieser Ausruf bedeutet, dass ein*e König*in erst durch seine*ihre Untertan*innen zum*zur König*in wird. Wenn der*die König*in sich gewöhnlich gibt, während seine*ihre Gefolgsleute vor ihm*ihr Knien, dann zementiert gerade dieses Understatement im Umgang mit den Bediensteten seinen*ihren erhobenen Status.
Ich habe schon den König gespielt, mehr als ein Mal.
Ich bin sechzehn und brauche einen Nebenjob, also bewerbe ich mich als Bankettaushilfe in einem Fünfsternehotel in Hamburg. Mein Probetag ist eine Riesenfarce. Ich arbeite 16 Stunden durch, ohne Pause. Wenn wir das Essen der Hochzeitsgesellschaft abräumen, esse ich Übrig gebliebenes, so wie die anderen es tun. Nach sechs Stunden schaue ich auf der Toilette nach, was mit meinen Füssen ist. Mein bester Freund hat mir seine Anzugschuhe ausgeliehen. Nur hat er Schuhgrösse 43, während ich Schuhgrösse 45 trage. Ich ziehe meine Schuhe aus und erschrecke: Meine Füsse schwimmen im Blut, so etwas habe ich noch nie gesehen. Egal, ich muss durchziehen. Ich schlüpfe zurück in die nassen Socken und gehe zurück an die Arbeit.
In den nächsten Monaten erlebe ich den Wahnsinn, der in den Katakomben des Hotels Alltag ist. Ich sehe, wie ein Koch einen Teller nach einer Aushilfe schmeisst. Ich selbst werde jeden Tag mindestens einmal von jemandem angeschrien. Einmal, bei der Hochzeit eines Politikersohnes mit der Tochter eines chinesischen Industriellen sollen ich und ein halbes Dutzend anderer Aushilfen schon um 11 Uhr mit vollen Tablets auf der Terrasse des Hotels stehen. Die ersten Gäste werden aber erst um 12 Uhr erwartet. Es ist unerträglich heiss, schon um 12 Uhr schmerzen meine Arme.
Jedes Mal, wenn wir reichen Menschen begegnen, führt es uns dann nicht vor Augen, dass nicht Politiker*innen die Welt regieren, sondern dass es die Marktwirtschaft ist, die die Lebensbedingungen der Menschen diktiert?
Später stolpere ich mit einem Tablett über eine Stufe auf der Terrasse und ein paar Sektgläser ergiessen sich über genau den Gast, der mich vorher schon mehrfach gefragt hat, wo die Zigaretten bleiben, die er bei mir bestellt hat. Ich denke, dass er jetzt ausflippt. Vielleicht, weil der Mann in dem Moment meinen Stress sieht, vielleicht aus einem anderen Grund – jedenfalls reagiert der Mann entspannt, er sagt: Ist ja nur ein bisschen Flüssigkeit, das kann jedem passieren.”
Diesem Mann steht es beinahe frei, wie er sich mir gegenüber verhält, ihm gegenüber habe ich absoluten Unterstatus. Aber heute habe ich Glück, er ist gnädig mit mir. Kaum von der Terrasse werde ich von meinem Chef angefaucht, der nach der Veranstaltung vor meinen Augen einen fünfhundert Euroschein Trinkgeld einsteckt, von dem weder die anderen Aushilfen noch ich etwas abbekommen. Ich merke mir: Bankettaushilfen sind auf derselben gesellschaftlichen Ebene angesiedelt wie Hauselfen.
Arbeiten für den Wohlstand Anderer
Die Bedingungen, unter denen wir Aushilfen in dem Luxushotel arbeiten, stehen exemplarisch für ein Symptom des Reichtums. In „Superyachten. Luxus und Stille im Kapitalozän” beschreibt der Soziologe Grégory Salle die Arbeitsbedingungen der Angestellten auf den Yachten der Superreichen. Zeugen berichteten „von Druck in allen erdenklichen Formen, von der Wiederholung zermürbender Arbeiten bis hin zu sexueller Belästigung. Die Folgen sind Depressionen und sogar Suizide.”
Es ändern sich die Zeiten. Ich werde erwachsen, aber mein Verhältnis zur Welt bleibt dasselbe und auch die Not, meinen Körper als Leiharbeiter für den Mindestlohn zu Markte zu tragen, während mir ein Grossteil von dem Geld, das ich erwirtschafte, vorenthalten wird, ändert sich nicht. Die Momente in meinen Zwanzigern, in denen ich multijobbend oft nicht wusste, wie ich mit meinem Geld bis zum Monatsende durchkomme, wirken noch verzerrter, wenn ich mir vor Augen führe, welchen Lebensrealitäten ich in meiner Arbeit als Kellner ausgesetzt war, ohne es zu beabsichtigen.
Das Grundproblem, dass die Arbeit kaum zum Leben reicht und dass ich einen Grossteil meines Lohns erst gar nicht erhalte, weil er in den Taschen eines Chefs landet, dem wäre ich auch in Jobs ausgesetzt, in denen ich keinen Kontakt mit den Reichen habe. Aber umgeben zu sein von Macht und Reichtum, hat das Gefühl für meine niedere Position verstärkt. Und es hat für meinen Hass auf Reiche gesorgt. Einen Hass, den ich mir nicht über Seminartexte anlesen musste, der gewissermassen nie kryptisch blieb, denn die Wurzel des Hasses lag in meinem dysfunktionalen Alltag begründet. Sie war die Negativfolie des Reichtums, von dem ich in meiner Arbeitszeit umgeben war.
Manche Veränderungen gehen tatsächlich mit einer Entscheidung los; in diesem Fall lautet sie: Ich nehme Reichtum persönlich!
Jedes Mal, wenn wir reichen Menschen begegnen, führt es uns dann nicht vor Augen, dass nicht Politiker*innen die Welt regieren, sondern dass es die Marktwirtschaft ist, die die Lebensbedingungen der Menschen diktiert?
Lasst uns aufhören den*die König*in zu spielen, denn in einer Gesellschaft, die für alle gerecht sein soll, ist für König*innen nicht länger Platz. Um dieses Spiel zu stören, müssen wir uns auf das besinnen, was in uns gärt, wenn wir frühmorgens in überfüllten Bahnen zur Frühschicht aufbrechen, um unsere schlecht bezahlten Jobs anzutreten.
Wenn unsere Eltern uns raten, das Erbe auszuschlagen, weil wir sonst ihre Schulden erben würden.
Wenn wir uns krankmelden müssen, weil die Kita unser Kind aufgrund des Erzieher*innenmangels nicht betreuen kann.
Wenn wir erfahren, dass Gesetze von Lobbyist*innen geschrieben werden, und nicht von Politiker*innen.
Manche Veränderungen gehen tatsächlich mit einer Entscheidung los; in diesem Fall lautet sie: Ich nehme Reichtum persönlich!
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 12 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 884 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 420 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 204 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?