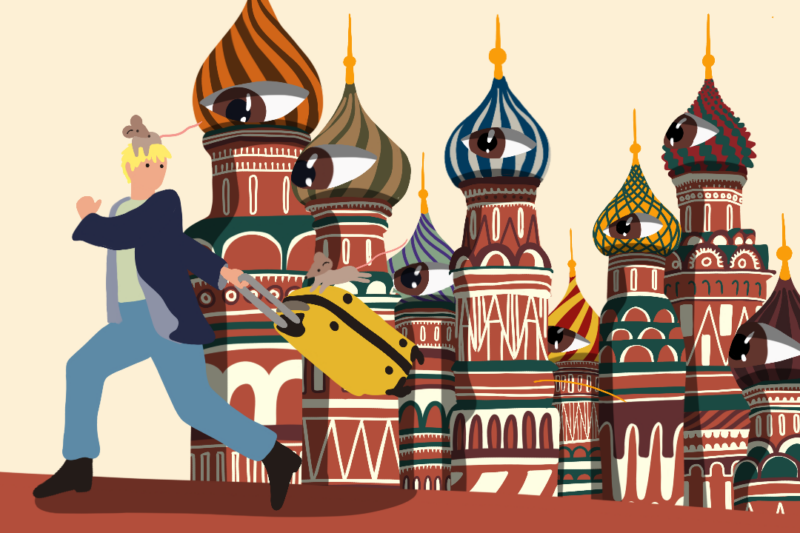Am 24. Februar 2022, als Präsident Putin eine „Spezialoperation” in der Ukraine ankündigt, öffnet Ekaterina Lawrentjewa, die eigentlich anders heisst, einen geheimen Telegram-Chat. Mittels sich selbst löschender Nachrichten warnt sie: “Ruf mich nicht an, Anrufe in Telegram sind nicht geschützt.” Dann schreibt sie: „Ich brauche Hilfe. Wie kann ich aus Russland fliehen?”
Ekaterina will Russland verlassen, aber nicht wegen politischer Verfolgung: Ihr Job als Lehrerin an einer öffentlichen Grundschule, ihr junger Sohn und ihre gesundheitlichen Probleme haben es ihr nie erlaubt, sich offen gegen Putins Herrschaft aufzulehnen. Zu sehr fürchtet sie um ihren Arbeitsplatz in der kleinen Provinzstadt und um das Sorgerecht für ihren Sohn. Ihr Ehemann, ein Bürger von Belarus, wurde in seiner Heimat bereits zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er im Jahr 2020 an den Protesten in Minsk teilgenommen hatte.
Keine Zukunft
Nach der Ankündigung des zweiten Sanktionspakets gegen Russland am 26. Februar 2022 schreibt mir Ekaterina: „Wir müssen uns auf eine Wiederholung dessen vorbereiten, was nach den Tschetschenienkriegen geschah: Bandit*innen auf den Strassen, wie in den 90er-Jahren. Eine schwere Wirtschaftskrise und den Eisernen Vorhang.” In der Schule, in der Ekaterina seit zehn Jahren unterrichtet, wurden die Lehrer*innen nach der letzten russischen Invasion in der Ukraine angewiesen, „patriotischen Unterricht” für die Kinder abzuhalten. Ekaterina will keine solche Zukunft für ihr Kind.
Ihr Sohn leidet an Schuppenflechte, sie selbst hat Diabetes. Anfang März 2022 leiht sie sich Geld von Freund*innen, um die Medikamente für ihre chronischen Erkrankungen auf Vorrat zu kaufen. Sie schreibt: „Ich habe 15 Apotheken und 8 andere Läden abgeklappert. Ich habe alle Medikamente gekauft, die ich für mich und meinen Sohn finden konnte.”
Aber schon bald werden bestimmte Medikamente in russischen Krankenhäusern und Apotheken knapp – wegen der Panik, aber auch wegen der sanktionsbedingten logistischen Lieferunterbrechungen. Nach einer Weile muss sich Ekaterina nach einem Ersatz für ihr Medikament umsehen. Humalog, ein Ersatz für menschliches Insulin, das sie seit Jahren einnimmt, findet sie nicht mehr. „Alternative Medikamente für meinen Sohn werde ich aber kaum finden”, schreibt sie und schlussfolgert: „Wir müssen irgendwohin, so schnell wie möglich.”
Nicht willkommen
Doch selbst die billigsten Flugtickets, um Russland zu verlassen, und die günstigsten Mietwohnungen in möglichen Zielländern erweisen sich für Ekaterina als zu teuer – besonders jetzt, wenn der Rubelkurs instabil ist. Ein Flugticket von Moskau in die armenische Hauptstadt Jerewan kostet rund 700 Dollar. Sie muss also erst sparen, für mehrere Monate.
In den folgenden Monaten diskutieren wir, wohin Ekaterina auswandern könnte. Sie war noch nie ausserhalb Russlands. Ein Tourist*innenvisum wird ihr und ihrem Sohn bereits im März verweigert – von Griechenland, das diese Visa normalerweise problemlos an Russ*innen ausgestellt hat. Es wurde zwar offiziell nicht so angekündigt, sagt Ekaterina, aber in der Praxis verweigern viele Länder Russ*innen die Visa.
Ekaterina will erneut einen Visumsantrag stellen, aber inzwischen hat sich die Lage in den meisten europäischen Ländern verschlechtert. Der ukrainische Präsident Zelensky sagt in einem Interview mit der Washington Post, dass Europa keine Russ*innen mehr einreisen lassen sollte. Und diejenigen, die bereits in Europa angekommen seien, sollten ausgewiesen werden. Er fordert Lettland, Litauen, Estland und die Tschechische Republik auf, die Ausstellung von Kurzzeitvisa für russische Staatsbürger*innen auszusetzen. In der Folge setzen die Länder die Erteilung dieser Visa an Russ*innen fast vollständig aus, Finnland verlangsamt kurze Zeit später die Visaerteilung.
Und politisches Asyl beantragen? Hierzu braucht man etliche Beweise, die eine Verfolgung durch den Staat, die Teilnahme an Protesten oder etwa die Zusammenarbeit mit verfolgten Menschenrechtsorganisationen bestätigen. Oder Dokumente, die Schädigungen infolge einer Verweigerung der medizinischen Versorgung von Patient*innen mit HIV und AIDS beweisen.
Obwohl Ekaterina das Regime vehement ablehnt und um die eigene medizinische Versorgung und die ihres Sohnes bangt: Sie ist eindeutig zu wenig bedroht und zu wenig krank, um überhaupt nur schon zu versuchen, in einem europäischen Land Schutz zu beanspruchen. Und das ironischerweise, weil sie sich in ihrer Heimat vor Repressionen schützen wollte.
Ekaterina und ihr Sohn besitzen neben der russischen auch die belarussische Staatsbürgerschaft, und eine zweite Staatsangehörigkeit stellt in vielen Fällen weitere Einreisemöglichkeiten in Aussicht. Doch Ihnen hilft diese Tatsache nicht, Russland zu verlassen. Denn nach dem mehrmonatigen Krieg verschlechtert sich die Situation bei der Ausstellung von Visa nicht nur für Russ*innen, sondern auch für belarussische Bürger*innen.
„Die Belaruss*innen, die 2020 verzweifelt gegen das Lukaschenka-Regime gekämpft haben, wurden genauso unerwünscht wie die Russen*innen”, erklärt Ekaterina. „Ich habe meinen Mann im Kampf gegen das Lukaschenka-Regime verloren, jetzt muss ich als alleinerziehende Mutter vor Putins Regime fliehen.” Ekaterina fasst ihre Gefühle über das Weggehen zusammen: „Ich fühle mich wie eine Persona non grata.”
Neubeginn
Als sie nach vier Monaten genug Geld gespart hat, kauft sich Ekaterina schliesslich zwei einfache Flugtickets nach Armenien und mietet ein Zimmer am Rande der Stadt Jerewan. Wie vielen Russ*innen gelingt ihr die Flucht in eines der Nachbarländer – denn in Armenien, Georgien oder Kasachstan sind die bürokratischen Anforderungen für die Einreise deutlich geringer als in den meisten europäischen Ländern. Mehr als 400’000 Menschen haben Russland in der ersten Hälfte des Jahres 2022 verlassen – doppelt so viele wie im Vorjahr. Es ist das erste Mal in der jüngeren Geschichte Russlands, dass das Land eine höhere Aus- als Einwanderung verzeichnet.
Obwohl Ekaterina mit ihrem Sohn in einem kleinen Zimmer in einer Wohnung mit vielen anderen Emigrant*innen aus Russland leben und nur gerade genug Geld für Lebensmittel und Medikamente haben, ist sie sehr froh, es nach Jerewan geschafft zu haben: „In Armenien sprechen mehr als 70 Prozent der Bevölkerung Russisch, die russische Sprache ist Pflichtfach in den armenischen Schulen. So wird es für mich und meinen Sohn einfacher sein, Kontakte zu knüpfen.”
Heute sucht Ekaterina in Armenien einen Job. Sie unterrichtet bereits Englisch und Deutsch als Privatlehrerin, aber sobald die Ersparnisse aufgebraucht sind, wird dieses Gehalt für ihr Leben in Jerewan nicht mehr ausreichen. Während ihrer Suche wird Ekaterina immer wieder mit Angeboten konfrontiert, in der Sexindustrie zu arbeiten. „Zuerst war ich furchtbar beleidigt. Aber ich verstehe, dass viele Frauen in den Bereich der Sexdienstleistungen einsteigen”, sagt sie und meint: „Es ist gut, dass ich Fremdsprachen beherrsche und einen Job in meinem Beruf finden kann.”
Ekaterina gibt zu, dass das Leben in Armenien manchmal sehr schwierig und einsam für sie ist. Dennoch sagt sie: „Ich werde mein Bestes tun, um weder nach Russland noch nach Belarus zurückkehren zu müssen. Solange die dortigen Regimes nicht gestürzt sind, haben weder ich noch mein Sohn eine Zukunft.”
Politisch aktiv
Anfang März 2022 schreibt Elias Drobineine, der seinen richtigen Namen nicht in der Presse lesen will, eine Reihe von Posts gegen die aggressive Aussenpolitik Russlands. Sie verbreiten sich schnell in den sozialen Medien. Gleichzeitig wird in Russland eine Reihe neuer Gesetze verabschiedet, die alles, was er postet, unter Strafe stellt. Es ist nun illegal, Russlands gross angelegten Krieg in der Ukraine überhaupt als „Krieg” zu bezeichnen.
Allein im Jahr 2021 hatte die Staatsanwaltschaft vier Strafverfahren gegen den LGBTQ+-Aktivisten aus Moskau eingeleitet – alle wegen Aktivismus, da er sich an den provokativen Aktionen der berühmten Gruppe Pussy Riot beteiligte. Allerdings wurden bereits zuvor Verfahren gegen ihn eröffnet. Die Chancen, dass Elias einen Freispruch erhält, sinken allmählich wegen der erneuten Verschärfung der Repression und der Einführung der Militärzensur.
„Ich habe schon lange darüber nachgedacht, Russland zu verlassen”, sagt Elias heute. Doch die finanzielle Situation, familiäre Probleme und der Wunsch, etwas in seinem Land zu verändern, hätten ihn davon abgehalten. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die zunehmenden Repressionen stellen ihn nun vor die Wahl: entweder ausreisen oder in absehbarer Zeit verhaftet werden.
Die Verschärfung der Gesetze, die Angriffe auf Journalist*innen und Menschenrechtsaktivist*innen oder die Kontrolle der Telefone von Passant*innen durch die Polizei in der U‑Bahn – all dies deutet darauf hin, dass Elias jederzeit verhaftet werden könnte. Vor seiner Abreise stellt er fest, dass er verfolgt wird. „Seit Kurzem steht ein Polizeiauto ständig vor meinem Haus. Ich versuche, das Haus erst zu verlassen, wenn das Auto weg ist”, schreibt er auf Telegram.
Eiserne Faust
Im März 2022 war einer von Elias’ Fällen aus dem Jahr 2018 noch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hängig. Mit dem Ausschluss Russlands aus dem Europarat am 16. März hat sich die Situation für ihn wie für viele andere Aktivist*innen in Russland nochmals verschlechtert. Er hat nun keine legalen Möglichkeiten mehr, Druck auf die Behörden auszuüben, indem er an ein internationales Gericht appelliert.
Zur gleichen Zeit, sagt Elias, gab es das erste Gerücht, dass die militärische Mobilisierung ausgeweitet würde. Elias war bis anhin vom Militärdienst ausgenommen, weil er ein trans Mann ist. Aber diese Ausnahme ist nicht in Stein gemeisselt: Wenn die Reserven aufgebraucht sind, werden alle mobilisiert – auch trans Menschen. „Erst wusste ich nicht, was ich tun sollte”, sagt Elias. „Dann haben meine Frau und ich uns hingesetzt, nachgedacht und beschlossen, zu gehen.”
Doch die Zeit bis zur Abreise dauert. Sie müssen zunächst die notwendigen Dokumente beschaffen – nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Hausratten, die sie nicht zurücklassen wollen. Zu dieser Zeit erhalte ich eine Nachricht: „Heute Morgen hörte ich im Halbschlaf unsere Türklingel. Ich dachte, dass ich träume. Später sagte mein Nachbar, dass es kein Traum war – vor der Türe haben Polizisten gewartet.”
Ich schlage Elias vor, sich an Menschenrechtsorganisationen in Europa zu wenden. Daraufhin antwortet er: „Das werden wir später brauchen. Vor dem Flughafen werden wir so oder so alle Nachrichten löschen, damit es keine Probleme mit den russischen Grenzbeamt*innen gibt.” Schliesslich gelingt ihnen die Ausreise nach Georgien, ohne dass sie von den russischen Grenzbehörden verhört werden.
Zum ersten Mal im Leben sicher
Fast unmittelbar nach seiner Ankunft in Georgien beginnt Elias, Fotos von der Pride in Tiflis auf Instagram zu posten. Im Vorfeld wurde die Durchführung des LGBTQ+-Marsches wegen etlicher homophober Reaktionen und der Gefahr möglicher Angriffe von georgischen Rechtsradikalen zwar infrage gestellt, aber Elias berichtet: „Ich kann es kaum glauben. Hier werde ich von der Polizei beschützt, in Russland musste ich mich vor der Polizei schützen. Ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben sicher.”
Dennoch erweist sich das Leben in Georgien für Elias’ Familie als schwierig. Aufgrund des Zustroms von Emigrant*innen aus Russland nach Georgien ist alles teurer geworden – die georgische Regierung schätzt, dass seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 mehr als 30’000 russische Staatsangehörige nach Georgien gekommen sind. Obwohl Elias ein Zusatzeinkommen aus der Untermiete seiner Wohnung in Moskau hat und seine Frau als Freelancerin weiterarbeitet, sei ihr Kühlschrank oft leer.
Zumindest vermisst Elias Russland nicht: „Ich habe keinen Grund, zurückzugehen.” Obwohl in Georgien Graffiti mit der Aufschrift „Russen geht nach Hause” an den Wänden zu sehen sind und es Fälle von Russophobie gibt, sind weder Elias noch seine Frau persönlich damit konfrontiert worden. Trotzdem planen sie, Georgien zu verlassen – nicht nach Europa, sondern in die USA. Sie wollen die US-Grenze von Mexiko aus überqueren und politisches Asyl beantragen. „Politische Emigrant*innen aus Russland werden dort mit mehr Herzlichkeit behandelt als in Europa”, meint Elias.
Am 21. September 2022 kündigte Wladimir Putin eine Teilmobilisierung der militärischen Reserven zur Verstärkung seiner Truppen in der Ukraine an. Viele Russ*innen versuchten daraufhin One-Way-Flugtickets zu kaufen, um das Land zu verlassen. Die Preise für Flüge in der Economy Class sind in manchen Fällen auf mehr als 9’000 Dollar angestiegen.
Liza Shishko ist russisch-ukrainische Journalistin und Bloggerin. Sie lebt seit vier Jahren in Nordsyrien, von wo aus sie für unabhängige russische, ukrainische, sowie italienische Medien schreibt.
Dieser Artikel wurde von Maria-Theres Schuler vom Englischen ins Deutsche übersetzt.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 54 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 3068 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1890 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 918 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?