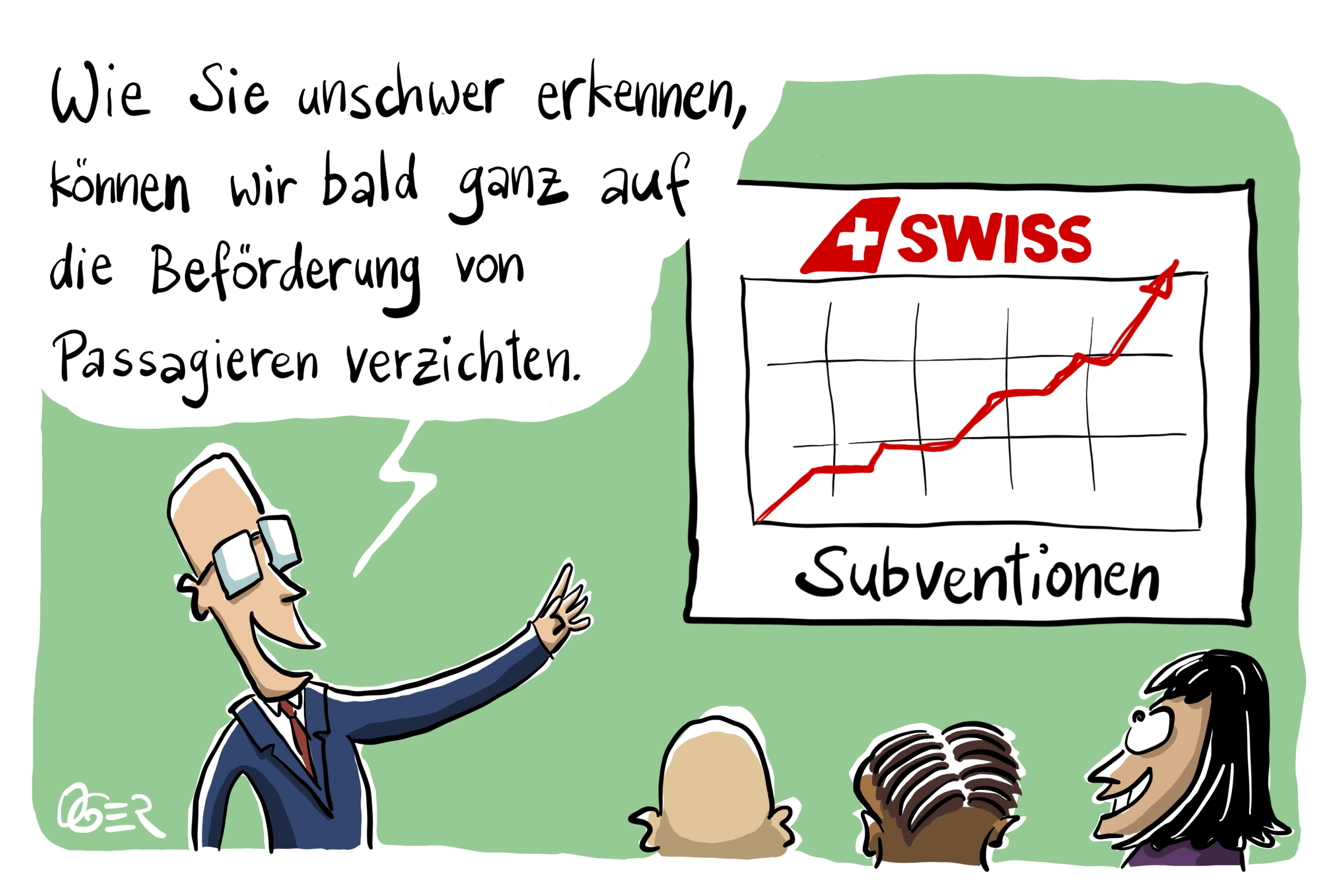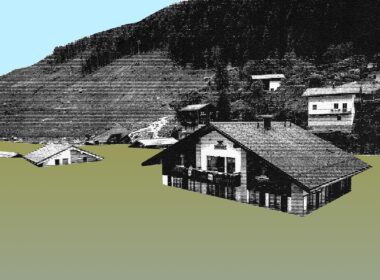Das Sterben der Dinosaurier hatte etwas Entlastendes. Sie waren unvorstellbar gross, stark, gefährlich. Sie hatten den Planeten fest im Griff respektive im Gebiss – bis sie ihr Armageddon hatten, weil kein Bruce Willis da war, der ihnen den todbringenden Meteoriten rechtzeitig mit einer Atombombe wegsprengte. Chicxclub hiess der Klumpen aus dem All, der, als er bei Yucatan einschlug, nicht nur einen gigantischen Tsunami, diverse Erdbeben und Vulkanausbrüche auslöste, sondern auch noch so viel Staub aufwirbelte, dass es für ein paar Jahre dunkel wurde. Erst hatte Brontosaurus nichts mehr zu fressen, dann Tyrannosaurus, und dann war es mit ihnen zu Ende.
Die Einschlaghypothese mit der anschliessenden Apokalypse war bis zum Ende des Kalten Kriegs so wirkmächtig wie zeitgemäss, dass man kurzerhand für alle früheren Massensterben der Erdgeschichte nach einem Todesbringer aus dem Weltall suchte. Massensterben ohne Feuerball, Explosion und Staubwolke (oder Atompilz): Das war damals nur schwer vorstellbar. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten hat man die Suche nach Einschlaglöchern eingestellt und neue Killer ins Auge gefasst. Auch diesmal sollten sie zeitgemäss sein.
Wie der Paläontologe Peter Ward dem New York Magazine mitteilte, mussten er und seine Mitforschenden für das, was sie in ihrer Arbeit fanden, einen neuen Begriff schmieden: „greenhouse extinctions“. Für den Tod der Dinosaurier gilt zwar trotz neuem Killerprofil weiterhin Chicxclub als verantwortlich. Aber bei den restlichen vier der fünf grössten Massensterben in der Geschichte des Lebens auf unserem Planeten sind Klimawandel die Hauptverdächtigen – so etwa beim grössten Massensterben auf Erden am Übergang von Perm zu Trias, bei dem 95% aller Meeresarten eliminiert wurden. Wie das ohne British Petroleum und Grundschleppnetze ging?
Paläolithische Ölförderung
In Sibirien brachen vor 252 Millionen Jahren Vulkane aus dem Boden und gossen glühendes Gestein über eine Fläche von der Grösse Europas. Das kleine Massensterben in den Lavafluten war aber nur das Vorspiel. Das grosse Sterben begann erst, als dieselben Vulkane ihr flüssiges Gestein statt auf die Erdoberfläche unterirdisch in das Tunguska-Becken entliessen – eine Lagerstätte von kohlenstoffhaltigen Fossilien. Die Magma kochte das Gebein zu CO2 und schleudert es über riesige Krater in die Atmosphäre. In der Folge stieg die Temperatur um 9°C. Die Ozeane versauerten, wodurch die meisten Schalentiere aufgelöst wurden wie Knochen in einer Cola. Und wer nicht aufgelöst wurde, der erstickte, weil der Sauerstoff über das warme Oberflächenwasser nicht mehr ins Meer eindringen konnte. Den faulenden Gewässern entwich in der Folge hochgiftiger Schwefelwasserstoff. Dieser gab den Landlebewesen, die bereits unter dem Ozonloch brieten, das die Vulkane in die Atmosphäre gerissen hatten, den Rest. Die Bilanz: 95 Prozent der Meeres- und 75 Prozent der Landarten waren ausgerottet.
Auch wenn unsere Vorräte an fossilen Brennstoffen wohl nicht hinreichen werden, um es mit den sibirischen Vulkanen von damals aufzunehmen, so sind die Parallelen zu heute doch erschreckend. Auch wir bohren in fossilen Lagerstätten, um den Kohlenstoff nach Verbrauch als CO2 in die Atmosphäre zu entlassen. Unsere Ozeane versauern, und es bilden sich (allerdings vorerst nur wegen der Überdüngung) sauerstofffreie Zonen aus. Vor allem der in der jüngeren Erdgeschichte ungekannt rapide Anstieg der CO2-Konzentration hat einige ForscherInnen dazu bewogen, unsere gegenwärtige Lage eher mit der Perm-Trias-Extinktion zu vergleichen als mit sanfteren Klimawandeln.
Wir schaffen es auch ohne Klimawandel
Obwohl er seine ganze Wucht erst in ein paar hundert Jahren entfaltet haben wird, macht der aktuelle Klimawandel den Lebewesen schon heute zu schaffen. Man hat beobachtet, dass rund 50 Prozent aller Arten daran sind, ihren Lebensstandort zu wechseln. So zum Beispiel die Seegurke centrostephanus rodgersii. Weil es ihr an der australischen Küste zu warm wurde, ist sie gegen Tasmanien aufgebrochen, wo es ihr in den frisch aufgewärmten Gewässern nun gut gefällt. Zu gut, denn sie hat die dortigen Kelp-Unterwasserwälder in kürzester Zeit ganz für sich eingenommen und anderen Spezies den Platz weggenommen.
Allerdings – und das verleiht dem sechsten Artenniedergang seine ganz eigene Note – hätte sich die Seegurke nicht so breitmachen können, wenn der Hummer nicht überfischt und damit ein wichtiger Feind der Seegurke so stark dezimiert worden wäre. Deshalb warnte die Biologin Camilla Parmesan in der Fachzeitschrift Nature Communications davor, alles Aus- und Wegsterben alleine über den Kamm der Klimaerwärmung scheren zu wollen, wo in Wahrheit viele weitere Ursachen am Werk sind.
Was im Meer die Überfischung, ist an Land die ‚Landnutzungsänderung‘, d. h. das Urbarmachen von Land zu Zwecken unserer industrialisierten Lebensweise. Wie der Insektenspezialist Terry Erwin 1982 feststellte, leben an einem Baum im Regenwald Panamas 1‘200 verschiedene Insektenarten, wovon mehr als 100 nur an diesem einen Baum aufgefunden wurden. Holzt man einen solchen Wald ab, um an seine Stelle eine Bananenplantage zu pflanzen, dann hat man vermutlich tausende von Insektenspezies ausgerottet, ohne sie je identifiziert zu haben.
Aussterben, ohne je gekannt worden zu sein: Ein solches Schicksal erwartet gemäss einer Guardian-Recherche zehntausende von Insektenarten. Um eine einzelne Mottenart wie neopalpa donaldtrumpii wär es nicht allzu schade, global betrachtet muss man aber, so der Guardian, von einem ‚Insectageddon‘ sprechen. Eine ForscherInnengruppe hat jüngst festgestellt, dass die Biomasse der fliegenden Insekten in deutschen Naturschutzgebieten zwischen 1989 und 2016 um mehr als 75 Prozent eingebrochen ist. Da sich weder die Habitate um die Messstellen noch das lokale Klima verändert haben, vermuten sie, dass die Insekten von den nahegelegenen Äckern und Feldern „aufgezehrt” wurden. Intensiviertes Düngen und Pflügen hat die Biodiversität auf den Äckern und damit den Lebensraum von Insekten drastisch verringert, und der Einsatz von persistenten Insektiziden hat wohl auch das Seine zur Dezimierung nicht nur der Bienen, sondern aller Insekten beigetragen.
Warum wir an unseren Krabbeltieren hängen sollten wie am süssen Panda und am stolzen Eisbären? Ohne Insekten und andere Arthropoden hätten wir nur noch ein paar Monate zu leben, schätzt Edward Wilson von der Harvard University. Nachdem es uns dahingerafft hätte, verwandelte sich die Erdoberfläche in einen riesigen Komposthaufen, der mehr schlecht als recht vor sich hingammelte. Die Pilze hätten ein intensives, aber kurzes Festmahl, und danach würde die Entwicklung des Lebens um 440 Millionen Jahre rückgängig gemacht. Ein paar Schwämme und Moose würden das kahle Land überziehen und darauf warten, dass sich die ersten Crevetten an Land wagten. Gesetzt, es wären in den leergefischten Meeren noch welche übrig.
Bruce Willis fährt Rad und gräbt nach Zwiebeln
Der Klimawandel dürfte auf lange Dauer die Artenvielfalt und dann uns niederstrecken, aber wir greifen ihm zurzeit ordentlich unter die Arme. Alleine mit der intensiven und pestizidlastigen Landwirtschaft und der Plünderung der Weltmeere könnten wir unser kurzes Dasein auf Erden vorzeitig beenden, wie der Guardian warnt. Unser Armageddon schwebt derzeit nicht als Steinklumpen über uns im All, sondern wir haben unsere mögliche Vernichtung selbst geschmiedet. Wie können wir unser Damoklesschwert wieder runterholen?
Die Lösung ist wenig überraschend, und doch nicht leicht zu bewerkstelligen. Der Pestizideinsatz muss massiv gedrosselt, die Monokultur-Landwirtschaft aufgegeben und die Tierhaltung, mit Ausnahme extensiver Wiesenhaltung, drastisch zurückgefahren werden. Dass schwimmende Fischfabriken und Grundnetzschlepper verbannt gehören, versteht sich von selbst.
Entlastend ist der neue Befund zum sechsten Massensterben also nicht. Statt Meteoriten mit Kurs auf unseren Planeten mit Atombomben zu pulverisieren, muss man reife Zwiebeln zwischen Rüebli hervorklauben, damit letztere noch ein bisschen dicker werden können. Doch nicht nur deswegen hätte Bruce Willis die neue Rolle abgelehnt. Denn wenn so viele zum Mitmachen aufgerufen sind, gibt es auch keine HeldInnen mehr. Und das ist vielleicht die grösste Herausforderung.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 28 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1716 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 980 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 476 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?