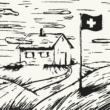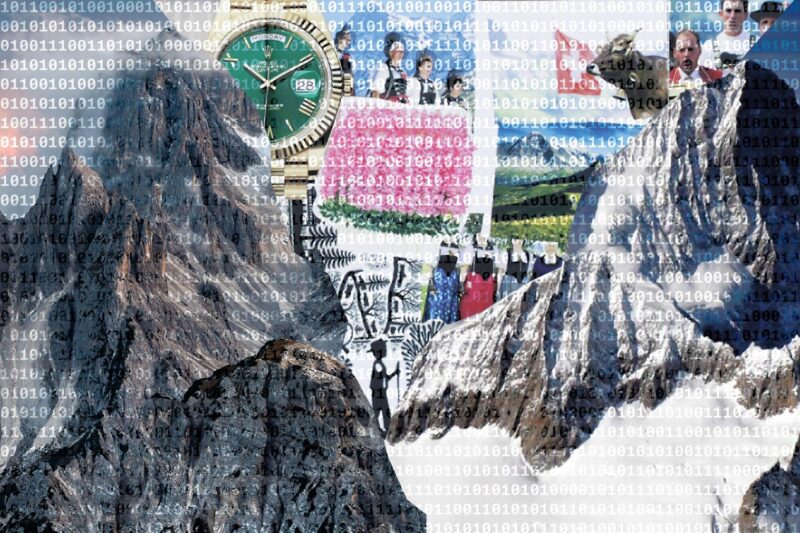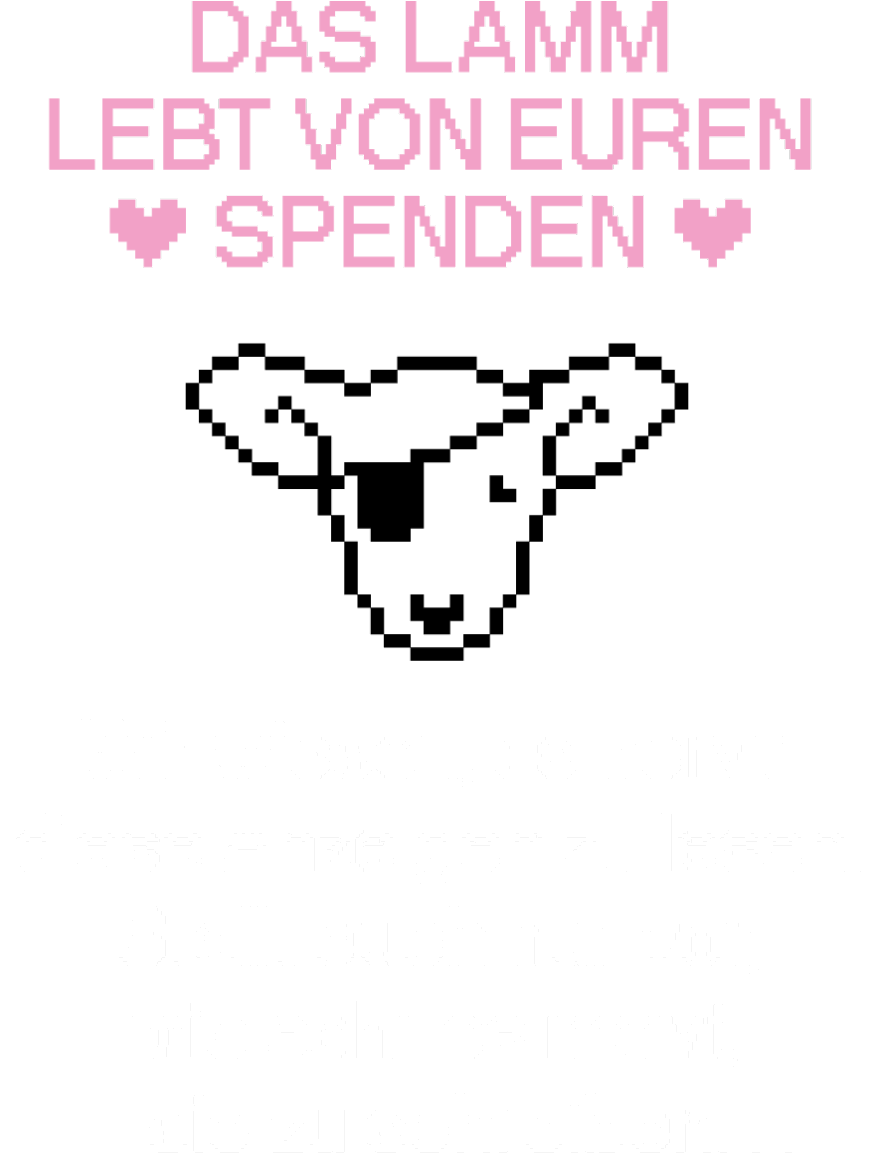Ach, die Schweiz und ihre vielen Mythen! Von Heidi bis zu Wilhelm Tell definieren sie das Image der Schweiz sowohl im Inneren als auch nach aussen. Dank dem seit 2017 aufgeweichten Bankgeheimnis und der vermeintlich neutralen Haltung in Kriegssituationen gilt die Schweiz seit jeher als besonders sicher und ist bei Reichen und Mächtigen ein beliebter Zufluchtsort; sowohl in Spionagethrillern als auch in der echten Welt.
Es ist daher auch nicht wirklich erstaunlich, dass viele Schweizer Techfirmen von dem sicheren Image der Schweiz für ihr Marketing Gebrauch machen. Firmen wie Proton (vormals Protonmail) und Threema, die mit ihren Produkten Sicherheit und Privatsphäre versprechen, werben schon seit ewig mit ihrer Swissness. Auf der Startseite preist Proton seine „Swiss Privacy” an und proklamiert, dass die Firma ein „neutraler und sicherer Hafen” für personenbezogene Daten sei. Der weiterführende Artikel zu den Schweizer Datenschutzgesetzen existiert nur auf Englisch.
Die politische Dimension des Digitalen ist so gross wie das Netz selbst. Mit einem Mix aus Expertise, Spass und sehr viel Wut auf das System schreibt maia arson crimew über Technologie, Überwachung, Internetkultur und Science Fiction – oder was ihr im digitalen Raum sonst gerade zwischen die Finger gerät. In ihrer Kolumne cyber_punk nimmt sie uns mit in die Untiefen des Internets und zeigt, wie die physische mit der digitalen Welt zusammenhängt.
maia arson crimew ist eine Luzerner Hacktivistin und investigative Journalistin. Auf ihrem Blog publiziert sie Recherchen über die verschiedenen Auswüchse des Überwachungskapitalismus und ist nebenbei als DJ unterwegs.
Vieles was in dem Artikel erwähnt wird, stimmt grundsätzlich: Proton ist in der Schweiz zumindest theoretisch ausser Reichweite von US- und EU-Gesetzen. Die Schweiz ist nicht Teil der NATO oder den Five, Nine und Fourteen Eyes Überwachungsverträgen und in diesem Sinne neutral. Ausserdem gilt laut der Schweizer Verfassung ein Recht auf Privatsphäre. Der Artikel führt weiter aus, dass es Proton verboten sei, Fremdstaaten mit Überwachung zu helfen – ausser die Schweizer Justiz zwinge sie in einem Rechtshilfeverfahren dazu. Der Artikel, zuletzt zu Beginn dieses Jahres aktualisiert, hält dies aber für unwahrscheinlich.
Tatsache ist, dass die Schweizer Bevölkerung digitaler Massenüberwachung ausgesetzt ist.
Doch das ist erwiesenermassen falsch: 2021 hat Proton im Auftrag der französischen und Schweizer Behörden die IP-Adresse eines E‑Mail-Accounts französischer Klimaaktivist*innen aufgezeichnet und diese via Schweizer Behörden an den französischen Staat weitergegeben. In einem Blogpost zum Vorfall sagt Proton-CEO Andy Yen dazu nicht viel mehr, als dass Proton Schweizer Gesetze natürlich nicht einfach so ignorieren könne – die Firma aber keine Möglichkeit gehabt hätte, diesen Entscheid anzufechten.
Das ist natürlich wahr und ich erwarte auch nicht, dass ein Privatunternehmen solche Gesetze ignorieren würde. Trotzdem zeigt die Situation klar, wie bedeutungslos und irreführend das Marketing um die Schweiz als Datenschutzparadies schlussendlich ist – sowohl im In- als auch im Ausland.
Unsere Daten sind auch in der Schweiz nicht sicher
Tatsache ist, dass die Schweizer Bevölkerung digitaler Massenüberwachung ausgesetzt ist. Alle Daten von Post‑, Telefon- und Internetanbietern werden auf Vorrat gespeichert, und unverschlüsselte Telekommunikation aus der Schweiz kann vom Nachrichtendienst stichprobenartig durchsucht werden. Mit der Durchsetzung des Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT), das in 2021 von der Bevölkerung angenommen wurde, können bei reinem Verdacht auf eine zukünftige Gefahr staatliche Überwachung oder Massnahmen angeordnet werden.
Zwar sind Instant-Messenger- und E‑Mail-Anbieter inzwischen nicht mehr an die Vorratsdatenspeicherung gebunden, was die Schweiz möglicherweise als Datenstandort für Nicht-Schweizer*innen attraktiver macht, doch bleibt die Schweiz weiterhin eher ein Überwachungsstaat als eine Vorreiterin im Datenschutz.
Das ganze Problem zeichnet sich auch darin ab, dass Schweizer Firmen viel zu oft keinen Plan haben, wie sie mit Datenlecks umgehen können – als ob sie erwarten würden, dass ihnen so was in der Schweiz nicht passieren könnte. Privatunternehmen, Unis oder Behörden werden gehackt und sind dann verdutzt, beschuldigen andere und werden von einem grossen Medienzirkus begleitet – oder sie tun einfach so, als wäre nichts passiert.
Daten, die gar nicht erst existieren, können auch nicht missbraucht werden.
Ein Beispiel dafür ist, dass Xplain, Softwarelieferant für die Fedpol und den Zoll, vor ein paar Monaten gehackt und erpresst wurde: Zwar haben Medien viel über den brisanten Vorfall berichtet und die geleakten Daten für Recherchen verwendet. FDP-Politiker Thierry Burkhart hat gar die Chance ergriffen, die Berichterstattung über den Cyberangriff als Argument zu verwenden, Journalismus zu verbieten, der auf nicht-öffentlichen Daten basiert. Aber die Krux an der Sache ist ja, dass Xplain datenschutzrechtlich gesehen die meisten dieser Daten gar nicht erst hätte haben dürfen – oder zumindest nicht mehr.
Datenlecks werden immer passieren. Ganz verhindern kann man sie auch bei allen Vorsichtsmassnahmen nicht. Aber Daten, die gar nicht erst existieren, können auch nicht missbraucht werden. Wenn der Bund und Xplain das Schweizer Datenschutzgesetz also eingehalten hätten, hätten die Daten auch nicht geleaked werden können.
Verantwortung abgeschoben
Ein weiteres Beispiel für den unfähigen und fahrlässigen Umgang mit Datensicherheit fand diesen Oktober statt: One Log, der vereinheitlichte Login- und Werbedienst der Schweizer Medienlandschaft, wurde gehackt und sämtliche Nutzerdaten gelöscht. Wirklich dazu informiert wurden die zwei Millionen Leser*innen darüber aber nicht – und die meisten Schweizer Medienhäuser haben über den Vorfall schlicht nicht berichtet. Die Journalistin Adrienne Fichter bezeichnet den One-Log-Vorfall in der Republik zurecht als „wenig vertrauensfördernd”.
Die Schweiz gilt als ultra sichere Festung und Datenschutz-Vorzeigebeispiel. Wenn aber etwas schiefläuft oder Daten heimlich an andere Staaten weitergegeben werden, weisen Firmen, Medien und die offizielle Schweiz die Verantwortung von sich.
Schlussendlich ist doch genau das die wahre Schweizer Tradition – nicht die Neutralität oder die Sicherheit – sondern die Fähigkeit, immer als die Guten dazustehen. Egal was passiert, nie schuldig, nie verantwortlich zu sein – und ganz sicher nichts falsch gemacht zu haben.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 12 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 884 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 420 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 204 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?