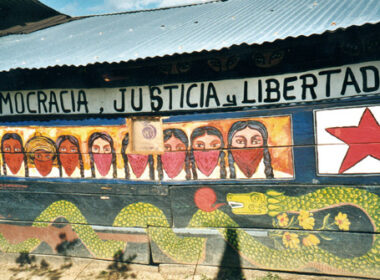Nur wenig rührt uns so fest wie die Bilder von gequälten oder leidenden Tieren (ausser vielleicht brennende gotische Kathedralen). Nicht verwunderlich also, ist ein angekokelter, auf den Hinterbeinen stehender und abgekämpfter Ameisenbär momentan sinnbildlich für die Feuerhölle im Amazonasgebiet.
Die globale Aufmerksamkeit für den Brand ist mittlerweile gross, die Mitleidsbekundungen und Gebete zahlreich. Auch wenn #PrayforAmazon wohl nur mittelmässig hilfreich sein dürfte, so verdeutlicht die grosse Social-Media-Solidarität immerhin: Das Thema ist angekommen. Und wenn es einen Hashtag zu einem Thema gibt, geht es nicht lange, bis es auch auf der ganz grossen politischen Bühne diskutiert wird.
Zum Ende des G7-Gipfels im französischen Biarritz haben sich die anwesenden Staaten unter der Leitung von Emmanuel Macron auf eine finanzielle Unterstützung zur Brandbekämpfung im brasilianischen Teil des Amazonasgebietes geeinigt. Doch noch bevor aufgeatmet werden konnte, sagte Brasiliens faschistischer Präsident Jair Bolsonaro „não!” – nein. Die finanzielle Unterstützung der westlichen Geldgeberinnen wolle er nicht, denn diese sei kolonialistisch und ein Schlag ins souveräne Gesicht Brasiliens. Viel lieber, so Bolsonaro, sollten sich die G7-Staaten um den Umweltschutz auf den eigenen Kontinenten kümmern und etwa die Wälder in Europa wieder aufforsten, als die südliche Hemisphäre weiter zu bevormunden.
Das Entsetzen war gross. Das Unverständnis noch grösser. Bolsonaro doppelte nach und sagte, man werde die Hilfe eventuell annehmen – aber zuerst müsse sich Macron für dessen überhebliche Art persönlich bei ihm entschuldigen. Wäre die Szene nicht so tragisch machoid und pubertär, wäre sie saulustig.
Doch Bolsonaro kann nicht darüber lachen. Der Präsident Brasiliens, das den grössten Teil des Amazonasgebiets beheimatet und nicht Teil der G7 ist, fühlte sich von den G7-Staaten zur „Kolonie” degradiert, wie er über Twitter verlauten liess. Er fühle sich in der Debatte um die Brände des Amazonas übergangen. Es werde über seinen Kopf hinweg entschieden.

Von US-Präsident Donald Trump erhielt Bolsonaro derweil Unterstützung. Bolsonaro leiste „einen grossartigen Job für das brasilianische Volk – nicht leicht”, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter, und zog wohl seine ganz eigenen Schlüsse aus dem Bubenzank zwischen Bolsonaro und Macron: Der US-Präsident liess Ende August verlauten, er erwäge, das Rodungsverbot für den Regenwald Alaskas aufzuheben.
Wenigstens die Nashörner können aufatmen
Szenenwechsel: Vor einigen Tagen ging in Genf die internationale Artenschutzkonferenz – genauer: die „Konferenz zum Handel mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten” – zu Ende. An der alle drei Jahre stattfindenden Konferenz wird jeweils neu ausgehandelt, welche Arten besseren Schutz brauchen und wo Handelsverbote gelockert werden können. Diskutiert wurde in diesem Jahr unter anderem über einen Antrag des kleinen und mausarmen Königreichs Eswatini (vormals Swasiland). Eswatini forderte, die Restbestände der Nashornhörner, welche in Lagerhallen aufbewahrt werden, verkaufen zu dürfen.
Für Nashornhorn gilt seit rund 40 Jahren ein weltweites Handelsverbot. Der Antrag wurde deutlich abgeschmettert. Für Eswatini ist der Beschluss eine grosse Niederlage, wäre mit dem ‚Resteausverkauf’ doch ein globaler Markt zu bedienen und somit etwas Geld in die Staatskassen zu spülen möglich gewesen.
Expert*innen fürchten sich jedoch davor, dass ein solcher ‚Ausnahmebeschluss’ die Nachfrage deutlich erhöhen und somit auch den Schwarzmarkt und Wilderei wiederum befeuern würde.
Es ist also kompliziert. Das Argument der Expert*innen ist sicherlich gerechtfertigt. Aber der Beschluss ist dennoch ein gutes Beispiel für die Kontrolle, die wirtschaftlich starke Länder über das Schicksal von kleineren und wirtschaftlich schwächeren Staaten ausüben. Was wiederum eng mit der anhaltende Ausbeutung der Länder des globalen Südens durch den Westen – und damit mit kolonialem Erbe verknüpft ist.
Hat einer wie Bolsonaro also doch recht, wenn er sagt, die Staaten des globalen Nordens, des Westens und der Sonnenseite des globalen Kapitalismus sollten sich zurücknehmen mit Empfehlungen für Arten- und Klimaschutz? Vielleicht. Aber es ist eben kompliziert.
Auf der einen Seite ist da, wie ein Damoklesschwert über allen Volkswirtschaften, die wichtigste Prämisse des globalen Kapitalismus: Wachstum. Mit Handel und der Einbindung möglichst aller Staaten in dieses System, so das Argument, werde deren Entwicklung gefördert. Und Entwicklung wird erwartet. Auch oder besonders von den Ländern des globalen Südens, den sogenannten Entwicklungs- (Eswatini) oder Schwellenländern (Brasilien).
Wenn Länder wie Eswatini versuchen, mit den wenigen Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, sich am internationalen Warenhandel zu beteiligen, werden sie von der besorgten Weltgemeinschaft zurückgepfiffen, da die zu handelnde Ware ethisch nicht vertreten werden will. Souveräne Staaten zerstören die ‚eigene’ Umwelt, roden die ‚eigenen’ Wälder und töten die einheimischen Tiere, um schlussendlich auf dem globalen Weltmarkt Gewinne zu erzielen oder Jobs zu sichern, die aufgrund des globalen Tieflohn- und Konkurrenzwettlaufs unter Druck geraten.
Was national zerstört oder nicht geschützt wird, hat jedoch global verheerende Folgen, die ‚uns alle’ betreffen. Und somit werden die souveränen Staaten von internationalen Organisationen zur Raison gemahnt, finanziell unterstützt oder mit Sanktionen belegt – was den souveränen Staaten wiederum als Einmischung in innere Angelegenheiten oder kolonialistisches Getue sauer aufstösst.
Kurz: Wenn Macron das Amazonasgebiet als „Gemeingut” bezeichnet, hat er recht. Wenn Bolsonaro aber sagt, das sei eine Eimischung in seinen staatlichen Souverän, hat er eben auch recht. Genauso wie auch Eswatini, das nicht versteht, was falsch daran sein sollte, mit dem ‚Resteausverkauf’ an Nashornhorn etwas in die Staatskassen zu spülen.
Hunderttausende von Menschen in Eswatini sind auf das Welternährungsprogramm der UN angewiesen. Die kleine Monarchie liegt ökonomisch am Boden, und auch der Handel mit Nashornhorn würde dem Land nicht nachhaltig helfen. Aber solange dieses unglaubliche Wohlstandsgefälle bestehen bleibt, wird das Land versucht bleiben, aus seinen Naturschätzen Kapital zu schlagen. Verständlicherweise.
Umweltschutz lässt sich nicht unabhängig von ökonomischen Fragen betrachten. Es ist kein Zufall, dass der Schutz bedrohter Tierarten einzig und allein über die Regulierung des Handels definiert wird.

Eine hämische Summe
Wenn die Klimajugend „System Change not Climate Change” skandiert, dann wird sie dafür verlacht. Aber wer denkt, dass zwischen gebeutelten Ländern des globalen Südens, immensen Wohlstandsgefällen und dem fortschreitenden Untergang unserer Umwelt kein Zusammenhang besteht, ist schlichtweg naiv.
Jair Bolsonaro liess vergangene Woche verlauten, ein 60 Tage währendes Brandrodungsverbot für den brasilianischen Teil des Amazonasregenwaldes zu verhängen. Die von den G7 an Brasilien angebotene Soforthilfe – Bolsonaro foutiert sich weiterhin um deren Annahme – beträgt übrigens 18 Millionen Euro. Der diesjährige G7-Gipfel in Biarritz kostete gemäss Schätzungen 36,4 Millionen Euro. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigt sich sehr stolz auf diesen Betrag. Schliesslich sei das rund elf Mal weniger, als der letzte G7-Gipfel in Kanada gekostet habe.
Das BIP pro Kopf im Königreich Eswatini beträgt 3’224.39 USD. Dasjenige Frankreichs 38’476.66 USD und dasjenige der Schweiz 80’189.70 USD.
Natürlich ist dieser Zahlenvergleich zynisch. Eine Umwelt- und Artenschutzpolitik, wie sie derzeit auf internationaler Bühne betrieben wird, ist es aber auch.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 11 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 832 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 385 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 187 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?