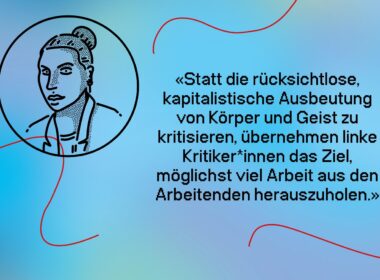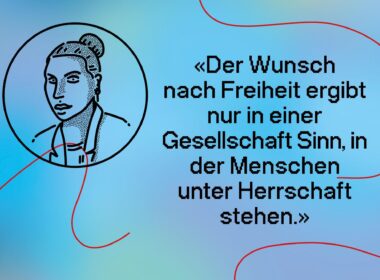Wie an den zahlreichen Plakaten mit lachenden Gesichtern auf roten, blauen und grünen Hintergründen nur unschwer zu erkennen ist, stehen bald wieder nationale Wahlen an. Das heisst auch, dass die „Frauenwahl” – und „Klimawahl” – schon vier Jahre her ist. So werden die nationalen Wahlen 2019 jedenfalls genannt.
Faktisch stieg der Frauenanteil im Nationalrat auf 42 Prozent, also um 10 Prozent im Vergleich zu 2015. Im Ständerat stieg der Anteil von 15 auf 26 Prozent. Das höchste Ergebnis nach knapp fünfzig Jahren Frauenstimmrecht. So überragend finde ich das jetzt nicht. Aber Fortschritt geschieht ja bekanntlich langsam.
Nach zwei Jahren Pandemie und ohne den mobilisierenden Effekt des grossen feministischen Streikes 2019 frage ich mich, ob der Anteil an statistisch als Frauen erfassten Personen wieder einmal stagnieren wird. „Das darf nicht passieren!”, schreit es in meinem Kopf. Oder?
Gemäss der Politologin Isabelle Stadelmann prägt die Parteizugehörigkeit das Abstimmungsverhalten im Parlament nämlich viel stärker als das Geschlecht. Dennoch ist für Stadelmann klar, dass „eine gute Demokratie dafür sorgen soll, dass die gesellschaftlichen Gruppen ihrer Grösse entsprechend im Parlament vertreten sind”.
Und das ist in der Schweiz definitiv nicht der Fall.
Lohnungleichheit, unbezahlte Care-Arbeit, sexualisierte Gewalt, aber auch der Kampf gegen toxische Maskulinität, die Abschaffung der Wehrpflicht und homosoziale Gewalt sind feministische Themen – und werden als „Frauensache“ abgestempelt. Dadurch werden diese Themen einerseits abgewertet, andererseits die Verantwortung für die Lösung dieser Probleme auf FINTA (Frauen, inter, non-binäre, trans und agender Personen) übertragen.
Das ist nicht nur unlogisch, sondern auch unnütz: Die Ursache des Problems liegt nicht auf der Betroffenen, sondern auf der Täterseite. Es sind eben Männersachen. Deshalb müssen Männer als Teil der privilegierten Gruppe Verantwortung übernehmen und diese Probleme angehen.
Die entscheidenden 27 Prozent
Von 8.8 Millionen Einwohner*innen der Schweiz haben 2.3 Millionen keinen Schweizer Pass – und demnach wird ihnen das Stimm- und Wahlrecht nicht zugestanden. Wenn wir von den 6.5 übrig gebliebenen Millionen die Unter-18-Jährigen abziehen, landen wir bei rund 5.5 Millionen Menschen, die in der Schweiz wählen und abstimmen dürfen. Von diesen Menschen gingen in den letzten 50 Jahren im Schnitt nur 44 Prozent wählen, bei den unter 30-Jährigen sogar nur 30 Prozent.
Bei dieser lausigen Wahlbeteiligung entscheiden faktisch also 2.4 Millionen Menschen – 27 Prozent der Schweizer Bevölkerung – über die Gestaltung der Schweizer Politik und Gesellschaft.
Ist das wirklich eine funktionierende direkte Demokratie? Natürlich nicht.
Während ausserparlamentarische Politik ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist, hat das Parlament faktisch einen grossen Einfluss auf unser tägliches Leben, der nicht ignoriert werden kann.
Es gibt zwei Gegenmassnahmen. Erstens: Wir motivieren die rund drei Millionen Menschen, die das Wahlrecht haben, es aber selten bis nie nutzen, es doch zu tun. Zweitens: Wir ermöglichen den Menschen ohne Schweizer Pass, die zur ständigen Schweizer Wohnbevölkerung gehören, den Zugang zum Stimm- und Wahlrecht.
Zu erstens kann ich nicht viel mehr sagen als: Das Wahlrecht empfinde ich auch als eine Wahlpflicht. Alle vier Jahre ein paar Stunden hinzusitzen, um sich mit der parlamentarischen Politik auseinanderzusetzen, die smartvote-Fragen für Wahlempfehlungen zu beantworten und das Couvert schliesslich rechtzeitig einzuwerfen, finde ich keine übertriebene Anforderung.
Und wer Nicht-Wählen als politisches Statement gegen die parlamentarische Politik sieht, schiesst sich eigentlich ins eigene Knie: Die fleissigsten Wähler*innen sind Männer ab 65, und diese haben eine Tendenz zu SVP und Co. Während ausserparlamentarische Politik ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist, hat das Parlament faktisch einen grossen Einfluss auf unser tägliches Leben, der nicht ignoriert werden kann.
Zu zweitens: Der Verein Aktion Vierviertel sammelt aktuell Unterschriften für die Demokratieinitiative, die die lächerlich hohen Hürden für eine Einbürgerung heruntersetzen will. Gemäss Initiativtext sollen Menschen, die seit fünf Jahren in der Schweiz wohnen, Grundkenntnisse einer Landessprache haben und für die Schweiz keine Gefahr darstellen, einen Anspruch auf Einbürgerung haben. Das hätte grosse Auswirkungen auf die Anzahl stimm- und wahlberechtigter Menschen in der Schweiz – und könnte die Schweiz einer funktionierenden Demokratie annähern.
(Un)bewusste Voreingenommenheit
Bis wir so weit sind, kannst aber auch du, lieber weisser cis Mann mit Schweizer Pass, dafür sorgen, dass die Schweizer Wohnbevölkerung künftig in der Politik besser repräsentiert wird als bisher. Doch bevor du dein Wahlprivileg ausübst, musst du dich mit deinem unconscious bias (dt. unbewusste Voreingenommenheit) auseinandersetzen.
Kurz gesagt: Wir sind alle voreingenommen. Es ist ein menschlicher Reflex, dass wir Urteile fällen und Menschen in unterschiedliche Schubladen stecken – das geschieht meistens sehr schnell und vor allem unbewusst.
Ein Beispiel eines solchen unconscious bias ist, dass Männer eher als brillant gesehen werden als Frauen.
Das Problem mit dieser Voreingenommenheit ist, dass sie auf Stereotypen statt Erfahrung oder Wissen basiert und Vorurteile schürt, die zu Diskriminierung führen können. Die meisten biases werden uns beigebracht; das heisst aber auch, dass wir sie wieder entlernen können. Dafür müssen wir uns ihnen aber zuerst bewusst werden.
Ein Beispiel eines solchen unconscious bias ist, dass Männer eher als brillant gesehen werden als Frauen. Das zeigt eine 2020 publizierte Studie der New York University. Die Forscher*innen haben gemessen, wie sehr sich unterschiedliche Konzepte (zum Beispiel brillant und männlich) in der Vorstellung der Studienteilnehmer*innen überschneiden, ohne die Personen ausdrücklich zu fragen, ob sie diese Ansicht vertreten oder nicht. Sie verwendeten dafür den Implicit Association Test, der im Wesentlichen eine beschleunigte Sortieraufgabe ist, in der Assoziationen abgefragt werden.
Männer und Frauen aus 79 Ländern wurden befragt, mit einem deutlichen Ergebnis: Der bias, dass Männer eher mit Brillanz assoziiert werden als Frauen, war durchweg gegeben.
Klartext: Auch Frauen sehen eher Männer als brillant an, und sind sich dem gar nicht bewusst. Bemerkenswert an der Studie ist auch, dass die meisten Teilnehmer*innen bei expliziter Nachfrage sagten, dass sie Frauen sehr wohl als brillant ansehen. Doch die Messung der unbewussten Ansichten zeigt eindeutig ein anderes Bild.
Das Risiko der bubble
Ich finde die Studie spannend, weil sie aufzeigt, wie wenig wir eigentlich über uns selbst wissen. Während wir felsenfest davon überzeugt sein können, dass wir kein Geschlecht besser bewerten als andere, keine rassistischen Vorurteile haben oder Menschen mit Behinderung nicht mit Dummheit assoziieren, kann die Realität völlig anders aussehen.
Statt das zu verleugnen oder vor Frustration abzublocken, versuche ich dem mit Neugier zu begegnen. Insbesondere in Hinsicht auf die Wahlen, bei denen ich hauptsächlich fremde Menschen beurteile, stelle ich mir die Fragen: „Wieso frustriert mich diese Person? Wieso denke ich XY über diesen Menschen? Wieso ist mir diese Person sympathisch?”
Letztere könnte der similar-to-me-bias (dt. Affinitäts-Voreingenommenheit) erklären. Wir mögen Menschen besonders gerne, wenn sie uns ähnlich sind – ob das nun tatsächlich so ist oder nur so scheint. Es reicht aus, wenn wir denken, dass uns die Person ähnlich ist.
Es ist wahrscheinlich, dass wir auch unser privates Umfeld anhand dieses biases auswählen – so entsteht denn auch, was wir bubble nennen. Das Risiko ist in solchen Gruppen höher, dass wir dem confirmation bias (dt. Bestätigungsvoreingenommenheit) erliegen: Wir geben tendenziell den Fakten oder Aussagen mehr Gewicht, die unsere Meinung bestätigen.
Es gibt sehr wohl Gruppen (und Parteien) voller weisser cis-hetero Männer, die sich gegenseitig in ihrer eingeschränkten Weltanschauung bestätigen und Hass schüren – das ist doch die problematische bubble.
Ironischerweise werden nur gewisse – meistens linksgesinnte – Gruppen als bubbles bezeichnet. In dem Wort schwingt oft ein vorwurfsvoller Unterton mit: Man sagt abschätzig „in deiner bubble”, es wird propagiert, dass man „raus aus der bubble” müsse. Dabei suchen sich unter anderem FINTA (Frauen, inter, non-binäre, trans, agender Personen), queere Personen und People of Colour (PoC) ihre bubble, damit sie ein Ort haben, an dem sie sich sicher, verstanden und geliebt fühlen, und ihnen nicht andauernd ihr Existenzrecht abgesprochen wird.
Derweil gibt es sehr wohl Gruppen (und Parteien) voller weisser cis-hetero Männer, die sich gegenseitig in ihrer eingeschränkten Weltanschauung bestätigen und Hass schüren. Das ist doch die problematische bubble, aus der sie dringend mal raus müssten, doch darüber reden wir kaum.
Ihr versteht das Problem: Wenn weisse cis Männer hauptsächlich andere weisse cis Männer wählen, die einander schlimmstenfalls in menschenfeindlichen Ansichten bestätigen und auch so politisieren und bestenfalls anderen Lebensrealitäten gegenüber etwas ignorant sind; wenn Frauen ebenfalls Männer wählen (weil sie denken, dass Männer im Gegensatz zu Frauen so brillant sind); und wenn ein beachtlicher Teil der Schweizer Bevölkerung aufgrund eines fehlenden Schweizer Passes, des Alters oder einer vermeintlichen Unmündigkeit nicht wählen darf – dann repräsentiert das Parlament schlussendlich nur einen kleinen Bruchteil unserer Gesellschaft.
Schaffen wir die Männerquote ab
„Du bist doch nicht etwa für eine Frauenquote, oder?” Die Frage geht mir so auf die Eierstöcke. Die Wissenschaft ist sich einig, dass eine Frauenquote ein geeignetes Tool ist, um die Geschlechterrepräsentation schnell und unkompliziert zu verbessern. Ich finde: Wir müssen die vorherrschende weisse cis-hetero Männerquote abschaffen, die momentan in Kraft ist. Unsere unreflektierten biases stützen sie ziemlich hartnäckig.
Damit das Ganze nicht noch mal fünfzig Jahre dauert, brauchen wir also wahrscheinlich wirklich eine Frauenquote. Und eine PoC-Quote, eine Altersquote, eine Menschen mit Behinderung-Quote und viele weitere. Unter anderem, weil wir nahezu machtlos sind gegen alle unsere unbewussten Voreingenommenheiten beziehungsweise wir nicht erwarten können, dass sich alle ausreichend damit auseinandersetzen.
Dass es derweil Menschen gibt, die denken, dass es in diesen Gruppen von Menschen keine kompetenten Politiker*innen gibt und eine Quote eine ungerechte Bevorzugung bedeuten würde, ist wirklich die Spitze der Arroganz.
Es ist ein Leichtes, „Wählt Frauen” zu propagieren – aber das reicht nicht weit.
Zurück zur Frage, ob es wirklich einen Unterschied macht, ob eine Frau oder ein Mann im Parlament sitzt: Gemäss der NZZ, die 2021 eine Sitzung des Zürcher Kantonsrates analysiert hat, ist die Antwort ein Ja. Unter anderem bei den Vorstössen zeige sich deutlich: „Frauen politisieren vor allem zu Bildung, Familie und Gleichstellung. Männer geben in der Verkehrs‑, Bau- und Finanzpolitik den Ton an.”
Und was heisst das nun?
Es ist ein Leichtes, „Wählt Frauen” zu propagieren – aber das reicht nicht weit. Es gibt genügend transfeindliche, klimakriseleugnende oder geldbesessene Frauen, die ihre internalisierte Misogynie nicht reflektiert haben und Profit vor Menschenrechte stellen. Diese blockieren feministische Anliegen am laufenden Band, während sie gleichzeitig versuchen, die Menschenrechte verschiedenster diskriminierter Gruppen einzuschränken.
„Wählt feministisch” ist vielleicht die bessere message. Auf den Wahlzetteln stehen nämlich sehr wohl einige feministische, sehr wählbare Personen (inklusive Männer).
Und trotzdem ist die Schlusspointe immer dieselbe: Das Parlament sollte die Verhältnisse der Gesellschaft repräsentieren – und das bedeutet mehr Frauen, mehr queere Personen, mehr Menschen mit Behinderung, mehr Personen mit Migrationshintergrund, mehr People of Colour. Und das kannst du beeinflussen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 23 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1456 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 805 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 391 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?