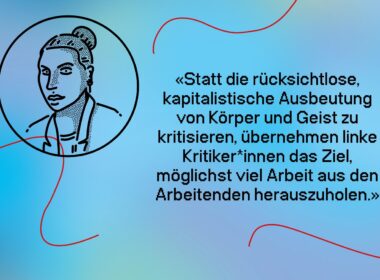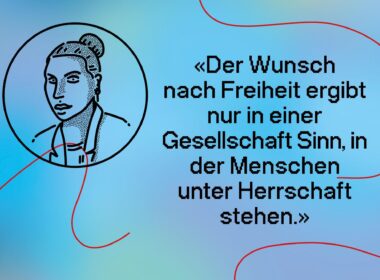Es ist bereits Nachmittag, als ich endlich eine neue Datei in meinem Schreibprogramm einrichte und sie mit dem Titel der Kolumnenfolge beschrifte: „Was Hoffnung macht“. Seit Stunden laviere ich um diesen Text herum und frage mich, warum ich das Thema überhaupt vorgeschlagen habe. Ich kenne die Antwort. Ich wollte über Hoffnung schreiben, weil sie in meinem eigenen Leben und in meinem Blick auf die Welt meist viel zu kurz kommt. Damit bin ich natürlich nicht allein.
Wenn David gegen Goliath antritt, hat er dann die Hoffnung, den Kampf zu gewinnen oder kämpft er mit dem Mut der Verzweiflung? Was bedeutet Hoffnung und wie lässt sie sich von anderen Gefühlen unterscheiden?
Am vergangenen Wochenende war ich mit meiner Mutter auf Recherchereise für einen Roman. An einem der Tage besuchten wir das Konzentrationslager Sachsenhausen, wo mein Grossvater als politischer Gefangener interniert war. Wir liefen am Erschiessungsgraben vorbei, indem Zehntausende Häftlinge hingerichtet wurden, vorbei an den Grundmauern der Gaskammern und Genickschussanlagen.
„David gegen Goliath“ ist hier Programm: Olivier David gegen die Goliaths dieser Welt. Anstatt nach unten wird nach oben getreten. Es geht um die Lage und den Facettenreichtum der unteren Klasse. Die Kolumne dient als Ort, um Aspekte der Armut, Prekarität und Gegenkultur zu reflektieren, zu besprechen, einzuordnen. „David gegen Goliath“ ist der Versuch eines Schreibens mit Klassenstandpunkt, damit aus der Klasse an sich eine Klasse für sich wird. Die Kolumne erscheint ebenfalls als Newsletter.
Von Würde und Hoffnung
In einer Baracke, die wir uns anschauten, waren exemplarisch die Geschichten von Inhaftierten protokolliert. Auf einer Tafel wurde von dem Widerstand einer Gruppe luxemburgischer Polizisten berichtet, die im Angesicht des Todes die SS-Soldaten angriffen. Niemand von ihnen hat überlebt. Die mit dem Mut der Verzweifelten unternommene Aktion schlug fehl.
Hatten diese Polizisten die Hoffnung, entkommen zu können – oder, was realistischer ist, wussten sie von der Ausweglosigkeit ihrer Gegenwehr? Ich glaube, man kann die Würde eines Menschen und seine Selbstbestimmung nicht trennen von der Idee der Hoffnung.
Diese Polizisten haben mehr verteidigt als ihr eigenes Leben. Sie standen für den Glauben ein, es besser haben zu dürfen. Ihr Heldenmut spendet anderen Menschen bis heute Hoffnung. Und diese Hoffnung, sie hat auch mit der jetzigen Situation zu tun, die zweifellos noch viele barbarische Akte von jener Zeit entfernt ist.
Hier eine kurze und unvollständige Liste der Dinge, die mir Hoffnung spenden, in einer Zeit, in der haufenweise Menschen um mich herum von sich sagen, dass sie angesichts des Rechtsrucks, des Klimawandels und der Kriege in der Welt glauben, dass die Welt unaufhaltsam den Bach runtergehe.
Geschichte wird von Gewinner*innen geschrieben
1. Als meine Mutter und ich auf dem Weg hinaus aus dem Konzentrationslager waren, sagte ich in die betroffene Stille hinein, dass dies ein guter Tag sei. „Hätte Hitler gesiegt, wären wir nicht hier. Dass wir hier sind, bedeutet, er hat verloren.” Meine Mutter nickt und ich denke, es stimmt: Die Gewinner*innen schreiben die Geschichte – und manchmal, da gewinnen die Richtigen.
3. Zu hören, wie mein Vater am Telefon weint, nachdem er das Ende meines Buches gelesen hat, das vor seiner Veröffentlichung steht. Zu hören, dass er das erste Mal in den fünfunddreissig Jahren meines Lebens weint, macht mir Hoffnung. Ich könnte den Umstand genauso gut problematisieren, ihn erklären mit männlicher Sozialisation, mit der französischen Ausprägung des Patriarchats. Aber heute entscheide ich mich, darin Hoffnung zu sehen.
Wenn Hoffnung da ist, muss von ihr berichtet werden, denn wer hofft, der hat noch nicht aufgegeben.
4. Noch mal mein Vater, entschuldigt seine Präsenz in diesem Text. Wie er am Telefon sagt, er will sich endlich um einen Eintrag ins Wahlregister bemühen, weil er einen Kandidaten gefunden hat, der ihm zusagt. Wie ich Sorge bekomme, es könnte ein Rechter sein. Wie er sagt, er will den Vorsitzenden der kommunistischen Partei wählen, weil der nicht sei wie die anderen Politiker*innen, sondern echt – und er wähle ihn auch nur, weil es aussichtslos sei, dass er an die Macht käme.
Hoffnung für psychische Gesundheit
5. Hoffnung empfinden als Möglichkeit, psychisch gesund zu bleiben. Denn was wartet in der Hoffnungslosigkeit ausser Selbstaufgabe, Frustration, Stagnation und an ihrem Ende der Rückzug ins Innere?
6. Die Hoffnung und die falsche Hoffnung voneinander trennen lernen. Falsche Hoffnung gedeiht da, wo Abkürzungen ins gute Leben vorgeschlagen werden. Das kann der nach-mir-die-Sintflut-artige Hedonismus der Mittelklasse sein. Oder das Beschwören der Kampfbereitschaft der Arbeiter*innenklasse, wo es sie (noch) nicht gibt.
7. Hoffnung aus Verantwortung. Wer schreibt und gelesen wird, prägt den Blick anderer mit, zwangsläufig ist das so. Soll ich als Autor dem gelernten Gleisbauer mit seinem kaputten Knie, mit dem ich vor ein paar Wochen noch untergehakt im Stadion stand, sagen, dass ich nicht daran glaube, dass die Welt je gut sein wird. Soll ich zu Leuten wie ihm sagen, dass sich seine Situation nie wird verändern können?
8. Eine kleine, aber sichtbare Streikwelle rollt durch Deutschland. Arzthelfer*innen, Lokführer, das Bodenpersonal in Airports, Warnstreik bei einem Getränkehersteller in Sachsen-Anhalt. Mehr davon! Es scheint, als seien Arbeiter*innen in Deutschland aus dem Winterschlaf hochgeschreckt. Kein Wunder, Arbeiter*innen in Deutschland haben im Jahr 2023 im EU-Vergleich einen überdurchschnittlichen Reallohnverlust zu verzeichnen.
Sich erlauben zu hoffen, kann den Pessimismus ersetzen und Platz schaffen für eine Erzählung vom guten Leben für alle.
9. Die Schweiz hat sich vergangenes Jahr endlich dazu durchgerungen, ein eigenes, staatlich finanziertes Holocaustdenkmal in Bern zu errichten. Die Landesregierung finanziert das nach aktuellen Schätzungen 2.5 Millionen Franken teure Projekt. Es soll insbesondere den jüdischen Geflüchteten gedenken, die an den Grenzen abgewiesen und so in einen sicheren Tod geschickt wurden. Einer der ersten Schritte in Richtung Verantwortungsübernahme schweizerischer Erinnerungskultur.
10. Die 13. AHV-Rente wurde vergangenes Wochenende deutlich angenommen. Ein historischer Sieg, gar die „erste sozialpolitische Initiative von links, die eine Mehrheit erreicht”, sei das. Seit 50 Jahren erlebte das Schweizer Sozialwerk keinen Ausbau mehr. Linke in der Schweiz haben oft wenig Grund zur Hoffnung. Aber diese Abstimmung stimmt immerhin etwas optimistischer.
„Was Hoffnung macht” lautet der Titel dieser Folge. Das kann man doppelt verstehen: Es bedeutet zum einen, Gründe für Hoffnung zu sammeln. Die doppelte Bedeutung ergibt sich, wenn man den Fokus auf das Wort „macht” legt. Sich erlauben zu hoffen, kann den Pessimismus ersetzen und Platz schaffen für eine Erzählung vom guten Leben für alle. Viele Menschen haben schon so lange leiden müssen – unter Armut, Ausgrenzung und Ausbeutung. Da hilft es, sich auf das zu besinnen, was gut ist. Wenn Hoffnung da ist, muss von ihr berichtet werden, denn wer hofft, der hat noch nicht aufgegeben.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 12 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 884 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 420 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 204 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?