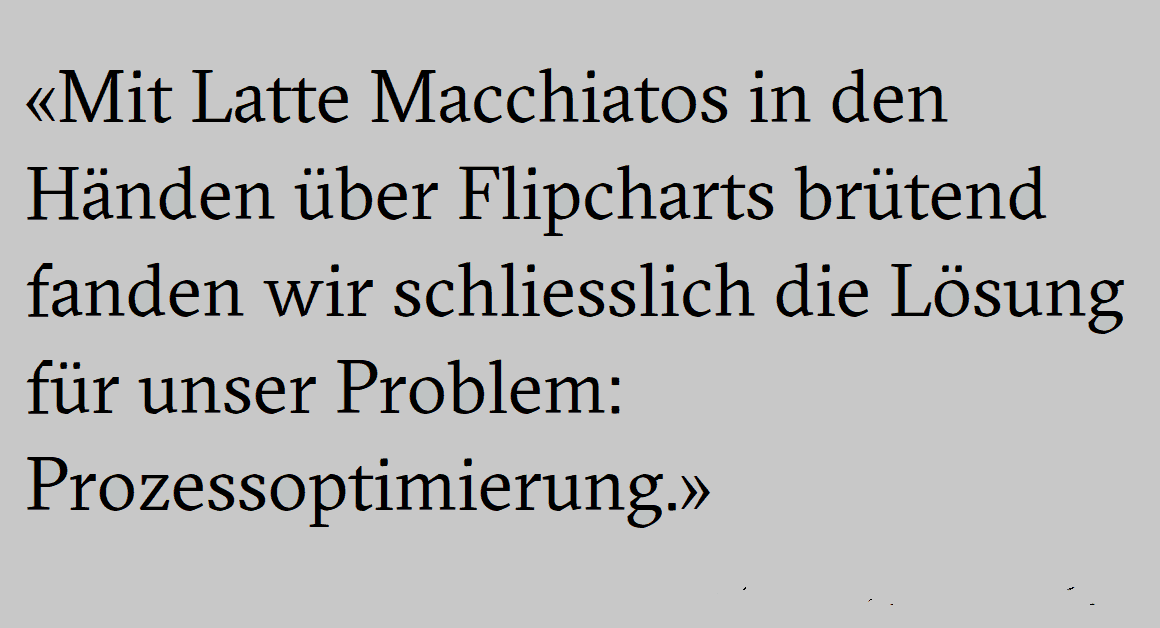Zugegeben: Wir neigen zu Alarmismus. Vielleicht nicht im gleichen Ausmass wie andere journalistische Projekte, aber wir machen unsere Leser*innen doch regelmässig auf unsere prekäre finanzielle Situation aufmerksam. „Bis im Dezember kannst du das noch lesen, aber dann geht uns das Geld aus”, war am Ende unserer Artikel im letzten Jahr jeweils zu lesen. Falsch war das nicht: das Lamm stand vor dem Aus und tut es immer noch. Unser Vermögen, das noch aus der Zeit stammt, als wir keine Löhne auszahlten, ist fast aufgebraucht. 2019 schlossen wir mit einem Jahresminus von 37’000 Franken ab.
Der Grossteil unserer Ausgaben entfällt auf die Löhne. Beim Lamm sind vier Redaktions- und zwei Geschäftsstellenmitglieder angestellt. Bisher verteilten sich unsere Stellenprozente so: Die Co-Chefredaktion teilte sich ein 100%-Pensum, die zwei weiteren Redaktionsmitglieder waren zu je 20% angestellt; die 60 Stellenprozente der Geschäftsstelle verteilten sich ebenfalls auf zwei Personen. Für unsere Löhne wendeten wird monatlich 7314 Franken auf. Zusammen mit den Honoraren für die freien Mitarbeiter*innen und einigen Fixkosten verbuchten wir 2019 monatliche Ausgaben von rund 8000 Franken. Ausgaben, die wir mit unseren Einnahmen nicht decken konnten.
Trotzdem war 2019 ein gutes Jahr für das Lamm. Was wir mit unseren bescheidenen Mitteln erreicht haben, macht uns stolz. Unsere Recherchen haben teils hohe Wellen geschlagen; mit unseren Analysen und Kommentaren vermochten wir immer wieder, politische Debatten aus Perspektiven zu beleuchten, die in der Medienlandschaft untervertreten sind, und Themen zu setzen, die anderswo keine Erwähnung fanden.
Damit erreichten wir mehr Leser*innen als je zuvor: 186’000 Nutzer*innen riefen 2019 unsere Website auf. Fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Inzwischen werden wir nicht mehr nur von unseren nächsten Verwandten auf unsere Artikel angesprochen – sondern auch von entfernten Verwandten. Wenn wir uns bei Pressesprecher*innen als Vertreter*innen des Lamms vorstellen, meint nur noch die Hälfte von ihnen, wir seien Mitglieder einer evangelikalen Jugendgruppe. Und im Verlauf des Jahres wurden auch unsere Einnahmen immer grösser. Im November und im Dezember verzeichneten wir erstmals, seit wir Löhne auszahlen, schwarze Zahlen.
In unserem Redaktionsbüro gesellte sich zum Geruch von abgestandenem Bier ein Hauch von Start-Up-Euphorie. Als wir uns Ende letzten Jahres zur Krisensitzung trafen, waren wir uns einig, dass wir noch nicht aufhören wollen. Nicht jetzt. Daran, dass wir vielleicht bald unsere Löhne nicht mehr würden auszahlen können, änderte das freilich nichts. Mit Latte Macchiatos in den Händen über Flipcharts brütend fanden wir schliesslich die Lösung für unser Problem: Prozessoptimierung.
Der Chefredaktion wurden 40 Stellenprozent gestrichen, der Geschäftsstelle 20. Die Entlohnung für Beiträge von freien Mitarbeiter*innen wurde um 50 Franken reduziert. Vor allem aber sahen wir uns gezwungen, ein ‚flexibles Lohnmodell’ einzuführen: Mit Ausnahme der Chefredaktion sind die Löhne neu an unsere Einnahmen gekoppelt. Das Geld, das wir jeden Monat verdienen, wird gemäss Anstellungspensum auf die Mitarbeiter*innen verteilt. Nur so können wir zurzeit sicherstellen, dass wir nicht plötzlich Konkurs gehen.
Bis jetzt hat das gut funktioniert. Auch im Januar haben wir wieder schwarze Zahlen geschrieben. Neu konnten wir sogar eine unserer freien Mitarbeiter*innen mit einem 60%-Pensum zu einem Monatslohn von 900 Franken einstellen, damit sie ein Praktikum im Rahmen ihres Journalismus-Studiums bei uns absolvieren kann. Und bis jetzt hat noch kein*e Mitarbeiter*in Lohneinbussen aufgrund der Kopplung an die Einnahmen hinnehmen müssen.
Aber natürlich kotzt uns dieses Troika-Fitness-Programm trotzdem an, und wir werden es nicht ewig fortführen. Bis Ende April haben wir uns eine Frist gesetzt; dann werden wir unsere Situation erneut evaluieren. Feststeht: Ein linkes Magazin zu betreiben und darin Missstände zu kritisieren, dafür aber selber so tief in die Trickkiste des Neoliberalismus greifen zu müssen, ist keine langfristige Lösung.
Aber immerhin erlaubt sie uns kurzfristig weiterzumachen. In der Hoffnung, nach einer Überbrückungszeit unsere Prozessoptimierung wieder rückgängig machen zu können. Die positiven Reaktionen auf unsere Artikel machen uns Mut; dass uns schon heute so viele Leser*innen finanziell unterstützen, gibt uns Hoffnung. Wir wollen nicht aufgeben, weil es dank ihnen heute wahrscheinlicher denn je ist, dass das Lamm langfristig überleben wird.
Vor allem aber wollen wir nicht aufgeben, weil es noch viele Geschichten zu erzählen gibt, die ohne uns niemand erzählen würde. Weil es noch viele Analysen zu schreiben gibt, die den Status Quo nicht affirmieren, sondern ihn hinterfragen. Weil wir wütend sind – und das Bedürfnis haben, diese Wut zu artikulieren. Und weil wir an die Möglichkeit eines journalistischen Mediums glauben, das sich weder auf grosse Geldgeber noch auf eine Paywall stützt, sondern allein auf Leser*innen, die je nach Budget und Interesse einen in ihren Augen angemessenen Beitrag leisten – an ein solidarisches, schlecht gelauntes Magazin.