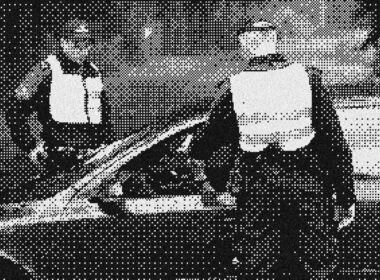Die Idee klingt schön: An Ganztagsschulen verbringen die Schüler*innen den Grossteil ihres Tages an der Schule, die wie ein zweites Zuhause ist. Der Unterricht verbindet verschiedene Lernformen – sei es im Klassenzimmer oder beim Ausflug in den Wald –, und integriert diese in den Alltag der Kinder.
So könnte beispielsweise eine Halbklasse den Morgen damit verbringen, das Mittagessen zu planen, Mengen zu berechnen, einzukaufen und zu kochen, während sich die andere Hälfte im Klassenzimmer formal mit Mathematik beschäftigt. Solche Lernformen erleichtern den Transfer zwischen theoretischem Wissen und praktischen Einsatzmöglichkeiten.
Das Lernen erscheint sinnhaft, Mitarbeitende aus verschiedenen Berufszweigen finden ihre Rolle und tragen ihren Teil zu den Lernerfahrungen der Kinder bei. Hausaufgaben gibt es keine mehr, denn sie schaffen Ungleichheit in puncto Chancengerechtigkeit. Alles Schulische bleibt in der Schule. Alle haben eine gute Zeit.
Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Nein, denn beispielsweise in Schweden sind solche Schulsysteme längst Realität. Doch an den Zürcher Tagesschulen bleiben diese schönen Ideen nur Theorie, denn ausreichend zahlen, will die Politik dafür nicht.
Zu wenig Ressourcen
Von 2015 bis 2022 wurden in einem Pilotprojekt dreissig Schulen in der Stadt Zürich in den Tagesschulbetrieb umfunktioniert. Im September 2022 entschied die Zürcher Stimmbevölkerung, dass bis 2030 alle Schulen der Stadt in dieses Modell überführt werden sollen. Das Versprechen der Stadt lautet dabei, die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf” zu erleichtern sowie den Unterricht und die Betreuung „pädagogisch und organisatorisch zusammenführen”.
„Um Personalkosten zu sparen, wurden die Arbeitspensen des Betreuungspersonals regelrecht zerstückelt. Übrig bleibt eine Anstellung, deren Lohn nicht zum Leben reicht.”
Till Zurbuchen, Betreuer an einer Schule der Stadt Zürich
In der Praxis bedeutet dieses neue Modell zum Beispiel, dass der Mittagstisch in ein sogenanntes Open-Restaurant mit zwei Schichten umgewandelt wird. So kann jeder Platz am Zmittagstisch von doppelt so vielen Kindern belegt werden als zuvor, um die Schüler*innen möglichst kosteneffizient zu verpflegen. Auch der Lärmpegel verdoppelt sich in den ohnehin schon engen Räumlichkeiten und bietet keinem*keiner der Anwesenden eine angemessene Ruhephase.
Koordiniert werden diese Mittage von gut ausgebildetem Betreuungspersonal, das nun während der gesamten Zeit damit beschäftigt ist, zu kontrollieren, ob alle Kinder anwesend sind. Als Erkennungsmerkmal in den Massen von Kindern tragen sie orange Leuchtwesten. Neuerdings übernehmen auch Lehrpersonen diese Aufgaben, um das Betreuungspersonal zu entlasten – und Hortmitarbeitende helfen im Unterricht. Welche Rolle und Aufgaben die jeweiligen Berufsgruppen im anderen Bereich übernehmen, bleibt weitgehend ungeklärt.
Um Personalkosten zu sparen, wurden die Arbeitspensen des Betreuungspersonals regelrecht zerstückelt. Es ist nun kaum mehr möglich, ein Vollzeitpensum in der Betreuung zu arbeiten. Typisch sind jetzt 50 Prozent verteilt auf fünf Tage die Woche – oftmals mit Zimmerstunden. Übrig bleibt eine Anstellung, deren Lohn nicht zum Leben reicht, und die viele Arbeiter*innen wie Alleinerziehende ausschliesst. Von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie die Stadt sie propagiert, bleibt keine Spur.
„Während die niedrigen Einkommensklassen nur wenig entlastet werden, profitieren vor allem Top-Verdiener*innen-Haushalte.”
Till Zurbuchen, Betreuer an einer Schule der Stadt Zürich
Bisher folgte die Berechnung der Kosten der Familien für die Betreuung ihrer Kinder einem Stufenmodell, ähnlich dem der Steuern. Je höher das Haushaltseinkommen, desto höher fallen die Kosten für Betreuung aus. Neu gilt für alle ein Einheitstarif von sechs Franken pro Mittagessen und Mittagsbetreuung.
Während die niedrigen Einkommensklassen nur wenig entlastet werden, profitieren vor allem Top-Verdiener*innen-Haushalte. Wer bisher den höchsten Satz bezahlt hat, kann nun mit vier Betreuungstagen rund 10’000 Schweizer Franken jährlich einsparen – Geringverdienende maximal ein Zehntel davon. Somit stellen diese sechs Franken für Familien mit niedrigem Einkommen eine Hürde dar, die sie möglicherweise ausschliesst, während Wohlhabende weiter profitieren können.
Nach einem pädagogischen Mehrwert sucht man bei alldem vergebens. Der einzige Vorteil: Die Stadt Zürich spart Geld – auf Kosten der Kinder und Angestellten.
Es fehlt der politische Wille
Ich arbeite selbst seit vielen Jahren bei der Stadt Zürich in der Betreuung. Mittlerweile habe ich mich für eine Kündigung entschieden, da ich mit dieser Entwicklung nicht mitgehen möchte.
Der VPOD hat bereits während der Pilotphase der Tagesschulen Bedingungen aufgestellt, die erfüllt sein müssten, damit alle davon profitieren. Dazu gehören unter anderem: vorbildliche Anstellungsbedingungen für das Lehr‑, Betreuungs- und Reinigungspersonal, klare Regelung der Zuständigkeit und Kompetenzen und ausreichend personelle Ressourcen für die pädagogische Arbeit über Mittag.
Das „Kollektiv kritischer Lehrpersonen” fordert in ihrem Positionspapier hauptsächlich den Ausbau der Räumlichkeiten, einen Stopp der Ressourcenkürzungen in der Betreuung und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Begriff Chancengerechtigkeit.
„Ich würde erwarten, dass bei grossen Umwälzungen im Bildungsbereich die Bedürfnisse der Kinder im Mittelpunkt stehen.”
Till Zurbuchen, Betreuer an einer Schule der Stadt Zürich
Das Leben von Schulkindern ist anforderungsreich: Da ist der schulische Stoff, Prüfungen, das soziale Gefüge in der Klasse, aber auch Lärm und Reizüberflutung. Fällt der Kontakt zu den Eltern tagsüber weg, ist der Bedarf der Kinder nach anderen Bezugspersonen, denen es sich anvertrauen kann, umso grösser.
Meiner Meinung nach brauchen Kinder im schulischen Umfeld in erster Linie vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Bezugspersonen. Dies bestätigen auch diverse Studien, die sich mit dem Lernerfolg von Schulkindern befassen.
Als Mitarbeiter ist es für mich wichtig, die Kinder zu kennen – ihre Persönlichkeit, aber auch ihre schulischen und privaten Umstände. Nur so kann ich sie adäquat begleiten. Es bräuchte Betreuungspersonen, die individuell strukturieren und begleiten – doch dafür bleibt keine Zeit. Statt vielfältiger Lernerfahrungen konzentrieren sich die Zürcher Tagesschulen auf die Verwaltung möglichst vieler Kinder in möglichst kurzer Zeit zu möglichst tiefen Preisen.
„Die Stadt Zürich spart Geld – auf Kosten der Kinder und Angestellten.”
Till Zurbuchen, Betreuer an einer Schule der Stadt Zürich
Ich würde erwarten, dass bei grossen Umwälzungen im Bildungsbereich die Bedürfnisse der Kinder im Mittelpunkt stehen. Was das Tagesschulmodell bis jetzt bedeutet, ist die doppelte Menge an Kindern in zu kleinen Räumlichkeiten mit überlastetem Personal. Notwendig wären allerdings den neuen Bedürfnissen angepasste Schulhäuser, den Einbezug der Kinder und Mitarbeitenden bei Entscheidungen und der Wille, die Schule als einen Ort des ganzheitlichen Lernens zu betrachten.
Dazu müsste allen Berufsgruppen im schulischen Bereich die gleiche Wertschätzung entgegengebracht werden und faire Anstellungsbedingungen für alle geschaffen werden. Wenn eine Tagesschule für die Kinder ein temporäres Daheim, ein Lernfeld, ein Ort der Begegnung sein soll, darf es in diesen Punkten keine Kompromisse geben.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 25 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1560 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 875 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 425 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?