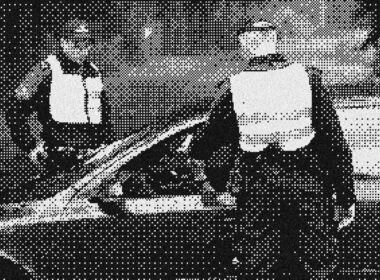In den vergangenen Monaten bewegte sich der mediale Diskurs immer wieder nahe am Abgrund des Sag- und Fragbaren und schob gleichzeitig die rote Linie immer weiter vor. JournalistInnen von links bis rechts rieben sich die Augen und wunderten sich über Fragen, deren Antwort man eigentlich kennen sollte. Darf man Menschen vor dem Ertrinken retten? Darf man Kinder von ihren Eltern trennen und in Käfige sperren? Darf man Menschen in Länder ausweisen, in denen sie mit ziemlicher Sicherheit verfolgt und getötet werden?
Während um uns herum über die Ergebnisse des EU-Flüchtlingsgipfels und über Trumps Grenzpolitik debattiert und gestritten wurde, fanden ganz ähnliche Diskussionen auch in Bundesbern statt, etwa im Hinblick auf Waffenexporte in Bürgerkriegsländer. Ist es politisch vertretbar, im Namen der einheimischen Wirtschaft Menschenleben zur Disposition zu stellen?
Die Konzernverantwortungsinitiative, die eine Umgewichtung zwischen politischem und ökonomischem Opportunismus in der Privatwirtschaft und humanitärer Verantwortung fordert, setzt im Grunde genau hier an. Konzernverantwortung bedeutet, dass jeder in der Schweiz ansässige Konzern eine Menschenrechtspolicy vorweisen muss, die universal und an allen Konzern- und Zulieferstandorten gültig ist. Wird diese verletzt, kann dagegen in der Schweiz geklagt werden.
Was ziemlich intuitiv daherkommt, stösst hierzulande auf grossen Widerstand innerhalb der Privatwirtschaft, deren politischer Repräsentantengarde und den neoliberalen Götterboten von NZZ bis Weltwoche. Die heftigen Gegenreaktionen zeigen: Es ist im Kern eine Debatte um die Gewichtung von universalen Menschenrechten überall – und den nationalen Vorteilen durch den Wirtschaftsliberalismus am Standort Schweiz. „Switzerland first” musste nicht erst in Anlehnung an Trumps Amerikapolitik gedichtet werden – „Switzerland first” ist seit jeher die politische Gangart.
Die Debatte um die Konzernverantwortungsinitiative, das grosse Zittern bei jenen, die in perfekt formatierten PDFs seitenlang ihre Umwelt- und Nachhaltigkeitspolicies illustrieren, hunderte Male hinstehen und sagen, dass sie nichts zu verstecken hätten, die Positionen von Economiesuisse über Migros bis zu Glencore und Handelszeitung werfen Fragen auf, welche diejenigen nach der konkreten Umsetzbarkeit, nach den langsamen politischen Mühlen und nach der grundlegenden Wirksamkeit politischer Initiativen weit übersteigen.
Wenn Economiesuisse sagt, dass man „eine weitere Verrechtlichung ablehne, weil juristische Auseinandersetzungen der falsche Weg seien, um nachhaltige Fortschritte im Schutz von Mensch und Umwelt zu erreichen”, dann müssen wir uns als Gesellschaft ein paar Fragen stellen. Etwa, wieso es legitim ist, über demokratisch gestützte und rechtskonforme Mittel und Wege zu streiten, mit denen Menschenleben geschützt werden können, und warum wir solche zynischen Statements als Teil der Debatte hinnehmen. Wir sollten uns auch fragen, warum nicht schon lange für die lückenlose Einhaltung von Menschenrechten gesorgt wurde, wenn es, wie das „falsch” im Zitat impliziert, auch „richtige” Wege geben muss?
Das wirtschaftliche Neusprech von Economiesuisse und Co. und die martialische Sprache der GegnerInnen sind unter anderem Gegenstand des ersten Artikels dieser Kurzserie, der einen pointierten Überblick über die Debatte verschaffen soll. Besonders von der Konzernverantwortungsinitiative betroffen sind Megakonzerne wie der Zuger Rohstoffgigant Glencore. Doch könnte die Konzerninitiative als politisches Instrument überhaupt gegen den Multi ankommen?Glencore steht schon seit Jahren schadlos im Kreuzfeuer von NGOs und MenschenrechtlerInnen, wie der zweite Text aufzeigt.
Die Konzernverantwortungsinitiative tangiert aber nicht nur multinationale Giganten, sondern auch Schweizer KMUs aus dem Hochrisikobereich. Der Diamantenhändler Rolf Zibung bewegt sich mit seinen Geschäften in diesem Hochrisikobereich. Warum er dennoch auf Eigenverantwortung setzt statt auf gesetzliche Regulation, hat er Simon Muster im Gespräch verraten. Daraus entstand das Porträt eines schillernden Geschäftsmanns zwischen Buddhismus und Blutdiamanten – der letzte Teil dieser Miniserie.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 6 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 572 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 210 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 102 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?