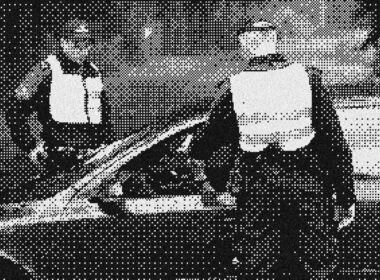Sehr geehrter Herr Köppel,
ich werde ehrlich mit Ihnen sein: Die Weltwoche gehört nicht zu meiner regelmässigen Lektüre. Unter anderem auch deswegen nicht, weil sie Themen, die mir wichtig sind – Feminismus, Frauen*rechte, Frauen*bewegungen – immer etwas stiefmütterlich behandeln. Umso hellhöriger wurde ich also, als mir eine gute Freundin kürzlich einen Weltwoche-Artikel zukommen liess: Von Ihnen, dem Verleger, persönlich geschrieben und dann auch noch mit dem Titel: „Ratajkowski. Sex und Feminismus: Geht das zusammen? Klar. Wie der Fall einer bildhübschen England-Polin zeigt.”
___________________________________________
Muss man Rechtspopulisten eine Plattform bieten?
Vor einem knappen Monat beantwortete der das Lamm-Redaktor Simon Muster diese Frage mit einem klaren „Nein, muss man nicht“ und schrieb an dieser Stelle darüber, was passieren kann, wenn die Medien Rechtspopulisten, deren Ideen und Meinungen als Sprachrohr dienen.
In der Redaktion haben wir seither hitzig darüber diskutiert, was berichtenswert ist, wo es Sinn macht zu widersprechen – und was vielleicht besser ignoriert werden sollte.
Die das Lamm-Redaktorin Natalia Widla ist der Meinung: sich nicht instrumentalisieren lassen, ja, aber es gibt Ansichten, denen muss auch ganz klar etwas entgegengehalten werden. Dieser Artikel ist Ausdruck dieser Position.
___________________________________________
Sex und Feminismus: die Überwindung scheinbar unüberwindbarer Differenzen. Und dann auch noch im, wie Sie sagen, fleischgewordenen Männertraum, dem Model Emily Ratajkowski – bekanntgeworden, wie Gott sie schuf, im Video zum Rape-Culture-Hit „Blurred Lines”! So viele Reizwörter in einem Titel, da konnte ich nicht anders, als alles stehen und liegen zu lassen und mir einzuverleiben, wie Sie, Herr Köppel, es denn mit dem Feminismus haben. Ihre Antwort auf die Gretchenfrage des 21. Jahrhunderts wollte ich kennen.
Nach der Lektüre muss ich sagen: Auch wenn Feminismus eine durchaus subjektive Haltung ist, nehme ich es mir dennoch raus, Ihnen zu widersprechen. Erlauben Sie mir also, den einen oder anderen Abschnitt, in der Reihenfolge seines Auftretens im Originaltext, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen:
Wem gehört der Körper einer Frau*, Herr Köppel?
[…] Der Körper gehört Emily Ratajkowski, Schauspielerin, Model, Instagram-Superstar, wahrscheinlich Influencerin, nach eigenem Bekunden Feministin, wobei sie ihren Feminismus unter anderem durch die Verbreitung von Bildern auslebt, die, wenn sie ein Mann von seiner Frau veröffentlichen würde, unverzüglich als Scheidungsgrund, als purer Sexismus, ja als missbräuchlicher Übergriff und verurteilenswerte Pornografie-Vorstufe gewertet würden, weil sie die Frau zum Objekt männlicher Lüsternheit herabwürdigen.
Ein versöhnlicher Einstieg, denn mit diesem Abschnitt bin ich einverstanden. Tatsächlich wäre es ein unglaublicher Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, würde ein Mann ohne deren Einwilligung erotische Bilder „seiner” Frau* verkaufen oder auch nur veröffentlichen. Schön, sind wir uns hier einig. Deswegen ohne grosse Gegenworte zum nächsten, etwas kontroverseren Abschnitt:
Interessant ist allerdings, dass sie konsequenterweise auch dann wie ein Erotik-Modell auftritt, wenn sie sich an feministischen Kundgebungen gegen männliche Wollust und Sexismus beteiligt. […] . Emily Ratajkowski […] marschierte vor dem Washingtoner Capitol gegen Kavanaugh mit, bauchnabelfrei, hautenge Jeans, ein Nichts von einem T‑Shirt, das Relief ihrer perfekten Brüste unter makelloser weisser Baumwolle, Pardon, fast mit Händen zu greifen.
Ui, das war schon etwas sexistisch, hey! Zum Glück kam das „Pardon”. Sonst hätte sicher grad die Genderpolizei bei Ihnen angerufen, und Pussy-Riot-Aktivistinnen wären schreiend über Ihren Rasen gerannt. Aber dank des Pardons: gerettet. Ich finde diesen Abschnitt, Pardon, zum Kotzen. Denn: Feminismus ist eben genau diese Freiheit, über den eigenen Körper zu bestimmen. Und wenn das in „hautengen” Jeans geschieht, ist das genauso gut, wie wenn es nackt passiert, im Latexanzug, mit Hijab oder in einer Öko-Jeanslatzhose und T‑Shirt mit Virginia-Woolf-Konterfei.
Feminismus ist die Freiheit, den eigenen Körper so zu präsentieren, wie die jeweilige Frau* es will; nicht mit jeder Kleiderwahl auch abwägen zu müssen, wie die männliche Umwelt auf die Stoffe reagiert, in die Frau* ihren Körper hüllt. Oder eben nicht hüllt. Er ist auch die Freiheit, sich zu kleiden wie Frau* will und dennoch in ihren Anliegen ernst genommen zu werden.
Wenn Sie Ratajkowskis Outfit hier als etwas aufspielen, was die von Ihnen so verhasste Stereotypen-Emanze Ihrer Vermutung nach als unfeministisch bezeichnen würde: Das zeigt, wie wenig Sie von Feminismus verstanden haben.
Oder nehmen wir diesen Kurzfilm über Teigwaren, der sogar in der seriösen britischen Tageszeitung The Guardian mit hoher sprachlicher Virtuosität gedeutet wurde. Emily, in roter Reizwäsche, hat in zahllosen Stellungen „orgasmisch” Sex mit einem Teller Spaghetti. Der Beischlaf läuft unter dem Titel „Advent der Liebe” […].
Übrigens wird der neue Feminismus auch von vielen in der Sexbranche tätigen Frauen* getragen. Stripperinnen, Sexarbeiterinnen, Dominas: Auch diese Frauen* können Feministinnen sein – auch wenn sie ihren Körper verkaufen, ein wenig so, wie Frau Ratajkowski es tut. Nur eben anders. Denn es ist ein Unterschied, ob eine Sexarbeiterin, oder in diesem Fall ein „Erotik-Model”, frei darüber entscheidet, wem sie wie viel von ihrem Körper (und zu welchem Preis) zeigt, oder ob es deswegen auch voll okay ist, diese Frauen* zu objektivieren: zu begrapschen, zu belästigen, ihre Körper mit dem männlichen Blick zu vermessen und darüber zu berichten, wie ergreifend man den Anblick der jeweiligen Brüste findet. Aber von dem männlichen Blick sprechen Sie ja auch längst nicht mehr. Vielmehr führen Sie nun endlich die Kampf-Emanzen ins Feld:
Daraufhin gab es dann doch Kritik von anderen, vermutlich weniger gut aussehenden Feministinnen, die ihren Feminismus von Rata missverstanden fühlten. Die Angegriffene wiederum hielt lasziv dagegen: Sexiness und Frauenrechte seien kein Gegensatz. Im Gegenteil, solange jede Frau selber entscheide, wie unbekleidet sie sich öffentlich gebe, sei das Ausdruck ihrer Befreiung.
Sie haben recht. Es ist laut Emily Ratajkowski, wie sie in mehreren Interviews erklärte, tatsächlich der Kern ihres Feminismus, die freie Wahl zu haben, zu tun, was sie will.
Natürlich: Dieses Verständnis von Feminismus ist mittelständisch, westlich, weiss und unglaublich privilegiert, und es entspricht mitnichten den primären Zielen und Prioritäten, die ein globaler Feminismus, wenn es diesen denn überhaupt gibt, momentan verfolgt. Solch ein Verständnis ist auch nicht unumstritten, aber es ist auch nicht falsch. Und erst recht nicht unfeministisch.
Im Fall eines amerikanischen Supermodels kann „tun, was ich will” eben bedeuten, sich aufreizend anzuziehen und Nacktfotos zu posten – und dennoch nicht von Produzenten, hohen Showbiz-Tieren oder irgendwelchen anderen Männern belästigt und begrabscht, vermessen und öffentlich bewertet zu werden. Im Fall einer anderen Frau* kann „tun, was ich will” bedeuten, keiner Genitalverstümmelung unterzogen zu werden, nicht gegen ihren Willen verheiratet zu werden, nach dem käuflichen Sex den vereinbarten Betrag zu erhalten oder nachts ohne Angst, vergewaltigt zu werden, nach Hause gehen zu können. Zwischen diesen Beispielen liegen ellenlange Differenzen. Der Ansatz aber, das zu tun, was Frau* möchte, so zu sein, wie Frau* möchte – und sich nicht von patriarchalen Strukturen unterbuttern, misshandeln und zerstören zu lassen, dieser Ansatz ist all diesen Beispielen gemein.
„Feminismus ist bekanntlich eine Art Neidsozialismus unter Frauen”
Zum Schluss greifen Sie dann auch noch in die ganz grosse Definitionskiste und erklären der Welt, was der Feminismus eigentlich will und was er im Grunde ist: Ein postsowjetisches Projekt wider die menschliche Natur:
Feminismus ist bekanntlich eine Art Neidsozialismus unter Frauen. Es geht am Ende darum, Unterschiede einzuebnen, Ungleiches gleich zu machen. Schönere Frauen sollen am Arbeitsplatz, aber auch bei Männern keine Vorteile gegenüber weniger schönen Frauen haben, was natürlich eine realitätswidrige Forderung ist, aber wie der Sozialismus ist eben auch der Feminismus ein Aufstand gegen die Wirklichkeit, eine Revolte gegen die menschliche Natur. […] Feminismus […] ist die Rache der weniger schönen Frauen an den Männern mit den schöneren Frauen. Das Beispiel Ratajkowski zeigt allerdings, dass auch die schönen Frauen ins Visier der Frauen geraten können. Nichts ist mitleidloser als der weibliche Konkurrenzkampf. Und Frauen leben ihre Rivalitäten giftiger, ja tödlicher aus als Männer. Wer daran zweifelt, soll das Machtgerangel zwischen Maria Stuart und Königin Elisabeth studieren. […] Superschöne Frauen erkaufen sich den Frieden mit den weniger schönen Frauen, indem sie sich zu Feministinnen erklären. Was Ratajkowski macht, ist so etwas wie Ablasshandel, nur kostengünstiger. Sie gibt sich als Feministin, um ihre erotischen Vorteile zu verwerten, ohne die anderen Frauen gegen sich aufzubringen.
Jaja, der liebe Neid. Die liebe Natur. Die Revolte, die schon beim Realsozialismus scheiterte. An der menschlichen, einzig wahren Natur nämlich. Und diese Natur ist es auch, die den Feminismus, dieses blasse Konstrukt der Missgunst, schlussendlich in die Knie zwingen wird. Denn was sind wir selbsternannten Feministinnen nicht alles neidisch? Was zerreissen wir uns nicht die ungeschminkten, von Damenschnauz umrahmten Münder über die heissen, erfolgreichen (weil eben heiss!) Frauen* dieser Welt?
Herr Köppel, glauben Sie mir: Es gibt wichtigeres zu tun im Feminismus, als sich gegenseitig klein zu machen. Und lassen Sie sich von mir eines sagen: Wenn es Neid unter Frauen* gibt, dann entspringt er nicht der Natur. Dann ist er das Resultat einer patriarchalen Gesellschaft, die den Mädchen seit dem ersten Tag, an dem sie in den Spiegel schauen, eintrichtert, dass sie schöner sein müssen als andere Frauen*. Dünner. Besser. Er ist, wenn es diesen von Ihnen beschworenen Weiberneid in dieser Form überhaupt gibt, das Resultat einer gesellschaftlichen Prägung auf lebenslange Konkurrenz zwischen Frauen* mit dem Ziel, besser bei Männern anzukommen. Es ist ein perfides Puppentheater und ein geiler Männer-Spass, dabei zuzusehen, wenn sich die Weiber verbal oder tatsächlich durch den Matsch ziehen. Dieser Neid ist ein Unding, das dadurch am Leben erhalten wird, dass Männer wie Sie Frauen* subversiv gegeneinander aufzuspielen versuchen, indem Sie Texte wie diesen verfassen.
Und ja, natürlich können Frauen* über andere Frauen* herziehen, andere Frauen* hassen, sie niedermachen und herabwürdigen. Dieses Verhalten, Herr Köppel, ist aber per se eben gerade nicht feministisch. Nicht jede Frau* ist eine Feministin, nicht jede Frau* will eine Feministin sein.
Popfeminismus, und jetzt?
Im Übrigen tut es mir an dieser Stelle leid, dass ich mit Ihnen überhaupt über Frau Ratajkowski sprechen muss – natürlich nicht Ihnen gegenüber, sondern gegenüber Frau Ratajkowski. Zum einen tut es mir leid, weil es jedem Grundsatz des Feminismus widerspricht, irgendwelche Themen, anhand einer einzelnen Frau* und deren Verhaltensweisen abzuhandeln, und andererseits, weil es mich schlichtweg nicht interessiert, wenn Frau Ratajkowski in ihrer Insta-Bio „Model, Actress, Feminist, Designer” stehen hat. Auch wenn ich nach dieser Recherche vielleicht ein, zwei, fünf Kritikpunkte an Frau Ratajkowski hätte, so wäre es absolut vermessen, mich an dieser Stelle über sie auszulassen, widerspricht das doch einem der grundlegendsten Gebote des Feminismus: der Solidarität unter Frauen*.
Wenn es für Frau Ratajkowski richtig erscheint, sich als Feministin zu bezeichnen, dann ist es genauso ihr Recht wie das von Beyoncé oder jedem 12-jährigen Mädchen, das ein „This is what a feminist looks like”-T‑Shirt von H&M spazieren führt. Wir dürfen uns auch darüber streiten, wie fern die genannten Beispiele dem historisch gewachsenen Feminismus entsprechen und wie weit sie eine neue Strömung konstruieren, den Popfeminismus nämlich.
Feminismus ist kein gesicherter Begriff und auch kein exklusiver Club von kurzhaarigen, unrasierten Weibern mit mit Judith-Butler-Büchern gefüllten Regalen, die alles anfauchen, was nicht der feministischen Norm entspricht. Feminismus ist auch das – aber nicht nur. Und beides ist in Ordnung. Feminismus ist keine Schablone, der eine Frau* entsprechen muss. Feminismus ist – und ich glaube, das haben Sie nicht verstanden – der Kampf gegen diese Schablone.
Antifeminismus — der unkreativen Art
Und zum Schluss noch eines, Herr Köppel, so ganz unter uns Schreiberlingen, von links unten nach rechts ganz oben, wenn Sie so wollen: Die „Alle Emanzen sind fett und unterfickt und neidisch”-Keule ist weder neu noch sonderlich kreativ. Ihr Text hat mich also nicht nur wegen der vielen losen Behauptungen enttäuscht, sondern auch, weil die von Ihnen bedienten Klischees nicht einmal einfallsreich sind. Dieselben Klischees gabs schon als Antwort auf die erste Frauen*bewegung im 19. Jahrhundert, sie wurden schon den Suffragetten angedichtet, sie schreien aus jeder labbrigen 20 Minuten-Schlagzeile. Sie langweilen auf Dauer.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 24 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1508 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 840 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 408 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?