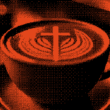Es ist eine Eigenheit der Corona-Zeit, dass das Unmögliche möglich geworden ist. Die WOZ hat jetzt keine Paywall und das Parlament keine Macht mehr. Vor wenigen Wochen sei alles noch so anders gewesen, erzählt man sich mit ernster Miene, das historische Gewicht der Situation anerkennend. Damals sprach man noch von der Eskalation an der europäischen Aussengrenze, heute über die eigene Bedrohung. Die Stimmen im öffentlichen Raum scheinen zuweilen gedämpft: Als müsste man flüstern im Angesicht der unsichtbaren Gefahr. Das Virus ist fast allen fast immer bewusst.
Es gilt, jetzt Abstand zu halten. Mindestens zwei Meter sollen zu jeder Zeit zwischen uns und den andern stehen; Menschenansammlungen sind verboten; wer hustet, wird geächtet (und hat das Bedürfnis zu beteuern, dass das Husten vom Rauchen komme).
Trotzdem ist man mit Corona auch weniger allein. Solidaritätsaktionen spriessen aus dem Boden, Unzählige bieten der Risikogruppe ihre Unterstützung an. Plötzlich scheint es spürbar, dass alle eine Verantwortung dafür tragen, wie es den anderen geht. Jetzt, wo der Staat so rigoros durchgreift wie vielleicht noch nie, ist er irgendwie auch weiter weg denn je: Er vermag uns diese Verantwortung nicht abzunehmen.
Hierzulande scheinen die Atomisierten einander in Anbetracht der geteilten Gefahr gerade näherzukommen. Dass die Überlastung des Gesundheitssystems, die Infizierung von Risikopatient*innen, kurz, dass das Sterben um jeden Preis zu verhindern sei; darin sind sich alle einig. „Bleibt zuhause!“, ruft der Bundesrat, rufen die Zeitungen, dröhnt es in den sozialen Medien, schreiben sich die Leute auf die Fahnen, die sie an ihren Balkon hängen.
Mit jeder euphorischen Wiederholung dieses eingängigen Mantras tritt sein schier unerträglicher Zynismus noch deutlicher hervor.
In den Lagern an der europäischen Aussengrenze nähen sich Insass*innen derweil ihre eigenen Atemschutzmasken, um sich auf Corona vorzubereiten. Auf der Insel Lesbos wurde ein erster Fall von Covid-19 bestätigt. Bei Moria auf Lesbos sind zurzeit fast 20’000 Personen in einem Lager untergebracht, das eigentlich für 3000 Personen vorgesehen wäre. Der Zugang zu fliessendem Wasser ist begrenzt, die sanitären Anlagen sind überbeansprucht, das Lager ist von Nato-Stacheldraht umgeben, um die Leute an Ort und Stelle festzuhalten. „Das ist die Hölle“, sagte ein Syrischer Flüchtender unlängst dem Guardian über die Zustände in Moria. Das war noch vor Corona.
Griechenlands Lager, von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Schutzschild Europas bezeichnet, sind ein Verbrechen von historischem Ausmass. Das politisch motivierte Elend dort ist so gross, dass es sich kaum fassen lässt: weit weg und abstrakt. Jetzt droht es noch grösser zu werden, aber vielleicht auch konkreter, da das Lager mit der gleichen Bedrohung konfrontiert wird, welche die reichsten Regionen der Welt an den Rand des Zusammenbruchs zwingt. Wie in Zeitlupe rückt die nächste Zuspitzung der Katastrophe von Moria näher.
Es war nie dringender, den Zynismus zu überwinden. Und jetzt, da Europa – und ja, die Schweiz zählt zu Europa – diese bisher unbekannte Handlungsfähigkeit an den Tag legt, da die soziale Verantwortung wiederentdeckt wird, da es plötzlich unkontrovers ist, zum Schutz von Menschenleben Milliarden auszugeben, und diejenigen mit dem richtigen Pass aus aller Welt in Charterflügen nachhause transportiert werden; jetzt ist es vielleicht auch möglicher denn je, diese Lager zu evakuieren – und damit das Verbrechen endlich zu beenden. Es ist Zeit.
Um diesen Kommentar zu illustrieren, haben wir unseren Cartoonisten und Illustratoren Oger angefragt. Entstanden ist ein Bild, das wir schliesslich nicht in den Artikel eingebaut haben, weil es uns die Sprache verschlug. Also publizieren wir es hier kommentarlos. Das Bild sagt alles.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 12 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 884 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 420 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 204 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?