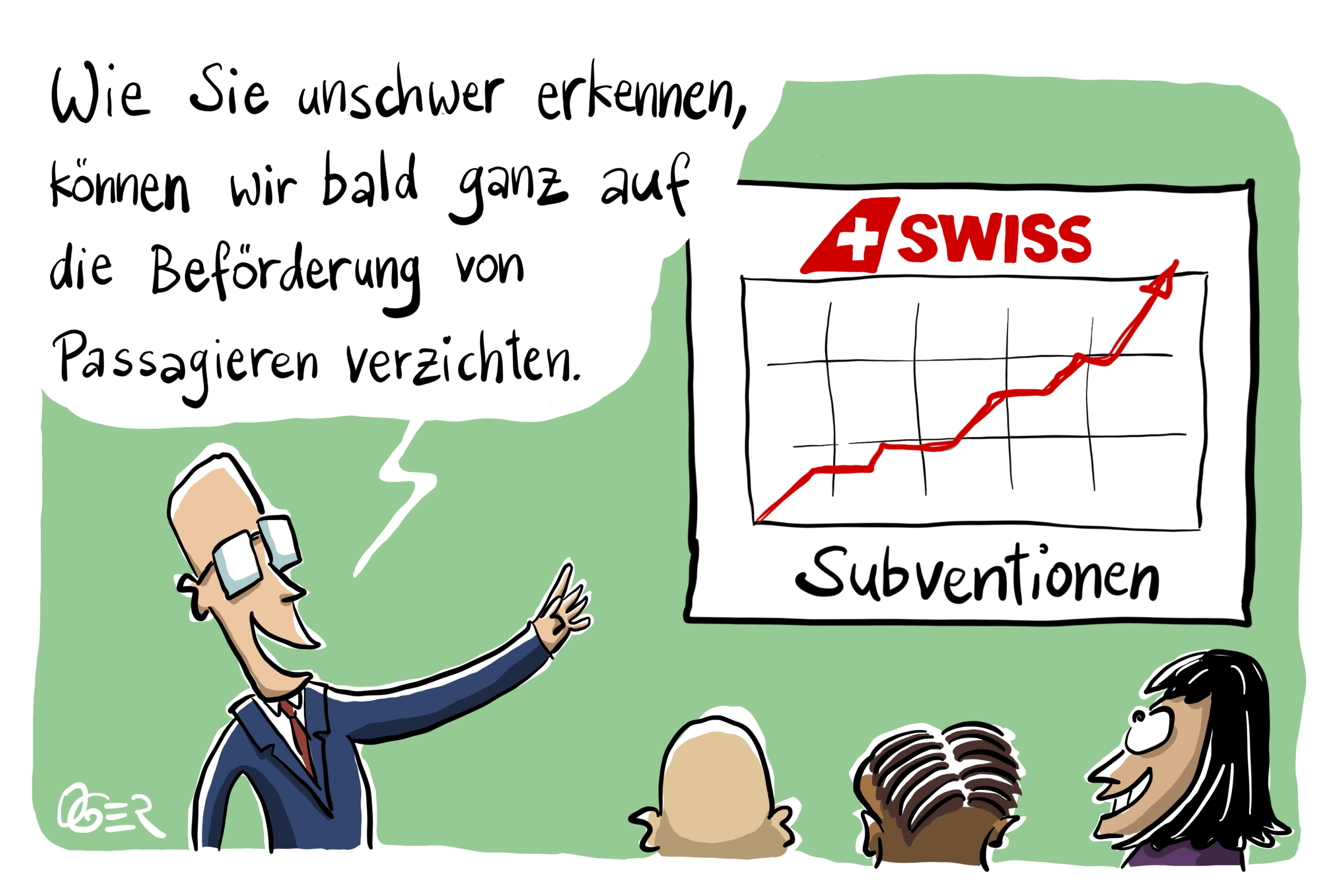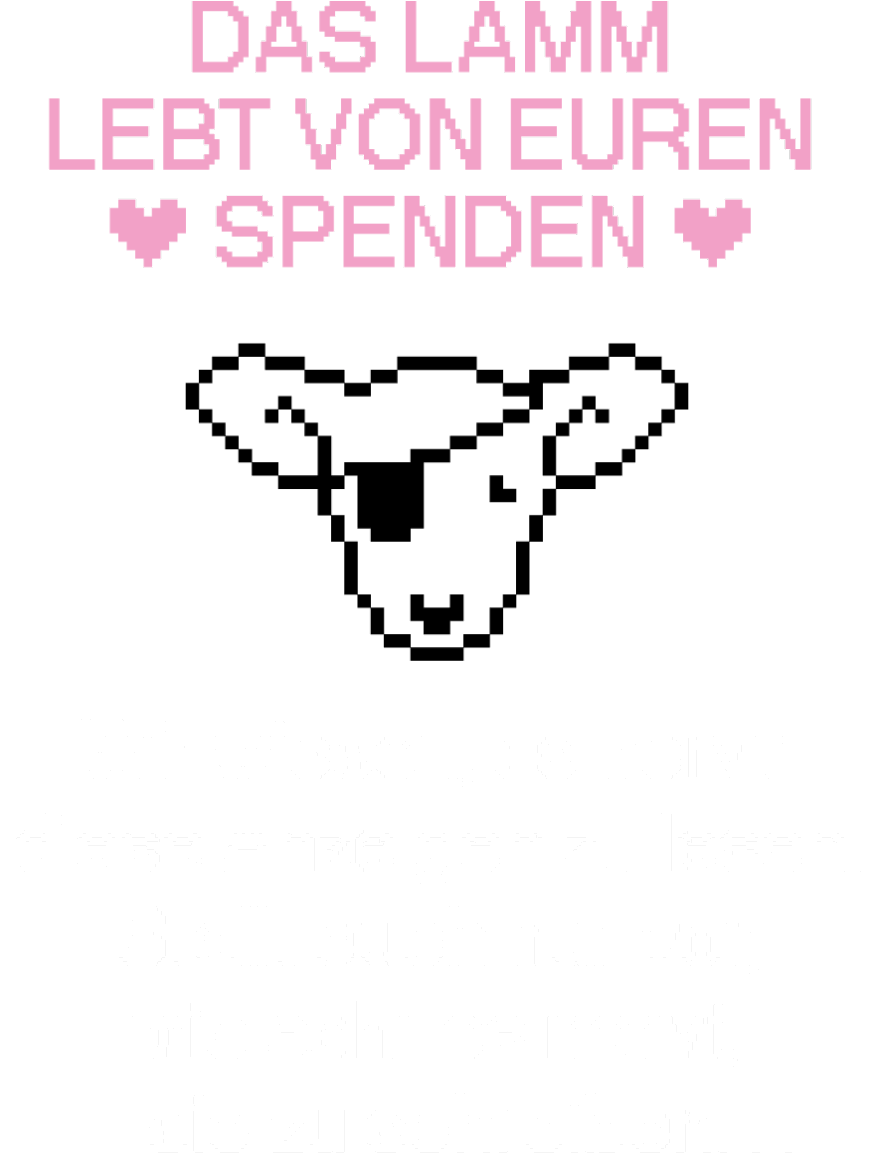Die Schweiz präsentiert sich gerne als Forschungs- und Innovationsnation. Und das mit gutem Grund: Kein Land produziert pro Kopf mehr wissenschaftliche Publikationen und auch bei der Zitationsquote der Publikationen liegt die Schweiz hinter den USA auf Platz zwei. Mit Abstand Spitzenreiterin ist die Schweiz bei der Anzahl Patente pro Kopf.
Unerlässlich für diese Leistung ist die Arbeit von Forschenden an Schweizer Hochschulen. Doch nun klagen Wissenschaftler:innen in einer Petition über miese Arbeitsverhältnisse: 80 Prozent seien in „prekären Verhältnissen” angestellt. Sie fordern deshalb die Schaffung vielfältiger unbefristeter Stellen unterhalb der Professur. Doch was bedeuten „prekäre Verhältnisse” an Hochschulen? Hier lohnt sich der Blick auf eine typische universitäre Karriere in der Schweiz.
Bei der Promotion sind Nachwuchsforscher:innen in der Regel zwischen 30 und 37 Jahre alt. Danach, als sogenannte Postdocs, finanzieren sie ihre Forschung entweder durch eine befristete Stelle als Oberassistenz an einer Uni oder mithilfe einer Förderinstitution. Das ferne Karriereziel für viele ist die ordentliche Professur. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Zuerst muss man sich an verschiedenen Hochschulen als Assistenz- und als ausserordentliche Professor:in qualifizieren. Nur wer sich gegen die Konkurrenz durchsetzt, kann auf eine ordentliche Professur berufen werden. Zu diesem Zeitpunkt sind die Forschenden meist deutlich über 40 Jahre alt.
Konkurrenzdruck und ungewisse Perspektiven
2019 waren 46’881 Personen als wissenschaftliches Personal an den Unis angestellt. Den Grossteil davon macht der sogenannte Mittelbau aus, also die 42’317 Doktorierenden, Postdocs, Dozierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen. Dagegen bilden die 4’564 Professor:innen die Minderheit. Was soll daran aber besonders prekär sein?
80 Prozent der Forschenden an Unis sind befristet und zumeist in Teilzeit angestellt. Das gilt insbesondere für den Mittelbau. Unbefristete Arbeitsverträge haben nur die wenigsten und auch unter den Professor:innen gilt dies nur für die ordentlichen Professor:innen. Entsprechend klein ist die Zahl an Forschenden, die jemals eine Festanstellung besetzen. Zwar können Karrierewege je nach Hochschule und Fachbereich anders aussehen. Doch egal, ob an einer Uni oder einer Fachhochschule, das Prinzip ist überall dasselbe: up or out.
Ein Experte des Schweizerischen Nationalfonds SNF schätzt, dass nur etwa 10 Prozent der Postdocs es bis zur Professur schaffen. Dieser extreme Flaschenhals bedeutet aber nicht nur grossen Konkurrenzdruck. Wer eine Hochschulkarriere einschlägt, setzt auch alles auf eine Karte. Denn was auf dem Weg zur Professur zählt, sind Publikationen in renommierten Journals, eingeworbene Fördermittel und Forschungsaufenthalte an namhaften Schulen im Ausland. Daneben bleibt kaum Zeit, um berufliche Erfahrungen zu machen, die auf dem Arbeitsmarkt auch ausserhalb der Akademie wertvoll wären. Und wer es trotzdem versucht, findet kaum wieder zurück, weil der Wettlauf um die Professuren ungebremst weiterläuft.
Mit zunehmendem Alter wird der Ausstieg aus dem Wissenschaftsbetrieb zudem immer riskanter. Wer mit 45 merkt, dass es nichts wird mit der Professur, muss sich nach über 25 Jahren an der Hochschule plötzlich auf dem Arbeitsmarkt behaupten. Hier geht nicht nur Fachkräftepotential verloren, es werden auch Lebenskrisen in Kauf genommen.
Auch innerhalb der Hochschulen haben die späte Selektion und der konstante Druck gravierende Konsequenzen. Dass sie sich ständig um neue befristete Stellen und Projekte bewerben müssen, raubt Wissenschaftler:innen nicht nur Zeit für Forschung und Lehre. Es setzt sie auch in mehrfache Abhängigkeit von Arbeitgeber:innen, Betreuer:innen und Expert:innen – ein Nährboden für Mobbing und sexuelle Belästigung, für Burnouts und psychische Erkrankungen. Überzeit und Arbeit an den Wochenenden sind an Hochschulen nicht nur die Norm, sie werden auch erwartet.
Nicht zuletzt fällt für viele die Familiengründung in die Postdoc-Phase. Zeit mit Partner:innen und Kindern bleibt aber häufig nur wenig. Zu diesem Zeitpunkt reduzieren dann deutlich mehr Frauen ihr Arbeitspensum zugunsten von Haushalt und Care-Arbeit oder verlassen die Wissenschaft gleich endgültig. Kein Wunder, bilden Professorinnen mit knapp 24 Prozent in der Schweiz noch immer die Minderheit.
Das Problem ist bekannt
Bereits 2012 forderte eine Gruppe junger Forschender den Bundesrat zum Handeln auf. Man sehe das Problem, aber die Anstellungsverhältnisse lägen in der Kompetenz der Hochschulen, lautete die Antwort aus Bern. Das Anliegen der Forschenden stiess dennoch auf offene Ohren. Gemeinsam mit Hochschulen, Trägerkantonen und dem SNF sollte ein langfristiger Strukturwandel aufgegleist werden. In wichtigen Punkten hat sich die Situation seither auch verbessert: Einzelne Hochschulen haben bereits vielfältigere Stellenprofile geschaffen. Ausserdem schreibt das neue Hochschulgesetz von 2015 Chancengleichheit zwischen Mann und Frau für die Akkreditierung von Hochschulen vor und Förderprogramme zur Unterstützung von Frauen und Eltern wurden ausgebaut. Der SNF vergibt seine Gelder zudem seit August nach Exzellenz-Kriterien der DORA-Deklaration, die eine ganzheitliche Bewertung von Forschenden fordert. Dadurch sinkt der Publikationsdruck und ausseruniversitäre Erfahrungen finden Anerkennung.
Solche Verbesserungen werden vom Mittelbau als Schräubchen-Politik kritisiert. „Die vorgelegte Strategie bleibt in den Leitplanken des aktuellen Systems und geht die grundlegenden Probleme, die wir und viele andere sehen, nicht an”, sagt Dr. Fanny Georgi. Die Virologin ist Postdoc an der Uni Zürich und Co-Präsidentin der Vereinigung Akademischer Nachwuchs der Universität Zürich (VAUZ).
Der Fokus – sowohl strukturell als auch finanziell – auf wenige Professuren stehe in einem Missverhältnis zum steigenden Tempo wissenschaftlicher Entwicklungen und zum massiven Anstieg der Studierendenzahlen. Während im Studienjahr 1990/91 noch 85’940 Studierende immatrikuliert waren, verzeichneten die Hochschulen 2019/20 satte 258’076.
Um Forschung und Lehre überhaupt zu ermöglichen, werde die geringe Zahl an Professuren durch ein Übermass an kostengünstigen, befristeten Stellen kompensiert, sagt Georgi. „Sich hierfür auf Nachwuchswissenschaftler:innen, die unter besonderem Leistungs- und Zeitdruck stehen, zu verlassen, ist eine gefährliche Entwicklung. Viele Doktorierende und Postdocs fühlen sich ausgenutzt.”
Petition an die Bundesversammlung
Getragen von Mittelbauorganisationen fast aller Hochschulen haben Nachwuchsforschende daher ihre Petition lanciert. Bald sind 6’000 von 8’000 geplanten Unterschriften gesammelt, Anfang 2021 sollen sie eingereicht werden. In der Petition wird die Bundesversammlung aufgefordert, die nötigen gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Hochschulen mehr und vielfältigere unbefristete Stellen unterhalb der Professur schaffen.
Damit sind aber nicht nur Positionen in Lehre und Forschung gemeint. Auch der sogenannte „third space” soll erweitert werden, also doktoriertes Fachpersonal für Management und Support der Wissenschaftler:innen. Hochschulen in den USA und Grossbritannien haben ihre Stellen schon lange diversifiziert, Forschungsnationen wie die Niederlande, Israel und Schweden sind dem Beispiel bereits gefolgt.
Mit ihren Zielen will die Petition alle Hochschulangehörigen – auch die Professor:innen – entlasten und Forschung und Lehre verbessern. Die Selektion für die akademische Karriere soll dank der Massnahmen früher stattfinden, spätestens nach dem Doktorat und nicht wie heute auf Stufe Professur. Während so die einen bessere Aussichten auf eine unbefristete Anstellung hätten, würde der Rest als hochqualifizierte Fachkräfte zum Einstieg in die Arbeitswelt ausserhalb der Hochschulen motiviert. Und exzellente Nachwuchsforscher:innen mit realistischen Chancen auf eine Professur würden früher gefördert.
Finanziert werden sollen die unbefristeten Stellen mit einer „Reduktion der projektförmig vergebenen Forschungsmittel zugunsten einer höheren Grundfinanzierung der Hochschulen”. Genau das schlägt auch die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) in einem Bericht zur Nachwuchsförderung vor. Eine solche Umlagerung könne „finanzneutral realisiert werden”, meint der Generalsekretär der SAGW, Dr. Markus Zürcher. Dies auch, weil bei weniger Projektanträgen weniger administrative Arbeiten anfallen – etwa bei Evaluation, Beurteilung, Gewinnung von Gutachter:innen oder bei der formalen Ausarbeitung der Projekte.
Politik und Hochschulen tun sich schwer mit der Petition
Die drei wichtigsten Player in der Schweizer Hochschulpolitik sind die Rektor:innenkonferenz swissuniversities, der SNF und das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Sie sprechen auf Anfrage nur verhalten Unterstützung für die Petition aus. Zwar sollen die Grundbeiträge erhöht werden, aber nur um eine „jährliche Steigerung [...] von 1,8 % für die kantonalen Universitäten und 2 % für die Fachhochschulen”, wie es in der Planungsbotschaft 2021–2024 heisst.
Eine grössere Umverteilung von projektgebunden Mitteln zu Grundbeiträgen, wie sie auch die SAGW vorschlägt, ist dabei nicht vorgesehen. Man befürchte eine „Schwächung des Forschungsplatzes Schweiz”, teilt der SNF auf Anfrage mit. „Ausreichende kompetitive Mittel” seien nötig, „um innovative Forschung zu fördern und flexibel auf neue Forschungsrichtungen zu reagieren und die Qualität der Forschung in der Schweiz auf international hohem Niveau zu halten”.
Georgi vom Petitionskomitee widerspricht: „Wir sind nicht dafür, dass es keine Konkurrenz um die beste Idee gibt. Aber auch in der Forschung gibt es feste Aufgaben, die von festen Angestellten erledigt werden sollten, um die Forschenden zu entlasten. Heute erleben wir immer wieder einen enormen Wissens- und Qualitätsverlust, wenn eine Person nach vier bis fünf Jahren ihren Platz räumen und jemand Neues eingearbeitet werden muss. Kaum ein Unternehmen könnte sich das leisten.”
Petitionär:innen fürchten um ihre Karrieren
Dass Mittelbauangehörige eine Petition lancieren müssen, um sich Gehör zu verschaffen, ist Ausdruck ihrer schwachen Position in der Schweizer Hochschulpolitik. Mit actionuni hat der Mittelbau zwar einen Dachverband, dieser ist aber ohne anständige Finanzierung auf ehrenamtliche Arbeit der überarbeiteten Mitglieder angewiesen. Und konkrete Entscheidungsbefugnisse hat actionuni keine. Bei swissuniversities beispielsweise erhält der Verband kaum mehr als eine Audienz, die er sich mit den Studierenden teilen muss.
Dabei zahlt sich der Miteinbezug des Mittelbaus aus. So konnte etwa die Better Science Initiative der Uni Bern Handlungsmaximen für Wissenschaft ausarbeiten, die von allen beteiligten Akteur:innen gelobt wurden. Im Gespräch mit Postdocs wird aber rasch klar: An vielen Hochschulen steht es schlecht um die offene Diskussionskultur. So wollen die meisten Organisator:innen der Petition auch anonym bleiben. „Wir haben Angst vor den Folgen für unsere Karriere und unseren Lebensunterhalt. Das darf so nicht sein”, klagt ein Petitionsmitglied. Es möchte nicht mit Namen genannt werden.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 32 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1924 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1120 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 544 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?