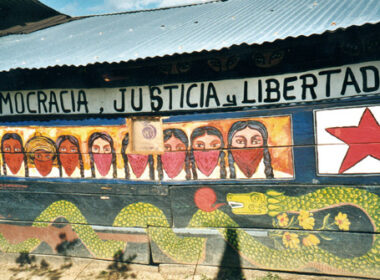Mitte Juni. Eine Delegation von Aktivist:innen und Politiker:innen aus Deutschland und der Schweiz versucht, in die Autonome Region Kurdistan im Nordirak zu reisen. Ihr Vorhaben: auf die „völkerrechtswidrigen Angriffe” und auf die seit Frühjahr wieder zunehmenden türkischen Luftschläge gegen die PKK aufmerksam machen.
Rund 150 Teilnehmer:innen hätte die Delegation umfassen sollen, die in Erbil Gespräche mit verschiedenen Akteur:innen hätte führen sollen. Mehrere der Teilnehmer:innen, die schon im Nordirak sind, werden in Erbil von der Peschmerga, den Streitkräften der Autonomen Region Kurdistan, am Flughafen festgehalten oder daran gehindert, ihr schon bezogenes Hotel zu verlassen.
Andere kommen nicht einmal so weit. Darunter auch Simon Meier*. Der internationalistische Aktivist aus Zürich wird mit anderen Aktivist:innen am Flughafen in Düsseldorf über mehrere Stunden festgehalten und an der Ausreise gehindert. Er erzählt: „Die Polizei sagte, dass es Ausschreibungen gegen einige von uns gäbe, weil wir in der Vergangenheit politisch auffällig gewesen seien.” Meier vermutet, dass auch aus der Schweiz Geheimdienstinformationen weitergeleitet wurden über Leute, die an Anti-Erdoğan-Demonstrationen waren.
Über drei Stunden wird Meier von der Polizei verhört und über sein Vorhaben im Nordirak ausgefragt. Die PKK wolle junge Leute für den bewaffneten Kampf gegen die Türkei rekrutieren, meint die Polizei.
Seit 1984 herrscht ein bewaffneter Konflikt zwischen der Türkei und der Arbeiterpartei Kurdistans PKK auf türkischem, irakischem und syrischem Territorium. Die PKK wird in der Türkei, in den USA und seit 2002 auch in der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft. Ihre Hauptstützpunkte befinden sich in den Kandil-Bergen im Nordirak. Nachdem die Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen der Türkei und der PKK 2015 scheiterten, verübt die Türkei wieder regelmässig Luftangriffe auf PKK-Stellungen im Nordirak. Als marxistisch-leninistische Partei gegründet, verfolgt die PKK mittlerweile das von ihrem Gründungsmitglied und Anführer Abdullah Öcalan erarbeitete Konzept des Demokratischen Konföderalismus. Dieses sieht selbstverwaltete, hierarchiefreie kurdische Gebiete vor, ohne dabei einen unabhängigen kurdischen Staat anzustreben.
Die im Nordirak liegende Autonome Region Kurdistan ist ein autonomes Gebiet innerhalb des Irak, in dem ca. 5.5 Millionen Menschen leben. Nach dem Golfkrieg 1991 erlangten die Kurd:innen 1992 de facto Autonomie, seit 2005 wird das kurdische Autonomiegebiet durch die irakische Verfassung anerkannt. Seither hat die Region eine eigene Regierung, ein eigenes Parlament, verabschiedet einen eigenen Haushalt und verfügt mit der Peschmerga über eigene Streitkräfte. 2017 hielt die Autonome Region Kurdistan ein Unabhängigkeitsreferendum ab. 93 Prozent stimmten für eine Abspaltung vom Irak. Die irakische Armee besetzte daraufhin einige Gebiete in der Region, die Türkei und der Iran drohten mit scharfen Reaktionen. Daraufhin brach Präsident Barzani den Weg in die Unabhängigkeit fürs Erste ab.
In der auch an Simon Meier adressierten, für einen Monat geltenden Ausreiseuntersagung fällt jedoch ein anderes Argument auf. In dem das Lamm vorliegenden Schreiben begründet die Polizei ihre Entscheidung damit, dass „eine Teilnahme deutscher oder europäischer Staatsbürger [...] die Beziehungen zur Türkei weiter negativ belasten” würde.
„Solch eine Begründung kann man in Deutschland bringen. In der Schweiz bräuchte es eine andere”, meint Simon Meier dazu. Obwohl im jährlichen Bericht des Schweizer Geheimdienstes die Sicht auf die PKK als Organisation mit terroristischem Hintergrund klar zum Ausdruck kommt, steht die Partei hierzulande nicht auf der Terrorliste. Die Teilnahme an der Friedensdelegation könne also nicht vorab ausgeschlossen werden.
Doch auch wenn die Positionen vordergründig unterschiedlich sind: Die Verhinderung des Zustandekommens dieser Friedensdelegation sagt viel über die Rolle westeuropäischer Staaten, besonders derjenigen Deutschlands, im Kampf der Türkei gegen die Kurd:innen aus.
Deutsch-europäisches Verhältnis zur Regionalmacht Türkei
Die Entscheidung, die Aktivist:innen am Flughafen festzuhalten, sei aus vielerlei Hinsicht problematisch, meint die Nahost-Expertin Arzu Yilmaz. Die Politikwissenschaftlerin lehrt seit 2016 in Hamburg und dozierte zuvor an der Duhok Universität in der Autonomen Region Kurdistan.
Im Gespräch über Zoom kritisiert sie die Begründung der Ausreiseuntersagung durch die deutsche Polizei. Sie erwähne schlichtweg das falsche Land und ignoriere die Autonome Region Kurdistan komplett: „Hätten sie gesagt, dass dies einen Einfluss auf das irakisch-deutsche Verhältnis hätte, dann wäre dies in einer gewissen Art und Weise sogar verständlich. Doch anscheinend betrachtet Deutschland Ankara als Gesprächspartner, wenn es um Erbil geht.”
„Die deutsche Politik gegenüber den Kurd:innen und vor allem gegenüber der PKK unterscheidet sich meiner Meinung nach nicht von der türkischen Politik.”
Arzu Yilmaz, Nahost-Expertin und Politikwissenschaftlerin
Deutschland und die Türkei haben seit Jahren eine sehr enge Beziehung, die zu einer klaren Haltung im Konflikt mit der kurdischen PKK führt, meint Yilmaz. Als eines der ersten Länder ist Deutschland den Unterstützungsforderungen der Türkei gefolgt und hat 1993 die PKK verboten. Heute dominieren Wirtschaftsbeziehungen und die Kooperation der Türkei bei der Schliessung von Fluchtrouten nach Europa.
Deutschland als ökonomische Hauptlastträgerin der EU will keine Verschlechterung der Beziehungen zur Türkei in Kauf nehmen, wie Yilmaz meint. Die deutsche Regierung heisse die türkische Aussen- und Innenpolitik im Umgang mit den Kurd:innen kritiklos gut: „Die deutsche Politik gegenüber den Kurd:innen und vor allem gegenüber der PKK unterscheidet sich meiner Meinung nach nicht von der türkischen Politik.”
In den Konfliktgebieten um Syrien, den Irak und Afghanistan entsteht mit dem aktuellen Rückzug der US-Truppen ein geopolitisches Vakuum, in welchem die Türkei ihre Macht derzeit massiv ausbaut. Währenddessen sind die europäischen Staaten laut Yilmaz hingegen immer noch dabei, sich ohne das vorneweg gegebene Engagement der USA eine neue Nahost-Strategie zuzulegen. Diese Unentschlossenheit der europäischen Staaten beeinflusse auch das innerkurdische Verhältnis, meint Yilmaz.
Einfluss auf das innerkurdische Verhältnis
Die konservative Demokratische Partei Kurdistan PDK ist die dominierende politische Kraft in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Sie hält die Kontrolle über einen Grossteil der Gebiete der Region, über die Regionalregierung sowie über die Präsidentschaft und ist die stärkste Partei im Parlament. Darüber hinaus prägt die PDK den öffentlichen Diskurs massgeblich mit, wie Yilmaz meint: „Wer immer Statements herausgibt, ist von der PDK. Die PDK dominiert die Region – mehr noch als die Institutionen der Autonomiebehörde.”
Daneben haben auch die Patriotische Union Kurdistan PUK und die PKK ihre Einflusszonen. Über längere Zeit griffen die drei Gruppen nicht in die von den anderen Gruppen kontrollierten Gebiete ein.
Die Dynamik, die die Erstarkung des sogenannten Islamischen Staates 2014 im Nordirak nach sich zog, führte zu einer Zusammenarbeit der drei Gruppen und zu einer Aufweichung der starren Gebietsverteilung. Die PDK und PKK weiteten ihre Einflusszonen aus und versuchten, ein neues Koexistenz-Abkommen zu schliessen. „Doch dies scheiterte. Zur gleichen Zeit intensivierte die Türkei ihre militärischen Operationen”, sagt Arzu Yilmaz dazu.
In einer drohenden innerkurdischen Auseinandersetzung liegt ein Hauptziel Erdoğans und der Türkei: Die Kurd:innen zu spalten und einen Bürgerkrieg zu provozieren, damit das Ziel der kurdischen Unabhängigkeit in weite Ferne rückt.
„Je mehr die Türkei ihre Militäroperationen ausweiten konnte, desto mehr wurde die PKK zu den ‚roten Linien’ der PDK-Stützpunkte zurückgedrängt. Dies verschlechterte die Beziehung zwischen der PDK und der PKK.” Im Zuge der Intensivierung der türkischen Angriffe habe die PDK ihre Strategie gegenüber der PKK geändert und verfolge nun einen konfrontativeren Kurs. In einigen Gebieten kommen sich PKK- und PDK-Einheiten nun gefährlich nahe. Die PKK wiederum wirft der PDK vor, mit der Türkei militärisch zu kooperieren.
In einer drohenden innerkurdischen Auseinandersetzung liegt ein Hauptziel Erdoğans und der Türkei: Die Kurd:innen zu spalten und einen Bürgerkrieg zu provozieren, damit das Ziel der kurdischen Unabhängigkeit in weite Ferne rückt. Die Türkei könnte einen solchen Fall als Rechtfertigung für eine Intervention verwenden, ihr Territorium in den Nordirak ausweiten und mehr Einfluss gewinnen.
Wie schon bei der Invasion in Rojava in Nordsyrien 2019 könnten Erdoğan und seine illiberal-islamische AKP-Partei innenpolitisch erneut grosse Teile der Parteienlandschaft für den Kampf gegen die Kurd:innen und insbesondere gegen die kurdische Oppositionspartei HDP mobilisieren.
Mit dem Vorwand des Kampfes gegen den Terrorismus der PKK versucht Erdoğan also einerseits die Kurd:innen im Nordirak gegeneinander aufzubringen und andererseits die Kurd:innen innerhalb der Türkei mundtot zu machen. Sein Kampf gilt allen Kurd:innen und hat zum Ziel, seine Macht zu festigen und die Landkarten neu zu zeichnen.
Erstarkendes Ansehen der PKK?
Die Teilnehmer:innen der Friedensdelegation seien mitunter wegen der innerkurdischen Spannungen in Erbil festgehalten oder ausgewiesen worden, meint Arzu Yilmaz. Die Delegation beabsichtigte unter anderem, Politiker:innen der PDK davon zu überzeugen, dass der Krieg der Türkei gegen die PKK einer gegen alle Kurd:innen sei und es deshalb keine Annäherung zwischen der PDK und der Türkei geben dürfe.
Die Tatsache, dass die Türkei in der Region weitaus grössere Ziele als den Kampf gegen die PKK im Sinn hat, stellt laut Yilmaz auch eine Bedrohung für die PDK dar: „Die Menschen merken, dass die Militärschläge der Türkei nicht nur der PKK gelten. Dies führte in den letzten Jahren auch zu Sympathie-Bekundungen gegenüber der PKK. Vor allem jüngere Generationen werden der PKK immer zugeneigter. Sie verstehen die Gründe für ihren Kampf gegen die Türkei besser als früher. Das ist ein Problem für die PDK.”
Die Türkei habe ihr gutes Image als modernisiertes Projekt im Nahen Osten, NATO-Mitglied und EU-Beitrittskandidatin innerhalb der Bevölkerung der Region verspielt. Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in der Autonomen Region Kurdistan 2017 und den Drohungen vonseiten der Türkei, der Belagerung des syrischen Afrîn 2018 und ihrem Einmarsch in Rojava in Nordsyrien 2019 seien die Menschen ablehnender geworden. „Sie erleben deren Militäroperationen am eigenen Leibe mit”, meint Yilmaz. Auch deshalb stosse die zunehmend pro-türkisch werdende Politik der PDK nicht auf Wohlwollen in der Bevölkerung.
Gleichzeitig bleibt deren Sicht auf die PKK unklar: Viele Menschen im Nordirak sehen die Rolle der PKK primär als Widerstandsgruppe gegen die Türkei und weniger als Partei mit einem klar definierten politischen Konzept. Für viele sei ausserdem unklar, wie die PKK nun zur Frage der kurdischen Unabhängigkeit stehe, da Abdullah Öcalans Konzept des Demokratischen Konföderalismus eine solche nicht vorsieht.
„Ich besuchte Begräbnisse von PKK-Kampfer:innen. Ich hörte die Statements an ihrer Beerdigung. Sie sagen nicht, dass diese Menschen gestorben sind, um grundlegende Menschenrechte einzufordern. Sondern dass sie für Kurdistan gestorben sind.”
Arzu Yilmaz, Nahost-Expertin und Politikwissenschaftlerin
In Interviews mit Hunderten kurdischen Bürger:innen und Politiker:innen, aber auch mit Menschen, die für die PKK in die Guerilla zogen, stiess Yilmaz immer wieder auf unklare Positionen. „Beim Referendum 2017 hiess es von der PKK: ‚Wir sind nicht gegen die Unabhängigkeit, aber gegen den Staat’“, sagt sie. Die PKK würde sich gleichzeitig inszenieren als die einzige Gruppe, die sich wirklich für Kurdistan einsetzt: „Ich besuchte Begräbnisse von PKK-Kampfer:innen. Ich hörte die Statements an ihrer Beerdigung. Sie sagen nicht, dass diese Menschen gestorben sind, um grundlegende Menschenrechte einzufordern. Sondern dass sie für Kurdistan gestorben sind. Das sind verwirrende Signale hinsichtlich der grundlegenden Ziele und Ideale der PKK.”
Vertreibung und Friedensarbeit
Die Teilnehmer:innen der Delegation wollten ihre Reise in den Nordirak eigentlich dazu nutzen, sich ein konkretes Bild über die Angriffe der Türkei zu verschaffen und darauf aufmerksam zu machen, welche wirklichen Interessen die Türkei in der Region mit ihren Angriffen verfolgt.
Dass diese sich nicht bloss gegen Stellungen der PKK, sondern auch gegen zivile Einrichtungen in Dörfern nahe der türkisch-irakischen Grenze richten, darüber berichten Aktivist:innen der Christian Peacemaker Teams (CPT), die seit 2007 vor Ort im Einsatz für die Betroffenen sind.
Kamaran Osman, der als Teil der CPT im Nordirak im Einsatz ist, erzählt: „Jeden Tag müssen Menschen ihre Dörfer verlassen. Im Moment sind ca. 250 Dörfer komplett evakuiert wegen der türkischen Luftangriffe. 300 Dörfer müssen potenziell evakuiert werden, das heisst, einige Menschen haben diese Dörfer bereits verlassen. Jedes Jahr sterben mindestens 20 Menschen bei diesen Angriffen. Seit August 2015 wurden mehr als 105 Zivilist:innen getötet.”
Die Auswirkungen der türkischen Expansionspolitik tragen Zivilist:innen in den Dörfern: „Die Menschen sind traumatisiert. Menschen sterben, werden verletzt, müssen ihre Dörfer verlassen. Sie können nicht ins Spital, weil sie geschlossen sind oder zerstört wurden. Kirchen wurden zerstört. Die Türkei geht gegen Kurd:innen gleichsam vor wie gegen andere Minderheiten.”
Dass westeuropäische Staaten dieses Vorgehen nicht nur billigen, sondern auch aktiv unterstützen, findet Osman tragisch: „Es ist eine grosse Schande, dass die europäischen Länder am Krieg verdienen, statt als Mediator:innen zwischen der Türkei und der PKK zu wirken.” Osman fordert, dass Deutschland alle ihre Waffenlieferungen an die Türkei einstellen und sich endlich für Friedensverhandlungen zwischen der Türkei und der PKK einsetzen sollte.
Doch danach sieht es nicht aus, wie die Festhaltung der Delegation von Aktivist:innen und Politiker:innen aus Deutschland und der Schweiz durch die deutsche Polizei am Flughafen Düsseldorf Mitte Juni demonstriert. Osman zeigt sich beunruhigt über dieses Vorgehen: „Sie wollten auf den Krieg aufmerksam machen und die PDK davon überzeugen, nicht Partei für die Türkei zu ergreifen.”
Die Sache der Delegation sowie weitere lokale und internationale Friedensbemühungen wären wichtig, damit die Türkei nicht noch weiter in das Gebiet der Autonomen Region Kurdistan vordringt. Dem stimmt auch Simon Meier zu, der am Flughafen in Düsseldorf nicht ausreisen durfte: „Wir wollten dort hingehen, um auf diesen Krieg aufmerksam zu machen. Und darauf, dass der Kampf dagegen uns alle etwas angeht.”
*Name geändert
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 20 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1300 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 700 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 340 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?