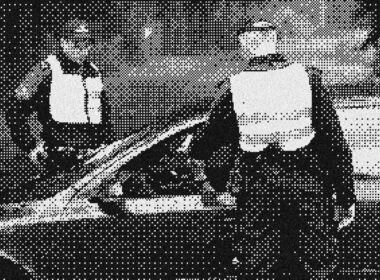Am letzten Juniwochenende habe ich meine Freund*innen ein wenig länger umarmt als sonst. Ich kam von meiner Schicht in der Pizzeria, in der ich arbeite, und fuhr vom Bahnhof Hardbrücke aus mit dem Velo zur Bäckeranlage, wo mein bester Freund seinen Geburtstag feierte. Es gab Kuchen, Prosecco und Bier.
Es war ein lauer Abend, wir sassen auf einer Decke im Gras. Dann wurde der Himmel dunkler, wir spürten erste Tropfen. Wir wechselten in die nahe gelegene Wohnung von Freund*innen. Es wurde kühl, aber wir standen dicht an dicht auf dem Balkon, und ich rauchte eine Parisienne Ciel nach der anderen.
Irgendwann redeten wir über die Ereignisse der vergangenen Tage. Wir sprachen über den Verfassungsgerichtsentscheid in den USA, über das Attentat in Oslo.
In den USA wurde am Donnerstag durch den Supreme Court entschieden, dass zukünftig jeder Bundesstaat selbst festlegen könne, ob Abtreibungen legal sind oder nicht. In mindestens dreizehn US-Staaten führt das sofort zu einem weitgehenden Abtreibungsverbot. Es wird erwartet, dass insgesamt etwa die Hälfte der US-Staaten die körperliche Selbstbestimmung von Schwangeren drastisch einschränkt. In Oslo wurden in der Nacht vom 25. Juni zwei Menschen in einem queeren Club erschossen, mehr als zwanzig durch die Schüsse verletzt.
Irgendwann während des Gesprächs lehnte ich mich an die Schulter meines besten Freundes und schloss kurz die Augen. Ich spürte eine Art von Traurigkeit, die sich körperlich manifestierte – mein Kopf begann wehzutun, ich fröstelte, der Regen tropfte auf meine Schultern und ich wurde müde, so, so müde.
Die Traurigkeit vermischte sich mit einem anderen Gefühl, einem warmen, heimeligen Gefühl. Ein wenig fühlte es sich an wie damals als Kind, wenn ich weinen musste und meine Mutter mich in den Arm nahm und etwas sagte wie: Du musst nicht traurig sein. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt wirklich traurig war.
Es gab keine andere Wahl und in dem Moment auch nichts anderes zu tun für mich, denn für Wut fehlte mir die Energie. Als ich mich verabschiedete, umarmte ich meine Freund*innen alle ein wenig länger als sonst.
Was tun gegen die Ohnmacht?
Am Montag scrollte ich mich durch Social Media, Online-Zeitungen, Blogs und Newsletter, die ich ab und zu lese, auf der Suche nach etwas, was mich nicht noch mehr deprimierte. Gleichzeitig sehnte ich mich nach einer Hilfestellung, einem Ansatzpunkt oder einer Handlungsanweisung.
Ich wollte wissen, was ich denken, fühlen, tun sollte, damit ich nicht so ohnmächtig und blödsinnig meinen Instafeed alle paar Sekunden neu lade und mit meiner Mitbewohnerin darüber rede, wie schlimm das alles ist.
Dabei stiess ich bei Autostraddle, einem queeren US-amerikanischen Online-Magazin, auf eine simple Überschrift, die lautete: We will protect each other. Ich dachte: Vielleicht ist das der einzige Gedanke, der einzige Vorsatz, den wir gerade fassen können.
Ich erinnerte mich an einen Song der Indie-Pop-Band MUNA, der mir in den Irren und Wirren meines Coming-Outs damals sehr geholfen hatte. Er heisst I know a place. Vor allem die Akustikversion bringt mich immer noch zum Weinen.
Der Song handelt von einer queeren Person, die eine andere an der Hand nimmt, tröstet und mit ihr tanzen geht, um sie von ihrem Schmerz und den Verletzungen, die sie erfahren hat, abzulenken. Der Song war als Pride-Hymne gedacht, bekam aber bereits 2016 im Kontext des homofeindlichen Attentats auf eine queere Latinx-Party in Orlando eine neue, existenzielle Bedeutung. MUNA singen: I know a place / I know a place we can go / Where everyone’s gonna lay down their weapon / Lay down their weapon.
Der Song ist zu einem der Pop-Kunstwerke geworden, zu denen man tanzen kann, obwohl oder gerade weil man traurig ist – etwas, worin die queere Community jahrzehntelange Übung hat. Man kann dazu tanzen, um die Hoffnung nicht zu verlieren.
Aufmerksamkeit, Interesse und eine Geldspende
Ich höre den Song gerade in Endlosschleife. Manchmal singe ich auch mit, vor dem Spiegel, wie ein Teeniemädchen, denn die haben die effektivsten Coping-Strategien – und müssen sie auch haben, in einer Welt, die es liebt, sie zu verspotten.
Wenn dann wieder ein klein wenig Hoffnung da ist, kann man auch etwas tun: Sich bei queeren Freund*innen erkundigen, wie es ihnen gerade geht. Sich um Menschen kümmern, die die Diskussion um Abtreibungsrechte direkt betrifft. Man kann auf eine Demo gehen. Oder ein Buch lesen.
Wenn man gerade ein bisschen etwas auf dem Konto hat, kann man auch spenden. Zum Beispiel für die noch junge Organisation Trans Safety Emergency Fund oder andere queere Netzwerke, die sich für die besonders Verletzlichen unter uns einsetzen: kleine Übersetzungsleistungen vom Gedanken, vom Gefühl des Gemeinsamen in Mikro-Handlungen.
They will try to tell you you’re not free, don’t listen, singen MUNA, I know a place where you don’t need protection, even if it’s only in my imagination. Diese Zeilen erfassen die Bedeutung einer gemeinsamen Fantasie, gemeinsamer Utopien und Träumereien gerade dann, wenn wir besonders verletzlich sind.
Durch unsere Imagination können wir nicht nur uns selbst, sondern auch anderen für Bruchteile von Momenten ein warmes Gefühl, einen Quadratzentimeter Sicherheit verschaffen. Indem wir klarmachen, dass wir beieinanderstehen, indem wir uns für einen Moment lang in einer gemeinsamen Welt wähnen – oder uns einfach ein bisschen länger als üblich umarmen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 10 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 780 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 350 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 170 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?