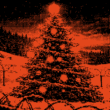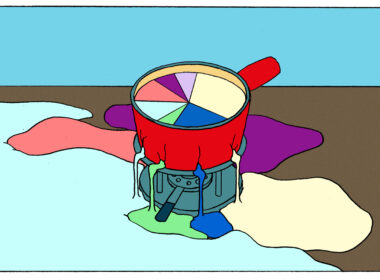2,4 Millionen Franken. So viel kassierte die SVP 2024 vom Bund. Das wären 40 Prozent ihres gesamten Budgets. Lebt ausgerechnet die Partei, die am lautesten gegen Bürokratie wettert, fast zur Hälfte vom Staat? Das zumindest vermitteln die Einkommenszahlen der Parteien im Bundeshaus 2024, gemäss dem offiziellen Register. Doch die Zahlen trügen.
Sogar die Eidgenössische Finanzkontrolle, als zuständige Stelle, erklärte kürzlich: Die Daten würden «kein Gesamtbild» der Budgets der Parteien ermöglichen. Die einzige Erkenntnis: «Parteien finanzieren sich unterschiedlich.» Seit der Einführung der Regeln zur Transparenz bei der Politikfinanzierung müssen die Parteien im Bundeshaus jährlich offenlegen, wie viel sie eingenommen haben, und wer ihre Grossspender*innen sind.
Doch das Gesetz hat Löcher. Es gilt nur für die nationalen Parteizentralen. Alles, das ausserhalb passiert, fällt nicht unter die Transparenzregeln: weder die Kantonalsektionen, noch ausgelagerte Komitees. Die Mitte kennt beispielsweise keine Mitgliederbeiträge auf nationaler Ebene, stattdessen «spenden» die Kantonalsektionen nach Bern.
Die Hauptsponsoren: Banken und Versicherungen
Wie also finanzierten sich die Parteien 2024? 8,2 Millionen nahm die SP 2024 ein – mehr als SVP und FDP zusammen. Doch nur drei Grossspender*innen tauchen bei der SP im Register auf: Krypto-Millionär Achim Schwander, die Raiffeisen und die Mobiliar. Der Rest? Über fünf Millionen an Kleinspenden unter dem Schwellenwert von 15’000 Franken, ab dem Spenden einzeln ausgewiesen werden müssen. Im Durchschnitt, so die SP auf Anfrage, waren es 69 Franken pro Spende.
Die SP lebt also von der Masse: Tausende kleine Spender*innen finanzieren die Partei. Auch die Grünen finanzieren sich ähnlich, ausser dass Sika-Erbin Carmita Burkard der Partei 400 Tausend Franken schenkte.
Ganz anders die bürgerlichen Parteien: Gemessen an der Grösse im Parlament weisen sie weniger Einnahmen aus, dafür umso mehr Grossspenden aus der Wirtschaft. Bei der SVP stammen 80 Prozent der offengelegten Spenden aus der Wirtschaft, bei Mitte und GLP zwei Drittel.
Besonders spendabel waren Banken und Versicherungen. Knapp drei Millionen oder 45 Prozent aller Parteispenden kamen 2024 allein aus diesen zwei Branchen. Spitzenreiterin war die UBS: Jeder siebte Spendenfranken stammte von der Grossbank. Aber auch die Pharmabranche, die Maschienenindustrie und sogar die Swiss hat 2024 die Politik unterstützt, jedoch ausschliesslich das bürgerliche Lager.
Die Angaben bleiben aber unvollständig. Denn was ausserhalb der Offenlegungspflichten passiert, wissen wir nicht.
Die versteckten Staatsgelder?
Doch ein Problem wäre lösbar. Die EFK räumt ein, dass das Bild auch unvollständig sei, weil die Fraktionsbeiträge fehlen. 7,5 Millionen überweist der Bund jährlich an die Fraktionen für deren Sekretariatskosten. Diese Zahlen sind auf Anfrage bei den Parlamentsdiensten verfügbar.
Fraktionsbeiträge bestehen aus einem Grundbetrag plus einem Beitrag pro Parlamentarier*in. Sie fliessen zwar an die Fraktionen, lassen sich bei gemischten Fraktionen aber über die Sitzanteile den Parteien zuordnen. Die EVP, als Juniorpartnerin der Mitte-Fraktion, stellte ihren Fraktionsbeitrag direkt zur Verfügung. Das Resultat: Ein Viertel aller Parteieinnahmen stammt vom Bund. Im internationalen Vergleich ist das nicht viel – wie der Vergleich zeigt. Bei der subventionskritischen SVP, der grössten Partei im Parlament, sind es stattliche 41 Prozent.
Nähme man die Einkommenszahlen für bare Münze, wäre die SP die reichste Partei der Schweiz. Und die SVP zu 40 Prozent staatsfinanziert. Doch das Gesetz ist zu schwach, um die wahren Längen der Spiesse zu zeigen. Die Zahlen, so wie sie jetzt sind, zeigen einzig: Die SP betreibt erfolgreich Politik-Crowdfunding während die bürgerlichen Parteien mehr auf Grossspenden von Banken, Versicherungen und Wirtschaftsverbänden setzen.
Das Bundesamt für Justiz evaluiert nun die Transparenzregeln. Ob es ebenfalls Handlungsbedarf sieht, um die Aussagekraft der Transparenzdaten zu stärken, wird sich zeigen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 8 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 676 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 280 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 136 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?