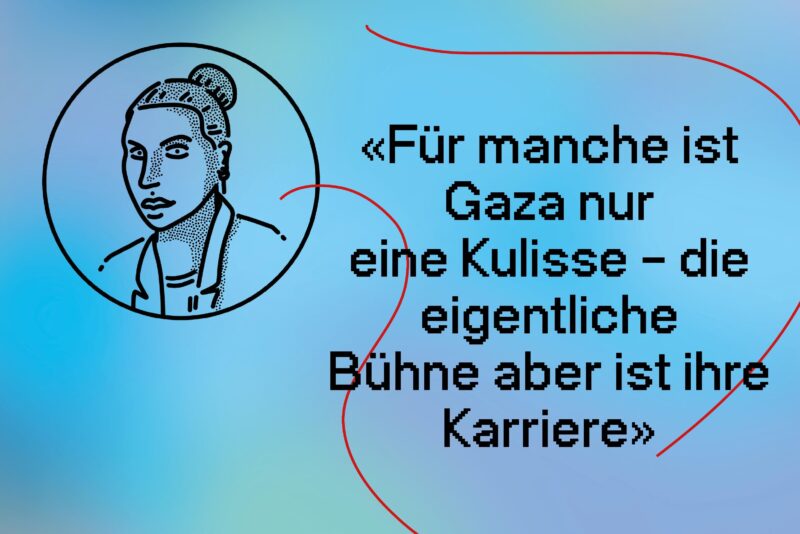Am 9. Oktober 2023 sprach Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant davon, den Gazastreifen vollständig abzuriegeln – «kein Strom, kein Wasser, kein Gas» – und bezeichnete Palästinenser*innen als «menschliche Tiere». Nur wenige Wochen später zeichnete sich bereits eine unverhältnismässig hohe Zahl ziviler Todesopfer für einen «ganz normalen» Krieg ab. Seitdem können wir täglich live mitverfolgen, wie Israel die ethnische Säuberung des Gazastreifens vorantreibt – in Wort und in Tat. Der vielleicht bestdokumentierteste Genozid jemals.
Während Teile der europäischen Linken schon früh von einem Völkermord sprachen, laut gegen die vom Westen unterstützte Vernichtung der Palästinenser*innen protestierten und damit nicht selten ihre körperliche und seelische Gesundheit sowie ihre finanzielle und soziale Existenz aufs Spiel setzten, blieben andere, die sich sonst lautstark gegen Rassismus, Faschismus und Krieg sowie für die sogenannte «Gerechtigkeit» und die Menschenrechte engagieren, auffallend still – im besten Fall. In der Regel nicht einmal das: Vielmehr trieben diese Leute, Parteien und Organisationen im Namen des Kampfes gegen «Antisemitismus» aktiv die Legitimierung des Völkermordes in Gaza und gleichzeitig die Kriminalisierung der Palästina-Solidarität hierzulande voran.
Genau diese Akteur*innen sind es nun auch, die zu merken scheinen, dass sich der sprichwörtliche Wind in der heimischen Gesellschaft dreht. Während sich die Brutalität des israelischen Krieges gegen die Bevölkerung Gazas nur insofern verändert hat, dass mit andauerndem Bombardement, Bodenoffensiven und Aushungern die Zahl der toten Palästinenser*innen immer weiter steigt, kann keine Rede davon sein, dass sich Zweck und Ausführung des israelischen Einsatzes in Gaza mit zunehmender Kriegsdauer ganz grundsätzlich gewandelt hätten.
Zwei Jahre Genozid lassen die Unterstützung Israels längst nicht mehr automatisch als moralisch oder wirtschaftlich vorteilhaft erscheinen.
Was sich in den zwei Jahren aber gewandelt hat: die (Zu-)Stimmung zu «Israels Militäreinsatz» in Gaza. Die Zahl der Menschen, die Israels Einsatz im Gazastreifen kritisch sehen und sich dagegen aussprechen, wächst. In Genf fand Ende September die grösste propalästinensische Demonstration seit 2023 statt, und sowohl in Wien als auch in Berlin versammelten sich in den letzten Wochen landesweit die mit Abstand meisten Menschen seit dem 7. Oktober 2023, um gegen das Schlachten in Gaza zu demonstrieren. Und Italien macht eh ernst: Nach der Kaperung der Global Sumud Flotilla durch das israelische Militär letzte Woche erlebte das Land tagelang beispiellose Proteste, die am Samstag in einer landesweiten Grossdemonstration in Rom mit bis zu einer Million Teilnehmenden kulminierten.
Angesichts der wachsenden Anzahl grausamer Rekorde, die dieser Genozid aufstellt, der andauernden Flut entsetzlichster Bilder und nicht zuletzt der regelmässigen Veröffentlichung neuer Studien, Gutachten und Analysen, die Israel einen Völkermord vorwerfen, lässt sich wohl immer schwieriger wegsehen – und noch von einer «angemessenen Reaktion» auf den Angriff der Hamas im Herbst 2023 sprechen.
Dass sich der Wind langsam dreht, merken auch jene Akteur*innen, die Israel zuvor als «einzigen sicheren Ort für Juden und Jüdinnen weltweit» ohne Wenn und Aber bei der Vernichtung ihrer Feinde unterstützt sehen wollten – und die im Namen eines radikal-philosemitischen Anti-Antisemitismus jede Muslima und erst recht jeden Palästinenser mit Argwohn betrachteten, stets auf der Suche nach der sagenumwobenen «Hamas-Fahne» im Jackett.
Genau so verhalten sich Menschen, die den Genozid weniger als Grausamkeit an Unzähligen begreifen, denn vielmehr als Material für ihre persönliche PR-Show.
Na endlich, könnte man – mit einer Mischung aus Erleichterung und Zynismus – ausrufen! Endlich sehen diese Leute hin, endlich hören sie auf, die offensichtlichen Tatsachen zu ignorieren.
Genau so empfinden es auch viele palästinasolidarische Menschen: Sie sind froh, dass bei immer mehr Menschen überhaupt ein Umdenken einsetzt – und zugleich ein bisschen genervt von jenen, die nicht aufhören den Spätzünder*innen der Erkenntnis unablässig vorzuhalten, dieses Umdenken sei längst überfällig gewesen. Verständlich – schliesslich ist ein grosses und breites pro-palästinensisches Bündnis seit zwei Jahren das hehre Ziel vieler Aktivist*innen!
Jemandem eine (späte) Meinungsänderung vorzuhalten, ist ohnehin billig und meist selbstgefällig. Ist doch super, wenn immer mehr Leute die wahre Realität israelischer Souveränität erkennen – genau das wollten wir doch erreichen! Darüber zu meckern entspringt oft einem eigenen Geltungsdrang – «ich habe es schon viel früher gewusst als ihr» – und ist als unsachliche Ablenkung schlicht zurückzuweisen. Egal wie spät, egal wie schmerzhaft – anfangen, selbst zu denken und nicht mehr bloss westlicher Propaganda den Mund zu reden, das ist erfreulich. Punkt.
Unterstütze unabhängigen Journalismus.
Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!
Nur: Die meisten Akteur*innen, die jetzt plötzlich laut werden, sind keine Privatpersonen, die (zum Glück!) ihre Meinung geändert haben. Nein. In aller Regel handelt es sich um politische Personen und Gruppen, die in der Öffentlichkeit stattfinden – und nach zwei Jahren aktiver oder stillschweigender Schützenhilfe für einen Genozid nun plötzlich in die Gegenrichtung blinken – weil sie spüren, dass sich das gesellschaftliche Klima langsam wandelt und sie sich folglich einen Vorteil aus einer anderen (oder zumindest: erweiterten) Positionierung versprechen.
Nicht, weil sie plötzlich zur Erkenntnis gelangt wären, sondern weil sie spüren, dass die Stimmung kippt und ein Völkermord durch Israel gar nicht mehr soooooo unwahrscheinlich ist. Weil es dann nämlich nicht mehr gut ankommt, bedingungslos hinter ethnischer Säuberung zu stehen. Weil zwei Jahre Genozid die Unterstützung Israels längst nicht mehr automatisch als moralisch oder wirtschaftlich vorteilhaft erscheinen lassen.
Weil sie Selbstdarstellende sind, für die Gaza nur Kulisse ist – die eigentliche Bühne aber ihre eigene Karriere oder der Vorteil, den sie aus ihrer Inszenierung ziehen. In Wahrheit geht es ihnen nämlich um sich selbst. Wenn linke Influencer*innen endlich von einem Genozid sprechen, steht dabei dann folgerichtig auch weniger das Grauen in Gaza und die Frage nach Verantwortung im Zentrum – sondern vor allem eigene Befindlichkeiten (und das kleine Wörtchen «Ich»).
Was nützt einer Sache eine Gefolgschaft aus Schafen, die flieht, sobald sie nicht mehr direkt von ihr profitiert?
Während viele Journalist*innen weiterhin Verteidigungen des israelischen Staatsprojekts und seiner Durchsetzung publizieren, beginnen manche von ihnen bereits vorsichtig, auch in die andere Richtung zu blinken – für den Fall, dass sich bald herausstellen sollte, dass «am Ende ohnehin alle immer schon dagegen waren». So hat man die eigene Positionskorrektur wenigstens rechtzeitig medienverträglich eingeleitet. Genau so verhalten sich Menschen, die den Genozid weniger als Grausamkeit an Unzähligen begreifen, denn vielmehr als Material für ihre persönliche PR-Show.
Damit auch sie in einigen Jahren werden sagen können: Ich war gegen diesen Genozid. Folglich bin ich ein guter Mensch (oder eine moralische integre, linke Partei, die zur Herrschaft ermächtigt werden will) und verdiene eure Anerkennung und Achtung.
Wenn es schon wieder und weiterhin nicht um die Opfer und Täter des Völkermords gehen wird, nicht um die Ursachen in der Verfasstheit des israelischen Staatsprojekts und die Dinge, die man daraus lernen könnte – sondern stattdessen um gefühlte Betroffenheiten und eine möglichst bequeme Vergangenheitsbewältigung leidender, weisser Westler.
Übrigens: Ich habe keine Ahnung, wie man mit diesen Menschenrechts-Karrierist*innen umgeht. Es ist mir auch egal; ich gehe schliesslich gar nicht mit ihnen um. Ich schreibe diesen Text auch nicht, um Spaltungen zu säen – im Gegenteil: Ich freue mich über alle, die für Palästina aufstehen.
Doch man kann man schon mal fragen, was dieses Aufstehen bedeutet, wenn es erst dann geschieht, sobald der moralische Mut karriereverträglich geworden ist. Was nützt einer Sache eine Gefolgschaft aus Schafen, die flieht, sobald sie nicht mehr direkt von ihr profitiert?
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 8 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 676 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 280 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 136 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?