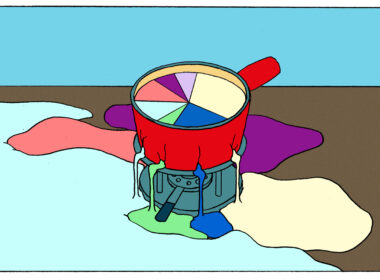Fotos von Stanislav Krupar
Der Krieg um Berg-Karabach hat die Region auf ihren Rumpf reduziert, das Mutterland Armenien ist seither von politischen Unruhen zerrissen. Im siegreichen Aserbaidschan feiern die Regierung, das Volk und der türkische Präsident Erdogan ihren Triumph. Auf jeder Seite hat es nach offiziellen Angaben fast 3’000 Tote gegeben. Zehntausende von Menschen wurden heimatlos.
Es war ein Krieg der vielen Wahrheiten und jede von ihnen war unterwandert von Lügen, Hass und Selbstgerechtigkeit. Die Brille der jeweiligen Propaganda war nicht rosarot, sie war dunkel von der Verachtung für die anderen, von dem Schmerz unbezahlter Rechnungen, beschlagen vom Atemdunst der Grossspurigkeit. Die Toten der Vergangenheit stiegen aus ihren Gräbern, die Verletzungen, die Verluste eines ganzen Jahrhunderts krochen aus ihren Schatten. Die Lügen verbanden sich mit dem Nationalismus, der Nationalismus sich mit Hass, der Hass sich mit dem Tod.
Dieser Krieg wurde nicht nur mit neuen, in ihrer Zerstörungskraft entsetzlichen Waffen gekämpft, sondern auch, vielleicht sogar vor allem, mit der Macht des Internets. Es wurde gehetzt, diffamiert, manipuliert. Kriegsverbrechen, für deren Beweis man bislang Zeugen und Spuren brauchte, wurden gefilmt und öffentlich auf Telegram und Twitter ausgestellt. Die Ermordung eines alten armenischen Mannes, die Enthauptung eines armenischen Soldaten, das Erstechen eines aserbaidschanischen Soldaten. Diese Videos werden bleiben als Beweis der Missachtung von Kriegsregeln. Doch ob diese je geahndet wird, ob den Toten und ihren Hinterbliebenen Gerechtigkeit widerfahren wird, ist zweifelhaft.
Dieser Krieg wäre nicht möglich gewesen ohne den Ölreichtum, der Aserbaidschan die Möglichkeit gab, hocheffiziente Waffen zu kaufen, und ohne die Unterstützung der Türkei und die Tatenlosigkeit der EU. Aber er hätte auch keine 44 Tage gedauert ohne die unbedingte Opferbereitschaft der armenischen Soldaten und ihre an Realitätsverleugnung grenzende Überzeugung, unbesiegbar zu sein. Er wäre zu verhindern gewesen, wenn die Option, die Region und ihre weiten Landflächen, ihre Schönheit und Fruchtbarkeit zu teilen, die Politik und die Gedanken der Menschen bestimmt hätte.
Stanislav Krupar und ich waren während des Krieges im Land und dann wieder zwei Wochen nach der Kapitulation. Die Kluft zwischen der Siegespropaganda aus Yerewan und der Realität einer Region unter Beschuss war gross. Luftangriffe, Todesmeldungen, leergefegte Strassen, verängstigte Menschen in düsteren Kellern, verzweifelte Mütter, deren Söhne an der Front kämpften und sich seit Tagen nicht gemeldet hatten, Eltern, die ihre 18-Jährigen begruben.
Die Nachkriegszeit ist ein ganz eigener Albtraum für die Bevölkerung. Alles ist verloren: Land, Heimat, Häuser, Wälder, Berge. Die Opfer, die man im Krieg zu bringen noch bereit war, scheinen nun umsonst, aus dem Rausch wurde eine Depression. Diejenigen, die gestern noch heldenhafte Soldaten waren, sind heute verloren, ohne Arbeit, ohne Geld und vielen scheint es: auch ohne Ehre. Mancher von ihnen ertränkt die Schmach im Alkohol oder phantasiert von Rache.
Es dauerte lange, bis die Toten geborgen sind. Noch heute werden viele vermisst und werden es wohl bleiben, weil von ihnen nichts Identifizierbares mehr übrig ist. Dort, wo die Schlachten stattfanden, liegen über viele Kilometer ausgebrannte Panzer und Armeefahrzeuge, Rucksäcke, Schlafsäcke, Socken, Helme, verbogene Gewehre und schusssichere Westen. In einigen steckt noch ein Rumpf; Arme, Beine, Köpfe, Eingeweide sind verstreut.
Ob der Krieg um Karabach wirklich vorbei ist, weiss niemand. Im Dezember wurde der Waffenstillstand gebrochen. Beide Seiten beschuldigten das Gegenüber. Es ist möglich, dass unter den jungen Männern Berg-Karabachs solche sind, die Vergeltung wollen, die den Waffenstillstand als Verrat empfinden und sich von der Regierung betrogen und verkauft fühlen. Weiter zu kämpfen, zu töten, ist nicht schwer.
Dichter der Vernichtung, Jamal Tadevosian, Stepanakert
Der Krieg ist ein Zustand, der sich Worten und Bildern entzieht. Man kann ihm Augenblicke abringen, doch alle Bilder, alle Worte zusammen erfassen nicht die dingliche und seelische Vernichtung. Auf Hunderten von Seiten, in Tausenden von Zeilen hat Jamal Tadevosian, 83-jährig, dieser Vernichtung nachgespürt. Seit er als junger Mann begann, Gedichte zu schreiben, hat er den Krieg mal als Verteidigung der Heimat gepriesen, mal als Totengräber der Menschlichkeit verflucht. Als im September das Haus der Familie von einer Rakete getroffen wurde, schrieb Tadevosian ein Gedicht über den Wind, der unbarmherzig nun dort weht, wo vorher schützende Mauern standen.

Blinde Augen, Lusik Vanjan, Stepanakert
Als eine Rakete ihr Haus traf, lag Lusik Vanjan, 89 Jahre alt und seit vielen Jahren blind, in ihrem Bett. Niemand weiss, wie sie überlebte. Auch nicht, wie lange es dauerte, bis jemand auf der Strasse ihre brüchigen Hilferufe hörte. Man kann Lusik nicht mehr fragen, denn die Detonation nahm ihr das Hörvermögen. Nach ihrer Rettung sass sie die verbleibenden Wochen des Kriegs in einem Keller, den sie nicht sehen konnte und stellte weinend Fragen nach ihrem Zuhause, ohne die Antworten hören zu können. Die Summe der Nachrichten von Kriegen und Katastrophen, die diese Welt erschüttern, überfordert unser Empathievermögen, die Komplexität der Konflikte verwischt die Linie zwischen Täter und Opfer.
Die Propaganda, die beide Kriegsparteien mit den Bildern der Opfer verbreiteten, machte es auch für uns unmöglich, zu wissen, was Wahrheit und was Lüge war. Und doch gab es Begegnungen wie diese, die zeigten, dass es egal ist, welche Seite angefangen hat und aus welchem Grund ein Krieg geführt wird – am Ende ist er ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Armenischer Soldat mit Hund, Martuni
Die, die nun die Frontlinie bewachen, jene bislang nur auf dem Papier festgesetzten Grenzen, sind junge Männer, kaum der Kindheit entwachsen. Nur wenige Hundert Meter von ihnen entfernt stehen junge Soldaten der aserbaidschanischen Armee. In einer anderen Zeit, unter anderen Bedingungen, würden sie ihre Zigaretten und vielleicht ihre Lebensträume teilen. In dieser Zeit hat man ihnen gesagt, die anderen seien die Feinde, sei weniger wert als sie. Nur der Hund, den jemand bei der Flucht zurückgelassen hatte, interessiert sich weder für die Feindbilder noch für die Grenzen. Er wandert von einer Seite zur anderen und lässt sich von jeder Hand streicheln.

Verloren im Frieden, Martuni
„Wahre Männer tun alles, um ihr Vaterland zu verteidigen” — mit solchem Männerbild beorderte die armenische Regierung im Krieg um Karabach nicht nur junge Wehrpflichtige an die Front, sie rekrutierte auch Tausende von Freiwilligen, die ihre altertümlichen Kalaschnikows aus dem Schrank nahmen und loszogen gegen eine Gegenpartei, die hochmoderne Waffen einsetzte. In den 44 Tagen des Krieges hörte man immer wieder diesen Satz: Wir werden bis zum Letzten kämpfen. Gemeint war nicht bis zum Sieg. Gemeint war bis zum Tod.
Als die Kämpfe vorbei waren, war es die Sehnsucht danach, Opfer zu bringen, lange nicht. Die Schmach der Niederlage, die Langeweile der Nachkriegszeit, das Gefühl, versagt zu haben – sie halten die Kriegsrhetorik weiter am Leben. Dieser junge Mann, der als Freiwilliger in den Krieg zog, steht Wochen nach Kriegsende weiterhin dort, wo die Front verlief. Nicht, weil er muss. Sondern weil er mit dem Frieden nichts anzufangen weiss.

Brandstiftung und Plünderung, Kalbajar
Am letzten Tag vor der Übergabe der Region Kalbajar an Aserbaidschan stehen die meisten Häuser in Flammen, angezündet von ihren Bewohner*innen. Plündernde fahren durch die Dörfer und rauben, was ihnen noch Geld einbringen kann: Kupferteile, Maschendraht, Wellblech. In den Gärten sind die Bäume gefällt, die Gemüsepflanzen ausgerissen, selbst die letzten Kartoffeln wurden ausgegraben und verbrannt.
Die Logik des Hasses verbietet es, den Feinden zu überlassen, was einem lieb und teuer ist. Die Zerstörung dessen, was den anderen nun in die Hände fällt, mag die Demütigung der Besiegten abschwächen, doch sie entwertet auch den Sieg. 26 Jahre zuvor waren aus dieser Region die Aserbaidschaner*innen geflohen, auch sie hatten ihre Häuser angezündet, auch sie hatten Heimat und Wurzeln verloren. Es gehört zu den Seltsamkeiten von Kriegen, dass man den anderen antut, woran das eigene Herz bricht. Im Höllenkreis der Gewalt gibt es keine gemeinsame Erfahrung des Leids, doch in der Niederlage der Geschlagenen und im Triumph des Sieges liegt dieselbe Verlorenheit.

Seelentränen, Martin Dschalumjan, Kalbajar
Martins Verständnis von Männlichkeit erlaubt keine Tränen. Ein Mann weine nur in seiner Seele. Als wir ihn trafen, blieben ihm wenige Stunden, um die Marmortreppen, die Fenster, die Holzdielen in seinem Haus zu entfernen, die letzten Habseligkeiten auf einen Laster zu laden und für immer Abschied zu nehmen von dem, was 35 Jahre lang seine Heimat gewesen war.
Eine Stadt, malerisch an Hängen gelegen, dahinter die Gipfel eines Gebirgszugs. Granatapfel- und Birnenbäume in den Gärten, Rosenstöcke an den Häuserwänden. An diesem Tag stehen dunkle Rauchwolken über den brennenden Häusern, Fensterscheiben zerbersten, Dachstühle brechen krachend ein. Nur die Männer sind noch geblieben. Rauchend, fluchend verladen sie, was sie noch retten wollen.
Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen, sagt Martin, bevor die Sonne hinter den Bergen versinkt und sie fahren müssen. „Wir holen uns alles Verlorene wieder.“ Und wenn nicht er, dann seine Söhne. Hilft es den Geschlagenen, auf Rache zu sinnen? Werden die Aserbaidschaner*innen, die man vor 26 Jahren aus Kalbajar vertrieb, zurückkehren und dann ebenso gleichgültig auf die zerfallenden Häuser der Armenier*innen blicken, wie diese es umgekehrt taten?

Letzte Gebete, Dadiwank, Kalbajar
Die Bilder der letzten Gottesdienste, die im Kloster Dadiwank abgehalten wurden, gingen um die Welt, zusammen mit dem dramatischen Appell, die Zerstörung des Bauwerks zu verhindern. Während im Kloster die letzten Hochzeiten gefeiert, die letzten Gebete gesprochen, die letzten Kerzen entzündet wurden, fuhren draussen russische Panzer vor und russische Soldaten, die künftig das Kloster schützen sollen, schlenderten rauchend um die alten Mauern.
Wieder war die Macht der Bilder – die weinenden Gläubigen, die festlichen Brautpaare, die Kriegsfahrzeuge – so überwältigend, dass von der möglichen Zerstörung des Klosters durch das siegreiche Aserbaidschan berichtet wurde wie von einer unumstösslichen Tatsache, und von Dadiwank wie von einem Bauwerk, dessen Entstehung und Ursprung allein im Christentum begründet liegt. Im Fundament des jahrhundertealten Hauses steht der Satz: Alles unseres, denn wir waren als erste hier.

Der Friedensprediger, Georgi Vanyan, Goris, Armenien
In einem anderen, glücklichen, aber schweigendem Leben war er Direktor des Theaters in Yerewan. Dann begann Georgi Vanyan sich gegen Hass, Nationalismus, Überlegenheitspropaganda und Feindbilder auszusprechen. Er dachte, er habe eine Mehrheit auf seiner Seite und Frieden sei möglich, wenn die Völker des Kaukasus nur in einen Dialog miteinander treten würden. Erst wurde er entlassen, dann beschimpft, dann bedroht. Er floh aufs Land, doch auch dort fand er keine Ruhe. Jemand zerstörte seinen Garten, jemand tötete seinen Hund. Dann kam der Krieg um Karabach und Georgi Vanyan schlief nicht mehr und rauchte Kette. Als der Krieg verloren war, twitterte Vanyan: „Der Berg kreiste und gebar eine Maus.“

Bedzor, Latschin-Korridor
Die einzige Strasse, die von der Rumpfrepublik Berg-Karabach noch ins armenische Mutterland führt, verläuft durch den Latschin-Korridor, eine fünf Kilometer breite Sonderstatuszone, die nun von russischen Soldaten beschützt wird. Viele Tage lang war unklar, ob die Bewohner*innen der in diesem Korridor liegenden Städte und Dörfer bleiben dürfen.
Am Ende mussten sie ebenso wie die Bewohner*innen von über 100 anderen Dörfern und Städten ihre Häuser räumen. Die Verzweiflung in den letzten Tagen war gross, denn niemand war darauf vorbereitet, den Bewohner*innen fehlten Transportmöglichkeiten, Benzin, sie wussten nicht, wohin sie nun gehen sollten. Die Mitarbeitenden der Militärverwaltung von Bedzor verbrannten Akten im Garten, der beissende Rauch der Plastikordner stand über dem Gebäude und mischte sich mit dem ersten Schnee des Jahres.

Familienfoto am Savavan-Mountain-Pass, Armenien
Das ikonische Foto des Karabach-Kriegs schoss ein Reuters-Fotograf. Es ist die Aufnahme eines Soldaten am Geschütz, das Gesicht geschwärzt vom Russ, hinter ihm eine gelblodernde Feuerwand. Das Bild ist so makaber ästhetisch wie schrecklich faszinierend. Man kann die Hitze des Feuers spüren, die Kraft erahnen, die es kostet, dieser Hitze standzuhalten, mit ein wenig Phantasie den Schweiss und den Schmutz eines Lebens an der Front wahrnehmen. Einem Soldaten, der solchem standhält, wünscht man eine glückliche Heimkehr und Heldenehre.
In Armenien warb man mit diesem Foto für Freiwillige, es hing überall im Land, auch dann noch, als der Mann auf dem Bild schon unter der Erde lag. Er soll wenige Tage nach der Aufnahme gefallen sein, einer von mindestens 3’000 Soldaten, die Armenien verlor. Die Werbetafel am Savavan-Mountain-Pass war in den Tagen des Krieges ein beliebter Hintergrund für Familienfotos. Hier posiert der 11-jährige Gor Ayrepetyna für seinen Vater.

Salut für die toten Soldaten, Ararat Balayan, Militärfriedhof Yerablur, Yerewan
Krieg folgt stets der Überzeugung, er sei das einzige Mittel der Konfliktlösung. 26 Jahre lang hatten Armenien und Aserbaidschan Zeit, eine andere Lösung in der Karabach-Frage als Gewalt zu finden. Wer wann und warum welche Chancen vertan hatte, darüber mögen die Historiker*innen entscheiden. Und auch darüber, ob Verzweiflung oder Grössenwahn der Grund war, der die armenische Regierung und die Menschen von Karabach bis zum Ende glauben liess, sie könnten diesen Krieg gewinnen.
Viele junge Männer haben für diese Fehleinschätzung bezahlt. Und noch bevor die letzten Toten unter der Erde sind, werden neue Krieger grossgezogen. Der 8‑jährige Ararat möchte auf alle Fälle auch Soldat werden. „Wer glaubt, der Krieg liesse sich abschaffen?“, fragte einmal die Schriftstellerin Susan Sontag und gab gleich die Antwort: „Niemand. Nicht einmal die Pazifisten.“

Reine Verwaltungssache, Yerewan
Für uns, die wir von aussen kommen, haben die Toten als Menschen keine Bedeutung, die Verluste drücken wir in Zahlen aus. In den Medien gilt die Regel: je mehr Tote, desto wichtiger die Nachricht. Manchmal geben wir auch unbedeutenden Toten einen Namen, erzählen ihr Schicksal. Dann, wenn ihr Tod besonders heroisch war oder stellvertretend steht für all die anderen Gestorbenen.
Doch in den Tagen des Krieges, als die Krankenhäuser in Yerewan überfüllt waren mit Schwerverwundeten, mit Männern, denen die Beine und die Arme fehlten, deren Körper schwer verbrannt waren, als es nicht genügend Betten, genügend Ärzt*innen gab, wurde auch dort der Tod zu einer reinen Verwaltungssache. Wichtig war, die Angehörigen so bald wie möglich zu benachrichtigen, so schnell wie möglich neue Gräber auszuheben. Tod, Beerdigung, Trauer verliefen im Eiltempo, gehetzt vom Nachschub der nächsten Toten.