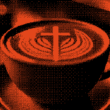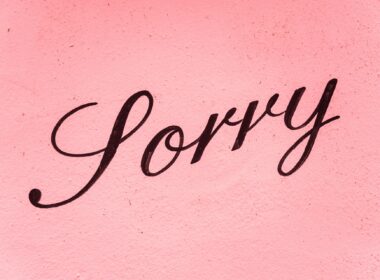Ende Februar töteten am gleichen Tag zwei Männer jeweils eine Frau: In Buchs SG verletzte der Täter eine 22-Jährige so schwer, dass sie starb. Und in Wilchingen SH erstach ein junger Mann seine 80-jährige Grossmutter. Unter anderem 20 Minuten, der Tages-Anzeiger und die NZZ titelten jeweils in einer ersten Version: „22-Jährige stirbt nach Streit mit Freund (24)” und „Schwerverletzte Frau stirbt in Wilchingen SH”. Die Frauen starben aber nicht wegen eines Streits – sie wurden von Männern getötet. Dies herauszustreichen, ist wichtig und wird noch immer zu wenig praktiziert.
Wird eine Frau getötet, weil sie eine Frau ist, spricht man von einem Femizid. Ein weit gefasster Begriff, der erstmals von feministischen Strömungen in den 90ern aufgebracht wurde – insbesondere von einer Bewegung gegen Gewalt an Frauen in Lateinamerika, die den Begriff „Feminicidio” geprägt hat. Femizid schliesst unter anderem mit ein, dass Frauen weltweit ein höheres Risiko tragen, Opfer von Gewalt durch Männer zu werden als umgekehrt. Etwa, weil sie aufgrund ökonomischer oder emotionaler Abhängigkeit eher in missbräuchlichen Beziehungen sind als Männer – und weil die gesellschaftlich akzeptierten Arten für Männer, mit Konflikten umzugehen, noch immer von Gewalt geprägt sind. Gewalt gegen Frauen.
Will eine Frau eine solche Beziehung verlassen, wird es schwierig. Oft glaubt oder hilft ihr nicht einmal die Polizei, wie die deutsche Autorin Antje Joel in ihrem Buch Prügel eindrücklich beschreibt. Und in der Schweiz sind die Frauenhäuser konstant überlastet und unterfinanziert – dafür mitverantwortlich ist übrigens unter anderem die Partei, die sich kürzlich im Rahmen einer Initiative einmal mehr scheinheilig für Frauenrechte einsetzte und die Ratifizierung der „Istanbul-Konvention zum Schutz von Mädchen und Frauen vor Gewalt“ blockiert hat – aber das ist eine andere Geschichte.
Antje Joel überlebte zwei gewalttätige Ehen. Viele Frauen sterben aber durch die Hand ihrer Ehemänner: Jede Woche versucht ein Mann in der Schweiz, seine Partnerin umzubringen, schreibt die Recherchegruppe von Stopfemizid.ch, im Kanton Zürich rückt die Polizei im Schnitt fünfzehnmal pro Tag aus wegen häuslicher Gewalt. Fünfzehnmal. Nicht erfasst sind hier die Fälle, die gar nicht erst der Polizei gemeldet werden. Und dennoch: In den hiesigen Medien wird der Ausdruck „Femizid” erst sehr spärlich verwendet. Einerseits verlangt die journalistische Sorgfalt von uns, ein Tötungsdelikt nicht als Mord zu bezeichnen, solange die juristische Sachlage nicht geklärt ist. Andererseits sind viele Redaktionsmitglieder noch nicht auf die Thematik Gewalt an Frauen sensibilisiert. Denn wie noch immer zu einem grossen Teil über Gewalt an Frauen berichtet wird, ist gefährlich.
Sprache ist mächtig. Sie beeinflusst unsere Wahrnehmung von Geschehnissen und es gehört zur journalistischen Sorgfalt, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein. Zwar benutzen viele hiesige Medien den Ausdruck „Femizid” vereinzelt schon länger, sogar die NZZ. Die reisserischen, lauten Überschriften aber bleiben meist heikles Terrain. In der Headline „22-Jährige stirbt nach Streit” ist allein die Frau sichtbar, der Täter verschwindet. Man macht die Frau sprachlich zum aktiven Subjekt, dabei ist sie das Opfer, sie wurde getötet. Auch die schwerverletzte Frau in Wilchingen steht alleine in der Überschrift. Der Mann, der sie tötete, ist nicht vorhanden.
In der Berichterstattung über Gewalt an Frauen wird das Opfer immer wieder als Clickbait missbraucht, die Tötung wird banalisiert oder man schiebt gar der Frau (unbewusst oder gezielt) die Schuld am eigenen Tod zu: „Familiendrama” heisst es dann, „Eifersuchtsdrama“ ist ein weiterer beliebter Euphemismus, oder es wird gefragt, warum die Frau wohl sterben „musste”. Bloss: Tötet ein Mann seine Partnerin, hat das nie etwas mit Liebe oder der Familie zu tun – sondern immer mit Macht. Liest man solche Artikel über Gewalt an Frauen weiter, stellt man allerdings oft fest: Die Frau ist im Lauftext plötzlich nirgends mehr zu finden. Dafür aber etwa die Herkunft des Täters oder mögliche Motivationen, zuweilen gar Entschuldigungen, für seine Tat.
Natürlich, man will verstehen, warum ein Mann seine Partnerin tötet. Was dabei aber verloren geht, ist die Möglichkeit, die Tat strukturell einzuordnen: Gewalt an Frauen ist nie ein Einzelfall, sondern wird durch ein patriarchales System geschützt und vorangetrieben. Dass etwa bezüglich gesellschaftlicher Sensibilisierung auf Sexismus auf politischer Ebene weggeschaut wird oder es in der Schweiz noch immer keine national geregelte Strategie gegen Gewalt an Frauen gibt, ist Teil davon.
Immerhin: Nachdem verschiedene Feministinnen und Expertinnen auf Social Media letzte Woche auf die unsensiblen Headlines aufmerksam gemacht hatten – übrigens wieder einmal unbezahlte Arbeit von Frauen, Männer äusserten sich kaum dazu – wurden die Titel angepasst. Der Tages-Anzeiger setzte in der Onlineversion sogar „Femizid” in die Spitzmarke . Offenbar hat 20min zudem eine eigene Taskforce für Gender-Anliegen gegründet. Das scheint Wirkung zu zeigen: Seit Kurzem wird etwa auf 20min.ch der Ausdruck „Femizid” immer häufiger eingesetzt, man berichtet über Demo-Aktionen und lässt eine Expertin den Hintergrund des Ausdrucks erklären. Es bleibt zu hoffen, dass andere Medien konsequent nachziehen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 11 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 832 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 385 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 187 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?