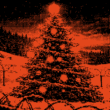Daif trägt seinen Schal um den Kopf und tigert in nervösem Stechschritt durch das Kulturlokal Coq d’Or in Olten. Es ist kurz vor dem ersten Lockdown 2020, kurz vor seinem Auftritt, kurz nach der Lesung der Autorin Jessica Jurassica. Als Daif die Bühne betritt, zieht er seinen Schal aus und beginnt über die Beats von DJ Yung Porno Büsi zu singen. In exzessivem Auto-Tune gebadet dringen seine Verse über das Mikro durch die Boxen in den Konzertsaal:
„Zünd de Club ah
Zünd die Szene ah
Zünd das Land ah
Zünd das alles ah”
(Zünd de Club ah, Molly und Speed, 2019)
Wie es um politische Inhalte oder Ziele in der Kunst und im Speziellen im Schweizer Cloud-Rap steht, wollte die Kulturredaktion von Das Lamm ein Jahr später inmitten des zweiten Lockdowns vom Frauenfelder Rapper wissen und verabredete sich mit ihm in seinem Bandkeller in der Ostschweizer Kleinstadt. Doch schnell wird klar, dass der „cloud avant garde love it boy sponsored by rich secco” nichts mit solchen Metafragen anfangen kann.
Denn Meta ist Hochkultur und Hochkultur ist bourgeois. Kunsthochschulen sind Yuppie-Dörfer, Daif ist dem Jetzt verpflichtet. Punk gegen die Schweiz. Anti-Anti. Brandstifter. Sensibler cis-Mann.
Daif interessiert sich nicht für abstrakte Fragen zu Kunst und ihrem Zweck. Der exmatrikulierte Philosophiestudent verschreibt sich stattdessen der konkreten Gegenwart und ihrer Unberechenbarkeit. In seinem Bandkeller, den er sich mit drei anderen Musiker:innen teilt, versucht er auch während der Pandemie den zügellosen Jetzt-Kult zu zelebrieren.
Zwischen Tüten mit leeren Bierflaschen und einem klebrigen roten Ledersofa, überquellenden Aschenbechern und Stromkabelnetzen hat sich der Musiker eingerichtet. Als Tontechniker, Musikproduzent und Songwriter verbringt er seine Zeit momentan vor allem mit Auftragsarbeiten. Daneben – oder dazwischen – schleift er an seinem neuen Album.
Daifs Refugium liegt unter dem Boden eines thurgauischen Kleinstädtchens, dem Ort, an dem auch alljährlich das grösste Hip-Hop-Festival Europas stattfindet. Der Raum strotzt vor Abriss-Ästhetik. Er strahlt Eskapismus aus, Subversion, Isolation, ist eine Absage an Anstand und Bürgerlichkeit.
Hier passieren Musik- und Textproduktion, „en Figg druf geh” und „Radikal si”, Trash und Depression. Ein Triebwerk für Sensibilität und Kompromisslosigkeit. Für low und high.
„Verzell mol no meh vo dere YOLO-Kultur
Stadtbeamte, Journi-Huso
Verzell mol no meh vo Ironie und so
Kunststudent, Vollidiot”
(E Handpoked-Tattoo und es Adidas-Jäckli, Molly und Speed, 2019)
Bei aller Verweigerung gegen kulturwissenschaftliche Überordnung kommt man bei Daif dennoch nicht um eine Metafrage herum:
Können Künstler:in und Werk voneinander getrennt werden?
„Für die Psychohygiene wäre das sehr praktisch”, sagt Daif und dreht sich innerhalb von zwanzig Sekunden eine Zigarette. „Wenn ich Daif und Dave auseinanderhalten könnte, wäre Musik ein Job. Dann könnte ich Feierabend machen. Doch das ist so wenig existent wie im News-Journalismus.”
Der News-Journalismus war es, der David Nägeli 2018 dazu bewegte, Daif ins Leben zu rufen. Die schlechten Erfahrungen, die er mit dem Grossverlagsmedium machte, für das er arbeitete, musste er irgendwie verarbeiten. „Ich musste etwas tun, weil mich sehr viele Dinge sehr fest frustriert haben. Ich habe ein Ventil gebraucht, also habe ich acht Songs innerhalb von zwei Wochen gemacht.” Dass er als cis-Mann einem Verlag zudiente, in dem Sexismus, Mackertum und unternehmerischer Karrierismus zur Tagesordnung gehören, damit konnte er nicht umgehen.
Etwas unbehaglich auf dem roten Sofa im Bandkeller sitzend nimmt Daif einen Schluck aus seiner Tell-Bierflasche, bearbeitet seine Fingernägel und grübelt in sich gekehrt nach Worten. Er erzählt, wie ihm die Musik damals geholfen habe, seine psychischen Probleme und Depressionen einzuordnen und zu verarbeiten. Bis heute handeln seine Songs vor allem davon. Daifs Musik ist der Versuch, Sensibilität und psychische Fragilität in lyrische Ästhetik umzuwandeln. Er sucht Schönheit in der Schwermut.
„Schriibe gege s Liide,
Ziile um Ziile
Nume zum dra zwiifle
Schriibe gege d Truur
Dergege z verschwiige
Was me Schiss macht als de Tod”
(Wie e Flugi, Molly und Speed, 2019)
Er sei damals gefangen gewesen in einem Umfeld von im „Hippie-Rock hängengebliebenen Menschen”. Davon habe er sich durch die Musik emanzipieren können. Die Berner Band Jeans for Jesus bestärkte ihn in seiner Liebe zur Popmusik und gab ihm den Mut und die Motivation, neue musikalische Stile umzusetzen. Auch Cloud-Rap-Geschichten haben Daif inspiriert: Yung Lean, Money Boy, Yung Hurn und so weiter. In der Schweiz unter anderem das Rap-Duo Göldin & Bit-Tuner. „Inhaltlich ist vieles davon schwierig, natürlich. Aber wichtig, um aufzuzeigen, dass solche Musik funktioniert.”
Daif tut sich schwer damit, sich mit den Menschen hinter dieser Musik zu identifizieren. Wahrscheinlich weil es allesamt Macker-cis-Männer mit grossem Ego sind und sich Daif gegen toxische Männlichkeit zur Wehr setzen will. Einerseits indem er, der als cis-Mann gelesen wird, sein eigenes Verhalten reflektiert, andererseits indem er keinen Content von homosozial agierenden cis-Männern verbreitet. „Ich kann keine Songs von Arschlöchern hören”, meint er. Trotz dieses Widerspruchs habe er von ihrem Stil die Gewissheit mitgenommen, Musik gegen den Strich machen zu wollen. In seinem Fall:
Melancholischer Kitsch, Trash, sehr viel Auto-Tune.
Hate, Feuilleton, Love
Gurgelt Auto-Tune in der Schweiz anders als sonst wo?
„Auto-Tune ist Punk. Mit Auto-Tune und Hall geht alles sehr einfach. Du brauchst kaum Skills, kein Talent, sondern kannst einfach machen”, sagt er und ist sich dabei bewusst, dass übertriebener Einsatz von Auto-Tune einen Song auch unzugänglich machen kann. „Aber es ist dermassen fest Teil meiner Musik, weil ich es viel zu geil finde. Ich finde es auch geil, wenn es jemanden stört. Ich denke dann: Das ist jetzt nicht das Neuste. Lass dich doch drauf ein.”
Auto-Tune spaltet heute noch die Geister der Schweizer Musikszene. Das verwundert, schliesslich ist er in der internationalen Musikindustrie zur Norm geworden. „Die Schweiz hinkt dem popkulturellen Trend hinterher“, sagt Daif.
So stosse er auch im Rap oft auf Stimmen, die gegen „neue” Stilformen ihre kritische Stimme erheben: „Negatives Feedback kommt meistens von einem klassischeren Hip-Hop-Publikum, das sich am Auto-Tune stört. Realkeeper-Arschlöcher kamen ab und zu und meinten zu mir: Du machst Hip-Hop kaputt!”
“Din Musikkonservatismus isch de chlini Brüeder vom Nationalsozialismus”
(Zünd de Club ah, Molly und Speed, 2019)
In Daifs Wahrnehmung ist ein Grossteil der Hip-Hop-Szene immer noch reaktionär eingestellt. „Die schreiben dann beim Openair-Frauenfeld-Facebook-Post unters Lineup, dass der viele Trap das ganze Hip-Hop-Ding zerstört.” Doch der Wertkonservatismus höre nicht auf der musikalischen Ebene auf, sondern ziehe sich bis ins Politische weiter. Dies sei der Hauptgrund, weshalb er sich auf keinen Fall als Teil dieser Szene betrachten würde.
Gleichzeitig findet Daif komisch, wenn die offenbar immer noch aus der Konformität fallenden Trap- und Cloud-Genres Anlass für linke Journalist:innen sind, diese in den Feuilletons in eine kulturhistorische Deutung einfliessen zu lassen oder gar zu revolutionärem Anti-Pop zu stilisieren. Wird Musik aus der Nische überinterpretiert, fühle er sich unwohl.
Meint er dies etwa als subtile Warnung an die Kulturredaktion von Das Lamm? Oder dringt darin doch bloss eine reflexartige Verachtung gegenüber Hochkultur und elitärem Denken durch?
Man kann sich nicht immer sicher sein bei Daif. Wahrscheinlich hat er ein wenig Angst davor, in einen akademischen Diskurs gedrängt zu werden und bürgerlichen Mustern zu entsprechen. Oder gar einer dieser toxischen cis-Männer-Künstler zu sein, die er kritisiert. Wahrscheinlich ist er sehr darauf bedacht, sich als Künstler vor allem darüber zu inszenieren, was er ablehnt. Doch so klar ist das nicht.
Klar ist: Im Spätsommer kommt sein neues Album. Es trägt den Titel Alles was mir hend wölle isch alles (und alles was mir becho hend isch chalt).
Um was es darin gehen wird? „Ängste und so.” Angestaute intime Sorgen um ihm nahestehende Menschen, die ihm vor dem Zubettgehen durch den Kopf schiessen würden.
Sein Vorhaben mit dem Album: „Den widerlichen Konservatismus crashen.”
Und da er sich nicht an die Regeln, Normen und musikalischen Leitlinien einer bestimmten Szene gebunden fühlt, verlässt er für einmal die Cloud-Rap-Schiene und kehrt zurück zu seinen musikalischen Wurzeln, dem Punk. Damit das nicht konservativ wird, dürfen die feinen Verzerrungen der Tonhöhenkorrektur natürlich nicht fehlen. „Auto-Tune setze ich jetzt halt mehr über Gitarrenelemente ein.”

In einem Ruck steht Daif vom klebrigen roten Sofa im Bandkeller auf, schreitet zu seinem an ein Mischpult angeschlossenen Laptop und spielt einige seiner neuen Songs ab. Die Vorfreude ist ihm anzumerken.
„I wött mit dir Moldy-Peaches-Songs spiele
Sone Szene-Band haa
Wött mit dir im Horst Klub spiele
Und denn schriibemr üsi Näme im Backstage ad Wand”
(Moldy Peaches, Alles was mir hend wölle isch alles, 2021)
Er spricht davon, wie er das neue Album in seinen liebsten Klubs spielen wird, zum Beispiel im Horst Klub in Kreuzlingen. „Ich hoffe, dass ich einige Garage-Heads angepisst machen kann, da ich sie mit meinem experimentellen Punk irritiere.” Wenn gleichzeitig andere von seiner Provokation ermutigt würden, sich ebenso wie er den festgefahrenen Strukturen entgegenzusetzen, dann wäre das für ihn ein Erfolg: „Das wäre schön.”
Schön findet Daif übrigens auch, Lovesongs zu schreiben. Im romantischen Metier fühle er sich berechtigt, politisch zu werden. „Wenn ich politisches Zeug mache, dann, wenn ich über Beziehungen schreibe. Über egalitäre zwischenmenschliche Beziehungen, Herrschaftslosigkeit, die Überwindung toxischer Männlichkeit und so weiter.” Dies sei die legitimste Form, wie er als cis-Mann feministische Arbeit leisten könne.
Von Daifs Neigung zu romantischem Kitsch erzählt auch die Appenzeller Autorin Jessica Jurassica in ihrem eben erschienenen Debütroman Das Ideal des Kaputten. Die Ich-Erzählerin beschreibt darin, wie sie erst per Zufall gemerkt hätte, dass der schüchterne Musiker „D.” in sie verliebt sei. Nämlich dann, als sie unter einem Geschenk von ihm (Songs und Drogen) ein Zettelchen mit einer kurzen und knappen Liebeserklärung findet.
„Baby nu für di.
D.”
(Das Ideal des Kaputten, Jessica Jurassica, Roman, 2021)
Angenommen, dass die im Roman vorkommende Figur „D.” mit Daif und Daif mit David übereinstimmt, verfestigt sich der Eindruck, dass Daifs Schüchternheit sein bewusst gewähltes Markenzeichen ist. Eine Eigenschaft, die ihn schwer zugänglich und somit spannend macht. Als Künstler wie als Mensch.
Für Daif selbst jedoch wären das bloss nicht-relevante Metafragen.
Ob das neue Album ein „Stagedive straight usem lowlife ines Bett us Rose” wird, wie es in seinem 2019 erschienenen Song Wie e Flugi heisst, ist zu bezweifeln. Eher hat sich Daif dem gnadenlosen Hinfallen und rauschenden Wieder-auf-die-Beine-Kommen verschrieben. Denn statt sich auf die Hippie-Tour ein harmonisches Miteinander zu erträumen, sucht er unablässig die Konfrontation mit den Realitäten der bürgerlichen Gesellschaft. Mit dem Jetzt, dem es ein neues Jetzt entgegenzuhalten gilt. Ohne Meta. Dafür mit Mikro und sehr viel Auto-Tune.
Als Daif vom Duo Blay erfuhr, musste er weinen und schrieb in einer Nacht mehrere Songs. Einige davon werden auf seinem neuen Album Alles was mir hend wölle isch alles (und alles was mir becho hend isch chalt) zu hören sein. Diesen Freitag (23.April) erscheint die neue Single 7/10 mit neil.9.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 10 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 780 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 350 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 170 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?