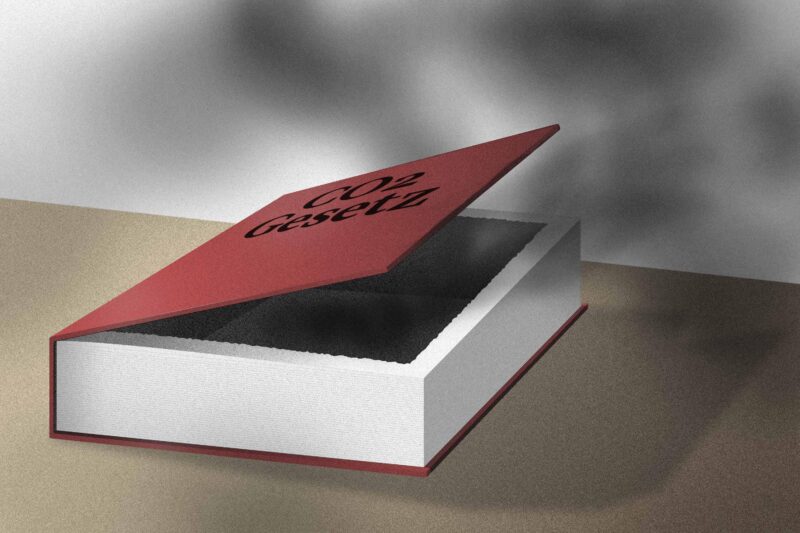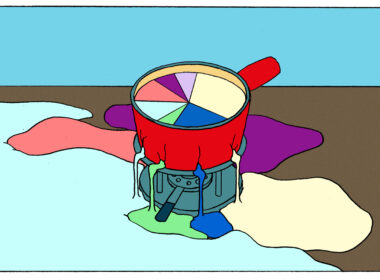Die Flugticketabgabe erhitzte die Gemüter. Im Abstimmungskampf um das revidierte CO2-Gesetz im letzten Jahr wurde sie immer wieder gegen die Vorlage ins Feld geführt. Asozial und unnötig sei sie. 30 Franken pro Kurzstreckenflug wären bei einer Annahme erhoben worden. Was dagegen unterging: Schon lange ist eine Abgabe auf CO2-Emissionen das Kernstück der Schweizer Klimagesetzgebung.
Mit der CO2-Abgabe sollen fossile Brennstoffe verteuert und erneuerbare Lösungen dadurch konkurrenzfähig werden. Ziel ist eine Lenkung: weg von der fossilen hin zur erneuerbaren Energie. Eigentlich hat sich das Instrument als wirkungsvoll erwiesen. Aber schon heute kann die Abgabe umgangen werden. Und wenn es nach dem Bundesrat geht, sollen die Regeln jetzt noch weiter ausgehöhlt werden.
2008 wurde die Abgabe auf fossile Brennstoffe eingeführt und in den folgenden Jahren kontinuierlich erhöht. Seit Jahresbeginn beträgt sie 120 Franken pro Tonne CO2. Zur Einordnung: Ein Economy-Flug von Basel nach Riga und wieder zurück verursacht pro Person eine solche Tonne CO2.
Die CO2-Abgabe ist keine Steuer, sondern eine Lenkungsabgabe. Sprich: Das so eingenommene Geld bleibt nicht beim Staat, sondern wird grösstenteils gleichmässig an die Firmen und die Privathaushalte zurückverteilt. Die Idee dahinter ist eigentlich überzeugend: Wer wenig CO2 verursacht hat, sollte unter dem Strich finanziell profitieren. Ein Teil der CO2-Abgabe wird ausserdem in Klimaschutzmassnahmen investiert. Dazu später mehr.
Allerdings fällt die CO2-Abgabe nicht bei jeder emittierten Tonne CO2 an. Sie wird nur auf Brennstoff, nicht aber auf Treibstoff erhoben. Sprich: Für Heizöl oder Erdgas bezahlen die Verbraucher:innen und Firmen eine Abgabe, für Benzin, Diesel oder Kerosin aber nicht. Der besagte Flug von Basel nach Riga verursacht also zwar eine Tonne Klimagase – CO2-Abgabe muss man darauf aber keine bezahlen.
Der gesamte Verkehrsbereich ist also von der CO2-Lenkungsabgabe ausgenommen. Sie dient lediglich dazu, die Emissionen im Gebäudebereich und in der Industrie zu senken. Nicht, dass das nicht nötig wäre: Fossile Heizungen verursachen einen Grossteil der Schweizer Klimagase und auch in der Industrie sind fossile Brennstoffe nach wie vor weit verbreitet. Zusammen sind sie für rund die Hälfte aller Klimagase verantwortlich, die in der Schweiz ausgestossen werden.
Alles für die Wirtschaft
Im vergangenen Sommer wurde die Revision des CO2-Gesetzes an der Urne versenkt. Das Resultat sorgte für Ratlosigkeit. Jetzt liegt der Entwurf einer neuen Revision des CO2-Gesetzes vor. Er ist momentan in der Vernehmlassung. Bis am 4. April 2022 können die Kantone, Gemeinden und Städte, die politischen Parteien, aber auch Dachverbände aus der Wirtschaft wie economiesuisse oder Umweltschutzorganisationen wie der WWF den neuesten Entwurf kommentieren und Änderungsvorschläge anbringen (das Lamm berichtete). Nach der Vernehmlassung muss das Gesetz noch durch das Parlament – es kann sich also noch vieles ändern.
In Bezug auf die CO2-Abgabe sind zwei wesentliche Neuerungen absehbar, die vor allem in Kombination problematisch wären. Erstens sollen neu alle Firmen die Möglichkeit erhalten, sich von der CO2-Abgabe befreien zu lassen, zweitens soll die sogenannte Teilzweckbindung erhöht werden. Beide Neuerungen dienen vor allem einem Zweck: dem Schutz der Wirtschaft – zu Ungunsten der Nachhaltigkeit.
Zunächst zur Ausweitung der Abgabebefreiung: Während Mieter:innen und Hauseigentümer:innen für jede ausgestossene Tonne Heizemissionen 120 Franken bezahlen, hält bereits das geltende CO2-Gesetz gerade für die Firmen, die am meisten Klimagase verursachen, ein Hintertürchen offen.
Im aktuellen CO2-Gesetz gibt es den sogenannten Anhang 7. Darin werden verschiedene Wirtschaftssektoren aufgezählt. Die Uhrenbranche ist in dieser Liste genauso zu finden wie der Anbau von Pflanzen in Gewächshäusern, die Getränkeherstellung, die Papierproduktion oder der Betrieb von Bädern und Kunsteisbahnen. Was diese Sektoren gemeinsam haben? Sie verbrauchen besonders viele fossile Brennstoffe. Und sie können sich von der CO2-Abgabe befreien lassen.
Um die CO2-Abgabe zu umgehen, müssen die Firmen eine sogenannte Zielvereinbarung eingehen. Sie verpflichten sich damit, ihre Emissionen zu einem gewissen Teil zu reduzieren. In diesen Vereinbarungen wird festgehalten, welche Reduktionsmassnahmen die Firmen in den nächsten Jahren umsetzen müssen, um von den CO2-Abgaben auf die verbleibenden Emissionen befreit zu werden. Was zunächst plausibel erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Schlupfloch für die grössten Klimagas-Emittent:innen.
Wenig Ambitionen bei den Reduktionen
Im Auftrag der zuständigen Behörden untersuchte das unabhängige Beratungsbüro Ecoplan 2016 das Instrument der Zielvereinbarungen. Auch wenn die Massnahmen für einzelne Unternehmen durchaus eine Herausforderung darstellen würden, kam das Beratungsbüro zum Schluss, dass die Ziele in den Vereinbarungen grundsätzlich nur dem langfristigen Reduktionstrend der gesamten Industrie entsprächen. „Wir schätzen die Zielsetzungen im Durchschnitt als wenig ambitioniert ein“, schreiben die Autor:innen.
Wie viel die abgabebefreiten Firmen konkret reduzieren müssen, kann weder für das aktuell geltende noch für das neue Gesetz einheitlich gesagt werden, da sich die Reduktionsverpflichtungen von Firma zu Firma unterscheiden. Das momentan geltende CO2-Übergangsgesetz gibt aber einen Einblick in die zu erwartende Grössenordnung: Um die Übergangsbestimmungen übersichtlich zu halten, wurde für die Jahre 2022 bis 2024 ein einheitlicher Reduktionspfad von 2 % pro Jahr festgelegt.
Will heissen: Indem die Firmen ihre Emissionen jährlich um 2 % reduzieren, sparen sie sich die 120 Franken CO2-Abgabe auf die restlichen 98 % der Emissionstonnen. Die betreffenden Firmen konnten so 2020 laut dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) Abgaben von über 150 Millionen Franken sparen.
Dass es bei den Zielvereinbarungen letztlich um ein Schlupfloch für die grossen Emittent:innen geht, gibt der Bund mehr oder weniger unumwunden zu: Die Abgabebefreiung sei vor allem für Wirtschaftszweige gedacht mit einer hohen Abgabelast, deren internationale Wettbewerbsfähigkeit durch die Abgabe entsprechend stark beeinträchtigt würde. Müssten die Firmen dieser Branchen tatsächlich für jede ausgestossene Tonne CO2 120 Franken bezahlen, könnten sie, so die Begründung, mit der ausländischen Konkurrenz nicht mehr mithalten.
Die Katze beisst sich also in den eigenen Schwanz: Die Politik konzipiert zwar eine Abgabe, die denen wehtun soll, die das Klima belasten, um sie zu Reduktionen zu bewegen. Doch weil das Instrument tatsächlich funktionieren würde, gibt die Politik den Firmen die Möglichkeit, sich der Abgabe wieder zu entziehen. Aus Angst vor negativen wirtschaftlichen Konsequenzen.
Weniger Abgaben für fast alle?
Bis jetzt hat nur ein kleiner Teil der Schweizer Firmen eine solche Zielvereinbarung mit dem Bund abgeschlossen. Gemäss einer Analyse der Eidgenössischen Finanzkontrolle waren es 2017 rund 1’000 Unternehmen. Die Anzahl der CO2-abgabepflichtigen Firmen wird in derselben Analyse hingegen mit über 490’000 angegeben.
Mit dem vom Bundesrat ausgearbeiteten Entwurf eines neuen CO2-Gesetzes würde sich das ändern. Und zwar so, dass nicht mehr nur Firmen bestimmter Wirtschaftssektoren, sondern neu alle Firmen die Möglichkeit hätten, Zielvereinbarungen abzuschliessen – und sich so von der CO2-Abgabe befreien zu lassen.
Ein 2017 vom BAFU in Auftrag gegebener Bericht kommt zum Schluss, dass wohl über 5’000 Firmen von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch machen würden. Ebenfalls laut dem BAFU könnten dadurch je nach Ausgestaltung der Regeln in Zukunft jährlich 1,7 bis 2,6 Millionen emittierte Tonnen CO2 von der Abgabe befreit werden. Bei 120 Franken Abgabe pro Tonne würden die Firmen mit Zielvereinbarung dadurch zwischen 200 und 300 Millionen Franken einsparen. Rund doppelt so viel wie heute.
Eine solche Ausweitung war bereits Teil der Revision des CO2-Gesetzes, das im letzten Sommer an der Urne scheiterte. Der neue Gesetzesentwurf sieht im Bereich der Zielvereinbarungen wenigstens eine kleine Verschärfung vor: Die befreiten Firmen müssten neu aufzeigen, wie sie bis 2040 ganz aus der Nutzung fossiler Brennstoffe (Erdöl, Gas oder Kohle) für die Energiegewinnung aussteigen. Was die Ambitionen dieser Neuerung jedoch wieder etwas relativiert: Die Firmen dürften weiterhin fossile Treibstoffe wie Benzin oder Diesel verwenden oder Plastik für die Herstellung ihrer Produkte einsetzen (Art 31c).
Die einen zahlen weniger, die anderen mehr
Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass durch die Ausweitung der CO2-Abgabebefreiung gerade vonseiten derjenigen Firmen weniger Geld in die Klimakasse fliessen wird, die am meisten fossile Brennstoffe verbrauchen. Denn je mehr CO2-Abgaben anfallen, desto eher lohnt sich der administrative Aufwand, den die Zielvereinbarung mit sich bringt. Hier kommt die zweite gewichtige Neuerung in der geplanten Revision im Bereich der CO2-Abgabe mit ins Spiel: die Erhöhung der Teilzweckbindung.
Wie bereits erwähnt fliessen nicht alle Einnahmen, die über die CO2-Abgabe erhoben werden, direkt an die Bevölkerung und die Firmen zurück. Derzeit wird ein Drittel davon im Rahmen der sogenannten Teilzweckbindung in verschiedene Klimamassnahmen investiert. Finanziert werden damit Gebäudesanierungen, der Ersatz von Ölheizungen, die Förderung der Geothermie, verschiedene Technologieentwicklungen, aber auch der Vollzug der CO2-Vorschriften bei Autoimporten. Die Massnahmen sind unbestritten wichtig.
Neu soll nicht mehr nur ein Drittel der Einnahmen aus der CO2-Abgabe dafür aufgewendet werden, sondern die Hälfte. Der Grund dafür ist klar: die geplante Ausweitung der Abgabebefreiung für alle Firmen. Wenn die Einnahmen auf der einen Seite wegbrechen, muss das Geld an einem anderen Ort wieder reingeholt werden.
Das geht auf Kosten derjenigen, die sich nicht von der CO2-Abgabe befreien können – Privathaushalte und kleine Firmen, für die der administrative Aufwand einer Zielvereinbarung zu gross ist. Sie sollen gemäss dem vorliegenden Entwurf nicht nur weiterhin Abgaben zahlen müssen, sie werden auch einen weitaus kleineren Teil dieser Abgaben zurückerstattet erhalten. Der Vorschlag sieht also eine Umverteilung von KMU und Privatpersonen zu Grosskonzernen vor.
Wenn sich alle drücken können, ist es auch nicht fair
Im vergangenen Abstimmungskampf spielte die geplante Ausweitung der CO2-Abgabebefreiung so gut wie keine Rolle. Dabei wäre die Diskussion darüber, ob den Konzernen diese Ausnahmeregelung zusteht oder nicht, mindestens so wichtig wie die Diskussion über Benzinpreise und Flugticketabgaben.
Dass sich bald alle Firmen von der Abgabe befreien lassen könnten, ist vor allem auch aus klimapolitischer Perspektive absurd. Denn eine weitere vom BAFU in Auftrag gegebene Studie stellte fest, dass „die CO2-Abgabe im Jahr 2015 eine zwei- bis dreimal so hohe CO2-Reduktionswirkung wie das Gebäudeprogramm und die Zielvereinbarungen zusammen” hatte.
Die Ecoplan-Autor:innen sind der Meinung, dass „Zielvereinbarungen keinen Anreiz für den längerfristig notwendigen Strukturwandel“ geben würden. Sprich: Die Befreiung von der CO2-Abgabe wird nicht dazu führen, dass sich eine Wirtschaft entwickeln kann, die das Netto-Null-Ziel erreicht. Stattdessen zementiert sie veraltete, klimaschädliche Produktionsweisen.
Deshalb kommt der Bericht zum Schluss, dass es keine gute Idee sei, die CO2-Abgabebefreiung auf weitere Firmen auszudehnen. Diese sei eigentlich nur als flankierende Massnahme für emissionsintensive Unternehmen eingeführt worden, die im internationalen Wettbewerb stünden.
Und auch die OECD hat die Schweiz in den regelmässig erscheinenden Länderberichten wegen dieser Praxis schon mehrmals gerügt. In neusten Länderbericht von 2021 fordert sie die Schweiz dazu auf, die Befreiungsmöglichkeiten abzuschaffen. Denn: Wenn niemand mehr die CO2-Abgabe zahlt, bringt sie auch nichts.
Und nicht zuletzt sprechen praktische Gründe gegen eine Ausweitung der Zielvereinbarungen. Sie würde einen gigantischen administrativen Aufwand verursachen. Tausende von Vereinbarungen müssten geprüft werden. Das Zollamt müsste jeder abgabebefreiten Firma die CO2-Abgabe auf die erworbenen Brennstoffe einzeln zurückerstatten. Und neu müsste sich die Verwaltung auch noch um die Prüfung kümmern, ob die Firmen bezüglich des Fernziels 2040 auf Kurs sind oder nicht – und falls nötig die CO2-Abgabe doch wieder einfordern.
Kein Veto aus der Politik
Trotzdem bläst der Ausweitung der Abgabebefreiung aus der Politik erstaunlich wenig Gegenwind entgegen. Das zeigen Anfragen bei mehreren Mitgliedern der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK). Die Kommission ist für die Vorberatung des CO2-Gesetzes zuständig.
Martin Bäumle, Nationalrat der Grünliberalen, schreibt uns auf Anfrage: „Vereinbarungen sind konkret, die CO2-Abgabe reduziert noch kein CO2.” Deshalb mache die Ausweitung Sinn und deshalb trage er diesen ausdrücklichen Wunsch aus der Wirtschaft gerne mit.
Und wenig überraschend findet man es auch bei der FDP berechtigt, der Industrie mit dem Instrument der Zielvereinbarungen eine Alternative zur CO2-Abgabe zur Verfügung zu stellen. „Nicht alle Emissionen haben dieselbe Geschichte”, findet FDP-Nationalrat Matthias Jauslin. „Emissionen, welche zum Beispiel bei der Produktion von Zement anfallen, sind für das Funktionieren dieser Branche und unserer Gesellschaft relevanter, als wenn man zum Vergnügen einen Kurztrip mit dem Flugzeug nach Amsterdam unternimmt.” Die Wirtschaft liefere uns, was wir täglich brauchen, und stelle auch entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung.
Doch im Rahmen einer Zielvereinbarung wird nicht unterschieden, wofür die Klimagase ausgestossen werden. Wenn sich dereinst alle Firmen von den Abgaben befreien dürfen, wird der Bund eben gerade nicht mehr unterscheiden, was für eine Geschichte die befreiten Emissionen haben. Egal, ob eine Firma Duftbäumchen und Diamantringe oder Herzschrittmacher und Brot produziert – alle könnten sich mit einer Zielvereinbarung von der CO2-Abgabe befreien.
Trotzdem begrüsst auch Stefan Müller-Altermatt von der Mitte-Fraktion die geplante Ausweitung: „Die Verminderungsverpflichtungen wirken – und zwar mehr als der Lenkungseffekt aufgrund der CO2-Abgabe”, so der Nationalrat in krassem Widerspruch zu obengenannter Studie.
Bei der SP begrüsse man es, wenn möglichst alle Unternehmen in die Dekarbonisierung ihres Betriebes investieren. Aus Perspektive des Klimaschutzes sei es nicht falsch, wenn Firmen wählen können zwischen umfangreichen eigenen Klimaschutzmassnahmen oder Abgaben, die teilweise in Klimaschutzprojekte fliessen.
Probleme sieht die SP-Nationalrätin Martine Munz bei der Administration: „Die personellen Ressourcen für die Erstellung der Zielvereinbarungen und deren Überprüfung müssen gewährleistet sein.” Mit Zielvereinbarungen könnten jedoch vor allem bei kleineren Unternehmen grosse Fortschritte bezüglich Klima und Energie erreicht werden.
Und schlussendlich könne man im Sinne eines Kompromisses auch bei den Grünen die Ausweitung unterstützen, schreibt uns der grüne Nationalrat Bastien Girod auf Anfrage: „Wichtig ist aber, dass die Befreiung der CO2-Abgabe spätestens 2040 ausläuft und bis dahin die Emissionen wenn möglich auf null gesenkt werden.”
Der Kompromiss wäre eine Teilbefreiung
Dass die Unternehmen sich zu Verminderungen verpflichten, ist natürlich grundsätzlich zu begrüssen. Angesichts der Klimakrise bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Dass sie bei der Erarbeitung der Zielsetzungen von den Bundesämtern unterstützt werden: sicher hilfreich.
Dass sie dafür aber gleich von den gesamten Abgaben auf die verbleibenden Emissionen befreit werden, ist vor allem ein beachtlicher Lobbying-Erfolg. Der gutschweizerische Kompromiss wäre wohl eher eine Teilbefreiung von den Abgaben auf die verbleibenden Emissionen.
Die CO2-Abgabe führt für manche Firmen und Haushalte zwar zu einer finanziellen Belastung. Im Grundsatz ist sie aber ein faires, verursacher:innengerechtes Mittel, um der Klimaerhitzung Einhalt zu gebieten. Wer CO2 verursacht, soll auch dafür bezahlen. Wer viel CO2 verursacht, soll entsprechen viel dafür zahlen. Die Zielvereinbarungen stehen schon heute mit diesem Grundsatz im Widerspruch. Und wenn in Zukunft nur noch die KMU und die Privathaushalte zur Klimakasse gebeten werden, verkommt der Kern der Schweizer Klimagesetzgebung zu einer hohlen Farce.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 54 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 3068 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1890 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 918 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?