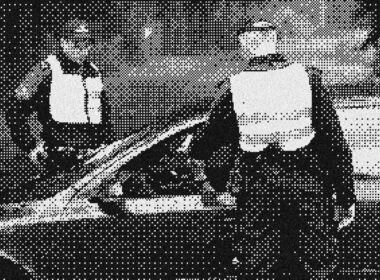Ist Donald Trump ein Faschist? Seit seinem ersten Wahlsieg 2016 wird die Frage hoch und runter diskutiert. Gestandene Historiker*innen des Faschismus wie Jason Stanley, Timothy Snyder oder Robert Paxton bezeichnen den US-amerikanischen Präsidenten mittlerweile als Faschisten.
In den öffentlichen Diskussionen geht es bei dieser Frage meistens um einen Vergleich zwischen Trump und den faschistischen Regimes in Deutschland und Italien der Zwischenkriegszeit. Punkt für Punkt werden die Reden und Politiken Trumps mit jenen Mussolinis und Hitlers verglichen. Und letztlich zeigt sich – oh Wunder! – dass es sowohl Parallelen wie auch Unterschiede gibt.
Faschismus in der „ältesten Demokratie der Welt”
Das Problem an diesem „Faschismusbingo”, wie es Anna Jikhareva und Daria Wild in der Wochenzeitung genannt haben, ist nicht nur, dass es einen häufig ratlos zurücklässt. Man vergisst zudem, dass der Faschismus in den USA eine eigene, wenn auch mit dem faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutschland verstrickte Geschichte hat. Es wird so getan, als ob die „älteste Demokratie der Welt” bisher immun gegenüber faschistischen Bewegungen und Tendenzen gewesen wäre.
Aus der Analyse wird klar, dass die Grenzen zwischen liberaler Demokratie und Faschismus durchlässig sind.
Was passiert, wenn wir nicht nur nach Analogien zwischen Trump und Hitler oder Mussolini suchen, sondern auf die spezifische Geschichte des US-amerikanischen Faschismus blicken? Was passiert, wenn wir denen zuhören, die in den USA seit Langem faschistische Tendenzen analysieren und bekämpfen? Man kommt zur wichtigen Erkenntnis, dass die gegenwärtige Faschisierung tiefgreifende Wurzeln hat.
Diese These vertritt unter anderem der Philosoph Alberto Toscano in seinen Arbeiten. Er stützt sich vor allem auf die Analysen antirassistischer und antikolonialer Aktivist*innen und Theoretiker*innen, zum Beispiel aus dem Umfeld der Black Panther Party der 1960er und 1970er Jahre. Die Keime des Faschismus innerhalb der demokratisch-liberalen Gesellschaft sahen sie in der massiven Polizeirepression, der rassistischen und migrationsfeindlichen Hetze oder dem Gefängnissystem.
Nicht alle erfahren den Faschismus gleich
Die Black Panther Aktivistin Kathleen Cleaver zum Beispiel schrieb 1968: “Der Aufstieg des Faschismus in den Vereinigten Staaten zeigt sich am deutlichsten in der Unterdrückung der Schwarzen Befreiungsbewegung, in der landesweiten politischen Inhaftierung und Ermordung von Schwarzen Leader*innen, in der massiven Polizeikonzentration in den Schwarzen Ghettos überall im Land.“
In den Reden und Schriften der Black Panthers hatte das manchmal etwas Plakatives. Es klang teilweise so, als ob sich ein faschistisches Regime in den USA bereits etabliert hätte. Mit dem Faschismus-Begriff wollten die Aktivist*innen Aufmerksamkeit generieren, teilweise auf Kosten der begrifflichen Genauigkeit.
Die Black Panther Aktivistin Angela Davis war damals wie heute vorsichtiger. Für sie herrschte in den USA kein „ausgewachsener Faschismus“. In der „staatlichen Sklaverei“ der Gefängnisse oder den Zwangssterilisierungen von Frauen of colour sah sie aber faschistische Elemente. Sie unterstrich, dass das „Aufkommen des Faschismus kein isoliertes Ereignis – etwa ein plötzlicher Staatsstreich – ist, sondern ein langwieriger sozialer Prozess“.
Aus ihrer Analyse wird klar, dass die Grenzen zwischen liberaler Demokratie und Faschismus durchlässig sind. So braucht es nicht unbedingt die sofortige Aushebelung der liberalen Verfassung, damit sich faschistische Tendenzen ausbreiten können.
Die Allianz zwischen Rassismus und Kapital beruht auf einer porösen Grenze zwischen Staatsgewalt und terroristischer White Supremacy.
Vor allem erkannten diese Aktivist*innen und Theoretiker*innen, dass sich eine Faschisierung nicht gleichförmig auf die Gesellschaft ausbreitet.
Am eigenen Leib erfuhren sie, dass es zuerst jene trifft, die noch nie als vollwertige Mitglieder eines weissen Amerikas angesehen wurden. Je nach Race, Gender oder Class gibt es „unterschiedliche Erfahrungen“ von Faschismus, wie Alberto Toscano zusammenfasst.
Die Allianz von Rassismus und Kapital
Auf ähnliche Schlüsse kamen Schwarze Aktivist*innen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Schon damals legten sie den Finger auf die Zusammenhänge zwischen Rassismus, kolonialer Unterdrückung und Faschismus. So sahen „radikale Schwarze Aktivist*innen den Aufstieg des Faschismus nicht nur voraus, sie bekämpften ihn, bevor er als Krise erkannt wurde“, spitzt der Historiker Robin Kelley zu. Ihr Widerstand richtete sich gegen den US-amerikanischen Faschismus „in Form von Lynchmorden, einer Unterdrückung von Arbeiter*innenorganisationen und nahezu jeder Protestform sowie eines Ausschlusses Schwarzer Bürger*innen von zivilen und demokratischen Rechten.“
In den 1930er Jahren sah der marxistische und antirassistische Theoretiker W.E.B. Du Bois im systematischen rassistischen Terror eine Form des Faschismus. Dieser hatte sich seit dem Ende des Bürgerkriegs durch staatliche Entrechtung, rassistische Mobs oder Organisationen wie den Ku Klux Klan ausgebreitet. In den 1920er Jahren hatte der Ku Klux Klan zwischen drei und sieben Millionen Mitglieder. Viele von ihnen – oder Personen mit engen Verbindungen zum Klan – bekleideten öffentliche Ämter: als gewählte Politiker, Staatsangestellte, Anwälte oder Polizeichefs.
Laut Du Bois war dieser Terror entscheidend dafür, dass die kapitalistischen Verhältnisse in den Südstaaten nach der Sklavenbefreiung von 1865 aufrechterhalten werden konnten. Die Allianz zwischen Rassismus und Kapital, die bis auf die Eroberung Amerikas im 16. Jahrhundert zurückgeht, beruht also auf einer porösen Grenze zwischen Staatsgewalt und terroristischer White Supremacy.
Der Faschismus hat viele Gesichter
Aus diesen Perspektiven erscheint Faschismus als ein Prozess mit vielen Anfängen und Gesichtern. Nazideutschland und der italienische Faschismus müssen daher als die herausragendsten Beispiele für Faschismus „entthront“ werden, wie der Historiker Geoff Eley schon vor einigen Jahren betonte.
Wer sich fragt, wie lange die Dämme des US-amerikanischen Rechtsstaates den Angriffen Trumps standhalten werden, übersieht etwas Entscheidendes: Der autoritäre Ausnahmezustand ist in Ansätzen bereits vorhanden.
Die entscheidende Frage ist somit nicht, ob Trump ein neuer Hitler oder Mussolini ist. Das hat Sylvie Laurent – Expertin für amerikanische Geschichte – jüngst in einem Artikel für die französische Tageszeitung Libération festgehalten. Unbestreitbar sei jedoch, dass Trumps Politiken und Reden „Elemente der Faschisierung“ enthalten, die tief in der amerikanischen Geschichte verwoben sind.
Dazu zählt sie unter anderem eine eugenisch geprägte Angst vor moralischem und ethischem Verfall, die Anwendung politischer Gewalt, strukturellen Rassismus sowie Hass gegenüber den sozialen Bewegungen und der kulturellen Linken. Auch der wachsende Groll gegenüber dem Staat und den als schwach oder korrupt wahrgenommenen öffentlichen Institutionen ist laut Laurent tief in der US-amerikanischen Geschichte verwurzelt.
Es hat schon begonnen
Wer sich anschliessend fragt, wie lange die Dämme des US-amerikanischen Rechtsstaates den Angriffen Trumps standhalten werden, übersieht etwas Entscheidendes: Der autoritäre Ausnahmezustand ist in Ansätzen bereits vorhanden.
Er zeigt sich zum Beispiel für die Migrant*innen an der mexikanischen Grenze, für die Papierlosen, die sich vor Deportationen fürchten, für die Indigenen Aktivist*innen, die rücksichtslos von der Polizei niedergeknüppelt werden und für die Bevölkerung Gazas, die mit US-amerikanischer Unterstützung genozidaler Gewalt ausgesetzt ist.
Wer die Frage des US-amerikanischen Faschismus nicht von dieser Seite her angeht, schläfert sich mit endlosen Vergleichen selbst ein. Der kann sich nur ungläubig die Augen reiben – nur um sie anschliessend wieder zu verschliessen – , wenn Elon Musk mit einem Hitlergruss die Geister der nationalsozialistischen Vergangenheit vor aller Öffentlichkeit wiedererweckt.
Höchste Zeit also, die Augen zu öffnen und die Illusionen von der „ältesten Demokratie der Welt“ fallenzulassen. Ein Blick auf die antirassistischen und antifaschistischen Kämpfe und Theorien zeigt, woher die gegenwärtige Faschisierung kommt – und wie sie zu bekämpfen ist.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 30 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1820 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1050 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 510 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?