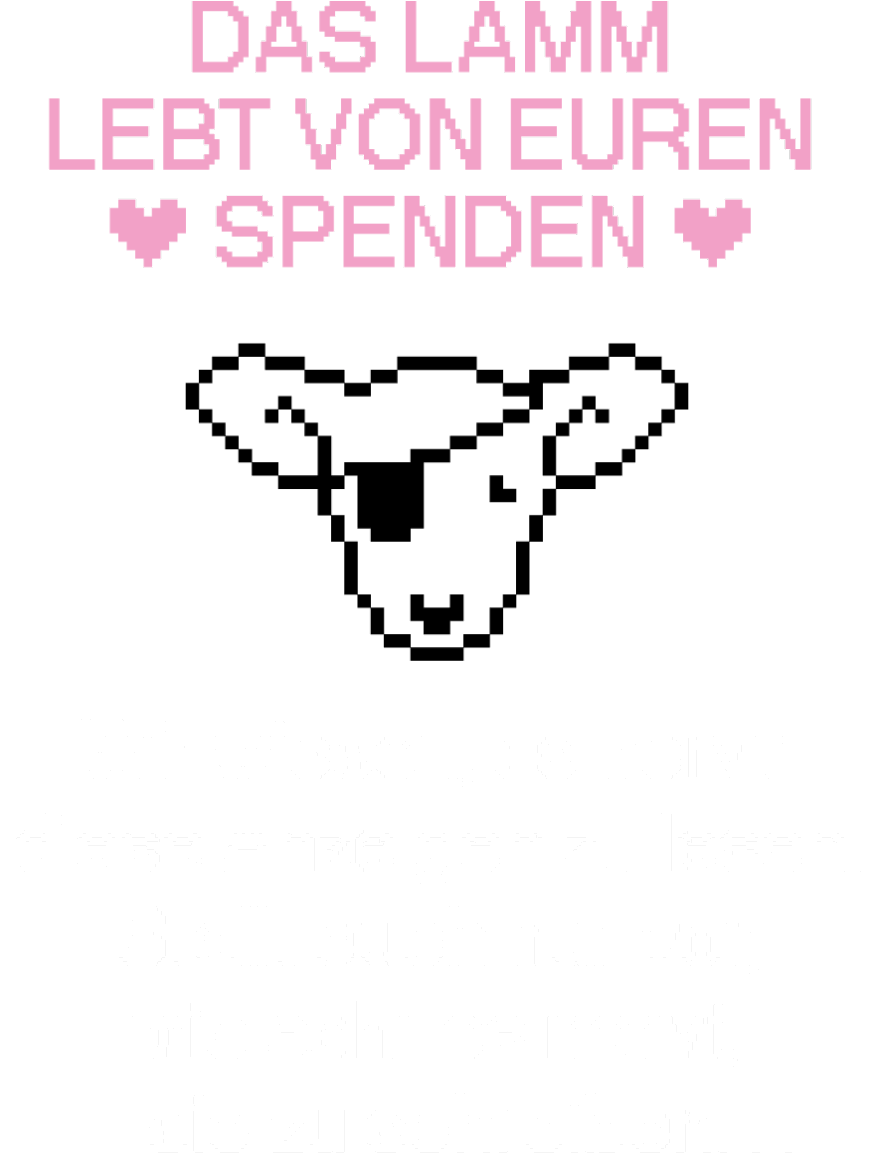Strafzettel ausstellen, Radarkontrollen durchführen, Unfälle protokollieren. Das sind typische Aufgaben im Videospiel „Police Simulator: Patrol Officers” (oder PS:PO), das uns als Streifenpolizist*in in die Strassen der fiktiven US-amerikanischen Stadt Brighton schickt.
Unheroisch und recht gemächlich wirken diese Zielvorgaben im Vergleich zu denen vieler anderer Videospiele. Der Düsseldorfer Vertreiber astragon Entertainment, der das in München entwickelte PS:PO weltweit verkauft, reiht den Titel in seine Produktpalette von „Working Simulation Games” ein – dazu gehören auch ein Tram‑, ein Landwirtschafts- und ein Baustellensimulator. Mit seinen Produkten ist der Vertreiber sehr erfolgreich, allein PS:PO brachte bis heute einen Umsatz von knapp 10 Millionen Euro ein. Das Spiel wurde über eine halbe Million Mal verkauft.
Laut Eigenwerbung auf der Website von astragon Entertainment zeichnen sich die Arbeitssimulatoren „durch gewaltfreies kooperatives Gameplay in äusserst detaillierten, technischen und realistischen Spielumgebungen” aus. Realismus scheint hier zu meinen, dass nicht eine fiktive Handlung in diesen Spielen im Vordergrund steht – sondern das Handeln selbst in Berufen, die für die breite Gesellschaft ein Wiedererkennungspotenzial aufweisen.
Dabei werden durch die Spielgestaltung bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen von diesen Berufen vermittelt – beziehungsweise bereits verankerte reproduziert.
Gerade die vermeintlich „realistische” Simulation von alltäglicher Polizeiarbeit in PS:PO offenbart sich bei genauerer Betrachtung als verklärte Idealisierung, die einerseits Gewalt ausblendet, andererseits gewaltvoller ist, als uns astragon Entertainment glauben lassen möchte.
Gewaltvolle Interaktionen
Gewalt kann auf viele Weisen definiert werden. In PS:PO führt das Zielen mit der Dienstwaffe auf Personen, ohne dass ein „hinreichender Verdacht” vorliegt, zum Game Over und der Text „Du hast polizeiliche Gewalt angewandt” wird eingeblendet. Das impliziert, dass das Ziehen der Dienstwaffe mit hinreichendem Verdacht niemals eine gewaltvolle Handlung ist. Und es suggeriert, dass klar zwischen einem gerechtfertigten und ungerechtfertigten Einsatz der Dienstwaffe unterschieden werden kann. Die Spielregeln von PS:PO kennen keine Grauzonen.
„Es wirkt, als ob das Spiel in einem Universum existiert, in dem es die Black-Lives-Matter-Bewegung niemals gegeben hat.”
Künstler und Softwareentwickler David McNamara in der Spiel-Review von PS:PO
Die Beurteilung der Recht- und Verhältnismässigkeit polizeilicher Massnahmen findet aber oft genau in diesen Grauzonen statt – nicht selten unter Ausschluss oder Abwertung der Perspektive Betroffener. Das zeigt die umfangreiche Studie Gewalt im Amt von 2023. Sie belegt, dass nicht nur bei einem Polizeieinsatz, sondern auch bei dessen Bewertung die Polizei als Institution eine Deutungshoheit über die Situation hat – und es oftmals nicht zur Aufarbeitung übermässiger polizeilicher Gewaltanwendung kommt. Demzufolge wird Gewalt in der Studie als körperbezogener sozialer Prozess verstanden, der ein asymmetrisches Verhältnis zwischen (mindestens) zwei Personen produziert.
Wenden wir diese Definition auf PS:PO an, entpuppt sich die Interaktion mit den computergesteuerten Bürger*innen Brightons als durchaus gewaltvoll: Ich kann jede beliebige Person grundlos anhalten. Es öffnet sich dann ein Aktionsmenü, das mehrere Diensthandlungen zur Auswahl stellt, wie „nach dem Personalausweis fragen”, „durchsuchen” oder „Handschellen anlegen”. Zwar muss ein „Anfangsverdacht” vorliegen, um diese Massnahmen regelhaft durchzuführen. Doch die Strafe für eine nicht den Regeln entsprechende Handlung – ein Punktabzug in der Bewertung nach Schichtende – ist gering und kann mit einer regelkonformen Aktion, für die es reichlich Pluspunkte gibt, leicht ausgeglichen werden.
Beim Spielen entsteht ein Generalverdacht gegenüber den Menschen: Wir können sie nicht verabschieden, sondern nur über das Aktionsmenü „laufen lassen”.
Übergriffe durch die virtuellen Polizeibeamt*innen bleiben also faktisch konsequenzenlos und gewähren ein ständiges Zugriffsrecht auf die Körper der Stadtbewohner*innen.
Dieser Zugriff wird zusätzlich gerechtfertigt: Da eine Beförderung nur durch die Ahndung von Delikten möglich ist, entwickelt sich beim Spielen ein Generalverdacht gegenüber und eine antagonistische Beziehung zu den Menschen Brightons. Mit ihnen können wir keinen wirklichen Dialog führen und sie nicht einmal verabschieden, sondern nur über das Aktionsmenü „laufen lassen”. Eine gewaltvolle Machthierarchie – von kooperativem Gameplay, wie es von astragon Entertainment angepriesen wird, kann keine Rede sein.
Institutionelle Polizeigewalt
Zeigt sie sich in PS:PO auf individueller Ebene bei den Polizeikontrollen, wird die Gewalt, die von der Polizei als Institution ausgeht, völlig ausgeblendet. So bemerkt der Künstler und Softwareentwickler David McNamara in seiner Review des Spiels: „Es wirkt, als ob Brighton in einem Universum existiert, in dem es die Black-Lives-Matter-Bewegung niemals gegeben hat, als ob die ganze Welt nichts von der strukturellen Gewalt wüsste, die Communities von der Polizei angetan wird.”
Natürlich besitzen wir als Spielende einen gewissen Grad an Entscheidungsmacht in der virtuellen Stadt, können eigene Rassismen und Vorurteile ins Spiel tragen, indem wir beispielsweise nur Menschen einer bestimmten Ethnie, eines bestimmten Geschlechts anhalten oder härter bestrafen. Unser Verhalten wird aber immer gleich bewertet: als nüchterne Statistik in Form von Plus- und Minuspunkten am Polizeicomputer.
Gerade aber in Bezug auf die Auswertung von Begegnungen mit der Polizei hat die Studie „Gewalt im Amt” belegen können, dass polizeiliche gewaltvolle Diskriminierungsformen wie Racial Profiling, die systematische, verdachtsunabhängige Kontrolle nach rassistischen Bewertungsmustern, fast nie geahndet werden.
Die zunehmende Militarisierung der Polizei zieht immer mehr Menschen an, die mindestens gewaltaffin, manchmal gar gewalttätig sind.
Die Gründe dafür sind vor allem strukturell bedingt. Die Institution Polizei ermittelt bei Vorwürfen in der Regel gegen sich selbst. Eine externe Kontrollinstanz fehlt. Ausserdem ist es für von Polizeigewalt Betroffene oft schwer, Beweise vorzulegen, es steht dann Aussage gegen Aussage.
Erschwerend kommen zwei soziokulturelle Phänomene ins Spiel, die die Aufarbeitung von Polizeigewalt weiter verkomplizieren, wenn nicht sogar verhindern.
„Cop Culture” und „Copaganda”
Als erstes soziokulturelles Phänomen ist die sogenannte Cop Culture zu nennen, eine von Polizist*innen gelebte, nach innen gerichtete Alltagskultur mit eigenen Regeln. Mehrere Studien konnten belegen, dass sich viele Polizeibeamt*innen als Teil einer Schicksalsgemeinschaft wahrnehmen, was zu einer engen Verbundenheit untereinander führt. Dies erschwert es, übermässige Gewaltanwendungen durch Kolleg*innen behördenintern zu problematisieren, da mit sozialen Sanktionen gerechnet werden muss.
Das zweite soziokulturelle Phänomen ist die mehrheitsgesellschaftliche Überzeugung, dass die Polizei in der Regel richtig und „gut” handelt und das Wohl aller zum Ziel hat.
Für ein idealisiertes, medial verbreitetes Positivbild der Polizei hat sich der Begriff Copaganda etabliert, ein Kofferwort aus „Cop” und „Propaganda”.
Die Überzeugung wird nicht nur über die oft rassistische und klassistische Konstruktion des*der „bösen” Verbrecher*in aufrechterhalten, sondern auch über die bewusste Inszenierung durch die Polizei selbst: Videos auf Social Media von Polizist*innen, die Katzen retten, rappen oder gar solidarisch während der Black-Lives-Matter-Proteste niederknien, werfen ein vorteilhaftes Licht auf die Polizei. Sie vermitteln den Eindruck, dass die Institution bürgernah, menschlich und verständnisvoll agiert.
Dabei, so schildert es der US-amerikanische investigative Journalist Radley Balko, zieht gerade die zunehmende Militarisierung der Polizei immer mehr Menschen an, die mindestens gewaltaffin, manchmal gar gewalttätig sind.
PS:PO erzählt von all dem nichts. Der Simulator unterschlägt strukturelle Problematiken, die mit der Institution Polizei in ihrer jetzigen Form einhergehen, und schreibt ein vor allem auch medial geformtes Bild des nahbaren, oft männlich konnotierten „Schutzmannes” fort, der – unfehlbar und stets gerecht – im Sinne aller handelt.
Man kann von einer Form der Propaganda sprechen. Tatsächlich hat sich für ein solch idealisiertes, über die Massenmedien verbreitetes Positivbild der Polizei der Begriff Copaganda etabliert, ein Kofferwort aus „Cop” und „Propaganda”.
Eine Welt ohne Polizei
Das nur vermeintlich gewaltfreie PS:PO als Copaganda zu betrachten, hilft, die problematischen Aspekte des Videospiels sichtbar zu machen. Es ist ein Produkt, das das Idealbild der Polizei bestätigt, dass in einer weissen, nicht von Rassismus und Armut betroffenen Mehrheitsgesellschaft vorherrschend ist – schliesslich wird dieser Teil der Gesellschaft in der nicht-virtuellen Welt vornehmlich durch diese geschützt.
Die Vorstellung einer zukünftigen Welt ohne Polizei hilft uns, über wirkliche Alternativen nachzudenken.
Gleichzeitig werden die Polizei und ihre Arbeit als selbstverständlich angesehen, als notwendig für eine funktionierende Gesellschaft.
Dabei gab es Zeiten ohne Polizei. Wie es der Philosoph und Sozialwissenschaftler Daniel Loick betont, hilft uns die Vorstellung einer zukünftige Welt ohne Polizei. Nur dann könne man über wirkliche Alternativen nachdenken – zu einer Institution, deren Geschichte untrennbar mit (kolonialer) Gewalt verwoben ist.
Für unsere Gesellschaft kann mit diesen Alternativen gemeint sein, Ressourcen in Institutionen der sozialen Teilhabe – wie Wohnraumbereitstellung, Gesundheitsversorgung und demokratische Selbstbestimmung – umzuverteilen, um die sozialen Ursachen von Kriminalität und Gewalt zu bekämpfen.
Für Videospiele, die sich um Polizeiarbeit drehen, könnte dies meinen, dass es in diesen eine Anerkennung oder eine Auseinandersetzung gibt mit der historischen Verflechtung von Polizei, Rassismus, Klassismus und Gewalt, ohne diese zu reproduzieren. Die Binarität und das oppressive Machtgefälle zwischen dem „gerechten strafenden Schutzmann” und dem „bestraften Kriminellen” müsste aufgelöst werden. Es müsste zu Interaktionen kommen, die nicht länger auf Zwang basieren, sondern über die gemeinsam ausgehandelten Regeln umgesetzt, interpersonelle Konflikte geschlichtet und Sicherheit für alle garantiert werden kann.
Sollte sich die Gesellschaft im Sinne Loicks verändern, würde letztendlich ein Videospiel, das sich um Polizeiarbeit dreht, nicht mehr von sich sagen können, es sei ein Simulator, – sondern höchstens historisch akkurat, weil es eine Welt zeigt, in der es die Polizei noch gab.
Dieser Artikel beruht auf einem Beitrag zum Sammelband „Spiel*Kritik: Kritische Perspektiven auf Videospiele im Kapitalismus”, 2024 erschienen beim transcript Verlag.