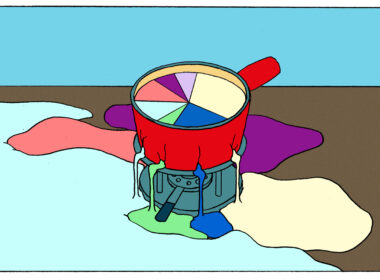Autofreie Sonntage, Tempolimit, ÖV ausbauen und Kurzstreckenflüge reduzieren: Diese Massnahmen könnten aus der Feder des Klimastreiks oder dem Forderungskatalog einer grünen Partei stammen. Nur kommen sie dieses Mal von der Internationalen Energieagentur (IEA). Die IEA wurde 1973 von der OECD gegründet, um die Ölkrise zu bekämpfen. Heute umfasst die Kooperationsplattform 31 Mitgliedsländer.
Wiederholt stand die IEA in der Kritik von Umweltorganisationen, nicht genug dafür zu tun, die Energiewende voranzutreiben. Doch nun scheint sich der Graben zwischen der IEA und den Umweltorganisationen zu verkleinern. Denn: Neuerdings stellt die IEA Forderungen, die vonseiten der Umweltorganisationen schon seit mehr als 20 Jahren wiederholt werden, bislang aber wenig Gehör gefunden hatten bei der IEA.
Mitte März veröffentlichte die Agentur einen Zehn-Punkte-Plan, in dem sie reiche Industrieländer dazu auffordert, Massnahmen zur Reduktion des Ölverbrauchs einzuleiten, um die infolge des Ukrainekriegs steigenden Preise abzufedern.
Die IEA verwendet in ihrer Veröffentlichung den Begriff „fortgeschrittene Volkswirtschaften”. Damit bezieht sie sich auf Länder, die beispielsweise über ein hohes nationales Einkommen (Bruttonationaleinkommen) verfügen. Weitere Kennzahlen, die zur Bestimmung verwendet werden, sind eine tiefe Kindersterblichkeitsrate sowie eine bestimmte Anzahl Jahre Schulbesuche pro Kind (siehe Human Development Index). Es gibt jedoch eigentlich keine klaren Kriterien, wann ein Land als „fortgeschritten” bezeichnet wird und wann nicht.
Die Einteilung von Ländern in „fortgeschrittene” und „entwickelnde” Volkswirtschaften wird in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften deshalb zunehmend hinterfragt. Diese Einteilung entstammt einerseits einem westlichen Verständnis von Fortschritt und Entwicklung, andererseits verändern sich die Lebensbedingungen und somit auch gewisse Kennzahlen wie die Kindersterblichkeitsrate stetig. Die starre Einteilung von Ländern in „fortgeschritten” und „entwickelnd” bildet deshalb die globale Verteilung von Wohlstand nicht akkurat ab. So verwendet beispielsweise die Weltbank die Begriffe nicht mehr in ihrer Datenanalyse.
Auch das Lamm hat sich gegen die Verwendung dieser Einteilung entschieden, weshalb wir in diesem Artikel nicht die Bezeichnungen aus dem Bericht der IEA übernommen haben. Stattdessen verwenden wir den Begriff „reiche Industrieländer”.
Die zehn Punkte haben es in sich – denn sie sollen nicht nur die Teuerung abfedern, sondern auch Russlands Einnahmen aus fossilen Energieträgern verkleinern, die Nachfrage nach Erdöl in Richtung Nachhaltigkeit lenken und damit schlussendlich mithelfen, die Klimakatastrophe abzuwenden. Also sozusagen vier Fliegen mit zehn Klappen schlagen. Konkret schlägt die IEA Folgendes vor:
- Senkung der Tempolimits auf Autobahnen um mindestens 10 km/h
- Möglichst dreimal in der Woche Homeoffice
- Autofreie Sonntage in den Städten
- Vergünstigung des öffentlichen Nahverkehrs und Anreize für Fuss- und Radverkehr
- Wechselnde Fahrverbote für Privatautos in Grossstädten
- Fahrgemeinschaften und weitere Massnahmen zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs
- Förderung von kraftstoffsparendem Fahren im Güterstrassenverkehr
- Hochgeschwindigkeits- und Nachtzüge statt Flugverkehr, wo möglich
- Vermeidung von Geschäftsflügen bei alternativen Optionen
- Mehr Nachdruck bei der Einführung von Elektro- und kraftstoffsparenderen Fahrzeugen
Viele dieser Massnahmen sind nicht neu. Ungewöhnlich ist jedoch, dass diese von der IEA kommen. Denn mit Forderungen nach Verhaltensänderungen war die IEA bislang sehr zurückhaltend.
Würden sich die Schweiz und alle anderen reichen Industrienationen zielstrebig daran machen, diese Empfehlungen der IEA umzusetzen, könnte die Ölnachfrage um 2,7 Millionen Fässer pro Tag gesenkt werden. Ein Fass entspricht 159 Liter. Umgerechnet sind das also rund 430 Millionen Liter Öl pro Tag. Zum Vergleich: Die Schweiz verbrauchte 2020 im Tagesschnitt 27 Millionen Liter Erdöl.
Erstmals wird eine Verhaltensänderung gefordert
Zum ersten Mal fordert die IEA also, dass wir unser Verhalten tatsächlich ändern, um Ölverbrauch und CO2-Emissionen zu reduzieren. Sie fordert nicht nur, auf E‑Autos umzusteigen, sondern das Auto stehen zu lassen. Sie fordert nicht nur, mehr in die Entwicklung erneuerbarer Treibstoffe zu investieren, sondern den Treibstoffverbrauch durch ein Tempolimit zu reduzieren.
Das ist eine überraschende Umorientierung, bestätigt Irmi Seidl, Titularprofessorin für Umweltökonomie an der Universität Zürich und Lehrbeauftragte an der ETH: „Hier wird grade eine heilige Kuh geschlachtet: Die IEA hat mit diesem Zehn-Punkte-Plan einen Bruch mit einem Paradigma begangen.”
Die IEA fordert in ihrem Zehn-Punkte-Plan Dinge, die von liberal-konservativer Seite lange Zeit beiseitegeschoben wurden. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein: „Wenn es die IEA sagt, kann es nicht mehr als überzogene Forderung der Klimabewegung abgetan werden und muss ernst genommen werden”, bestätigt Seidl. „Der Zehn-Punkte-Plan zeigt, dass die Nachfrage ein Hebel ist, um gegen die Klimakrise vorzugehen, unsere energie- und ressourcenintensive Lebensweise bleibt nicht mehr unhinterfragt.”
Die Umsetzung des Zehn-Punkte-Plans ist nicht nur ein Appell der IEA an die Bevölkerung, sondern vor allem auch eine direkte Aufforderung an die Politik. Weil die Schweiz IEA-Mitglied ist, kann sie deren Empfehlung nicht ignorieren. Damit der Zehn-Punkte-Plan umgesetzt werden kann, würde es Verordnungen, Massnahmen und allenfalls Verbote bedürfen, sagt Seidl.
Und die IEA ist nicht die einzige konservative Stimme, die seit Kriegsausbruch die Umstellung auf einen sparsameren Lebensstil forderte. Der ADAC, die Autolobby aus Deutschland, ruft zu Fahrradfahren und Temporeduktion auf. In der Schweiz reichte Othmar Reichmuth, Nationalrat aus der Mitte-Partei, im März 2022 eine für seine Partei ungewöhnliche Motion ein. Darin fordert er den Bundesrat auf, Energiesparmassnahmen zu treffen. Konkret fordert er Massnahmen, die sich auf die Änderung von Gewohnheiten konzentrieren. Ist also tatsächlich ein Umdenken in Sicht?
Es wäre zu wünschen. Denn auch der im April erschienene dritte Teil des neusten Klimaberichts fordert die Politik nicht nur dazu auf, die Energiewende voranzutreiben, sondern auch konkrete Massnahmen zu treffen, welche tatsächliche Verhaltensänderungen zum Ziel haben.
Verzicht – von der Privatsache zum Gesellschaftsproblem
Neu geht es also auch in konservativen Kreisen vermehrt um Verzicht, um das Ändern von Gewohnheiten und um einen massvolleren Umgang mit Ressourcen. Kurzum: Es geht um Suffizienz. Suffizient zu leben, bedeutet, durch Verhaltensänderungen einen möglichst tiefen Rohstoff- und Energieverbrauch anzustreben. Das Problem: Bis jetzt fehlt es uns an einer gesellschaftlichen Umsetzung.
Ein Blick in die nationale Energiestrategie 2050 ist bestes Beispiel dafür. Denn die Energiestrategie beinhaltet vor allem zwei Ziele: Energieeffizienz steigern und erneuerbare Energie fördern. Suffizienz bleibt als mögliche Strategie aussen vor. Felix Nipkow der Co-Leiter vom Fachbereich Klima und erneuerbare Energien der Schweizerischen Energie-Stiftung hat die Erarbeitung der Energieperspektiven 2050+ begleitet. Diese bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung der Energiestrategie 2050, mit der die Schweiz das Netto-Null-Ziel erreichen will. „Bei der Energieperspektive 2050+ wurden Massnahmen rund um Suffizienz bewusst nicht berücksichtigt”, bestätigt er.
Ein Konzept, wie ein massvoller Rohstoff- und Energieverbrauch in die Realität umgesetzt werden könnte, hat die ETH Zürich entwickelt: Die 2000-Watt-Gesellschaft. Das Konzept wird mittlerweile auf nationaler Ebene angewandt und ist Teil des Programms EnergieSchweiz. Das Ziel: den Energieverbrauch pro Kopf auf 2000-Watt zu reduzieren. Momentan befinden wir uns in der Schweiz bei 5000-Watt pro Kopf.
Im Leitkonzept der 2000-Watt-Gesellschaft werden Strategien wie das Sanieren von Gebäuden oder der Einsatz von erneuerbaren Energien benannt, also Massnahmen, die nichts mit dem individuellen Lebensstil zu tun haben. Diese werden zwar mit individuellen Massnahmen wie Flugverzicht, Konsumreduktion oder regionalem Einkaufen ergänzt. Aber: Diese Massnahmen sind so formuliert, dass deren Umsetzung und somit auch die Verantwortung bei den einzelnen Konsument*innen bleibt.
„Es geht darum, Suffizienz politisch zu machen”
„Das liegt daran, dass Suffizienz als ein individuelles Problem dargestellt wird. Von Politiker*innen in der Schweiz wird es bis anhin höchstens in Sonntagsreden erwähnt, um an die Eigenverantwortung der Bevölkerung zu appellieren”, sagt Nipkow. Dabei gehe es darum, Suffizienz politisch zu machen. Nur so werde sie durch die breite Bevölkerung umgesetzt und nicht nur durch die Wenigen, die ihr Leben bereits freiwillig umstellen würden, so Nipkow.
Ohne politische Massnahmen beginnt nur ein kleiner Teil der Bevölkerung suffizienter zu leben. Das bestätigt auch eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) von Ende 2021. Sie untersuchte den möglichen Effekt von freiwilligen Massnahmen auf die Reduktion von Treibhausgasen in der Schweiz und zieht zwei zentrale Schlüsse daraus.
Wenn alle in der Schweiz lebenden Personen ihren Lebensstil anpassen würden, könnte man damit die Treibhausgasemissionen um etwa die Hälfte reduzieren. Die Studie besagt aber auch, dass ein Szenario, in dem alle freiwillig auf Flüge verzichten und ihre Ernährung umstellen, relativ unrealistisch ist. Die Autor*innen gehen davon aus, dass höchstens 20 Prozent der Bevölkerung dazu bereit sind, ihren Lebensstil freiwillig anzupassen.
Die Studie zeigt, was Umweltbewegungen schon lange betonen: Eigenverantwortung und technische Lösungen reichen nicht für Netto-Null.
Verzicht muss organisiert werden
Wird über Suffizienz diskutiert, ist meist die Rede von Produkten oder Tätigkeiten, auf die verzichtet werden soll: weniger Fleisch, weniger Kaffee, weniger Autofahren. Seidl ist jedoch der Meinung, dass wir die Frage nach dem Verzicht präziser betrachten müssen: „Es geht nicht nur darum, suffizient zu leben und zu verzichten. Sondern auch darum, wer vor allem suffizient leben sollte, damit es spürbare Wirkung hat und allen etwas bringt.”
Gegenwärtig kann jede Person selber entscheiden, ob sie etwas zur Abschwächung der Klimakrise oder zur Sicherung der Energieversorgung beitragen möchte oder nicht. Denn es gibt bis jetzt keine gesellschaftlichen Spielregeln dazu, wer wie viel Kosten oder Verzicht in Kauf nehmen muss. In anderen politischen Bereichen, wie zum Beispiel bei den Steuern, ist gesetzlich festgelegt, wer wie viel dazu beitragen muss, dass die Strassen instand gehalten werden können, die Kläranlagen laufen und das Verwaltungspersonal seinen Lohn bekommt.
Auf die Frage, wie genau solche Regeln zum gesellschaftlich organisierten Verzicht aussehen könnten, gibt es wohl keine einfache Antwort. Was aber bereits jetzt klar ist: Es sind vor allem die reichen Industrieländer, die nun liefern müssen. Denn laut der IEA machen sie fast 45 Prozent der weltweiten Ölnachfrage aus. Ihr Anteil an der Weltbevölkerung ist hingegen gering: Es sind nur etwa 15 Prozent. Die Umsetzung des Zehn-Punkte-Plans lohnt sich also vor allem hier, in den westeuropäischen Ländern.
Mit einem vergünstigten ÖV-Ticket macht Deutschland nun einen ersten kleinen Schritt: Ab Anfang Juni kann während drei Monaten jede*r für lediglich neun Euro pro Monat sämtliche Regionalzüge besteigen. Das günstige Ticket soll Anreize setzen, um auf den ÖV umzusteigen. Das Angebot ist aber auf drei Monate begrenzt. Ob weitere Länder nachziehen und gar langfristige Massnahmen wagen, wird sich zeigen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 45 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2600 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1575 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 765 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?